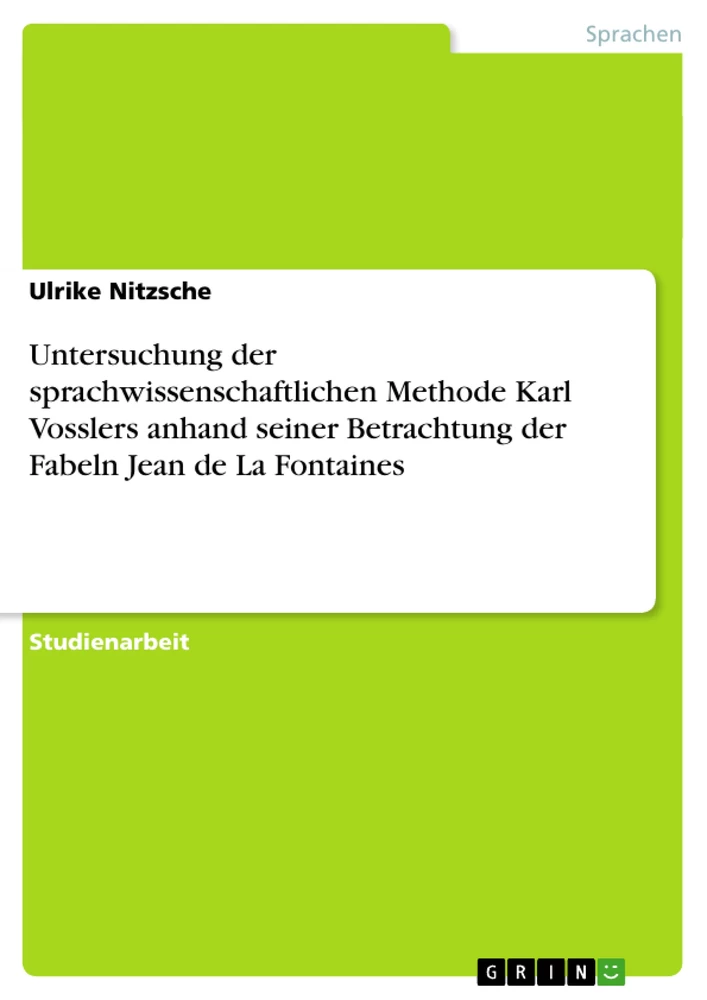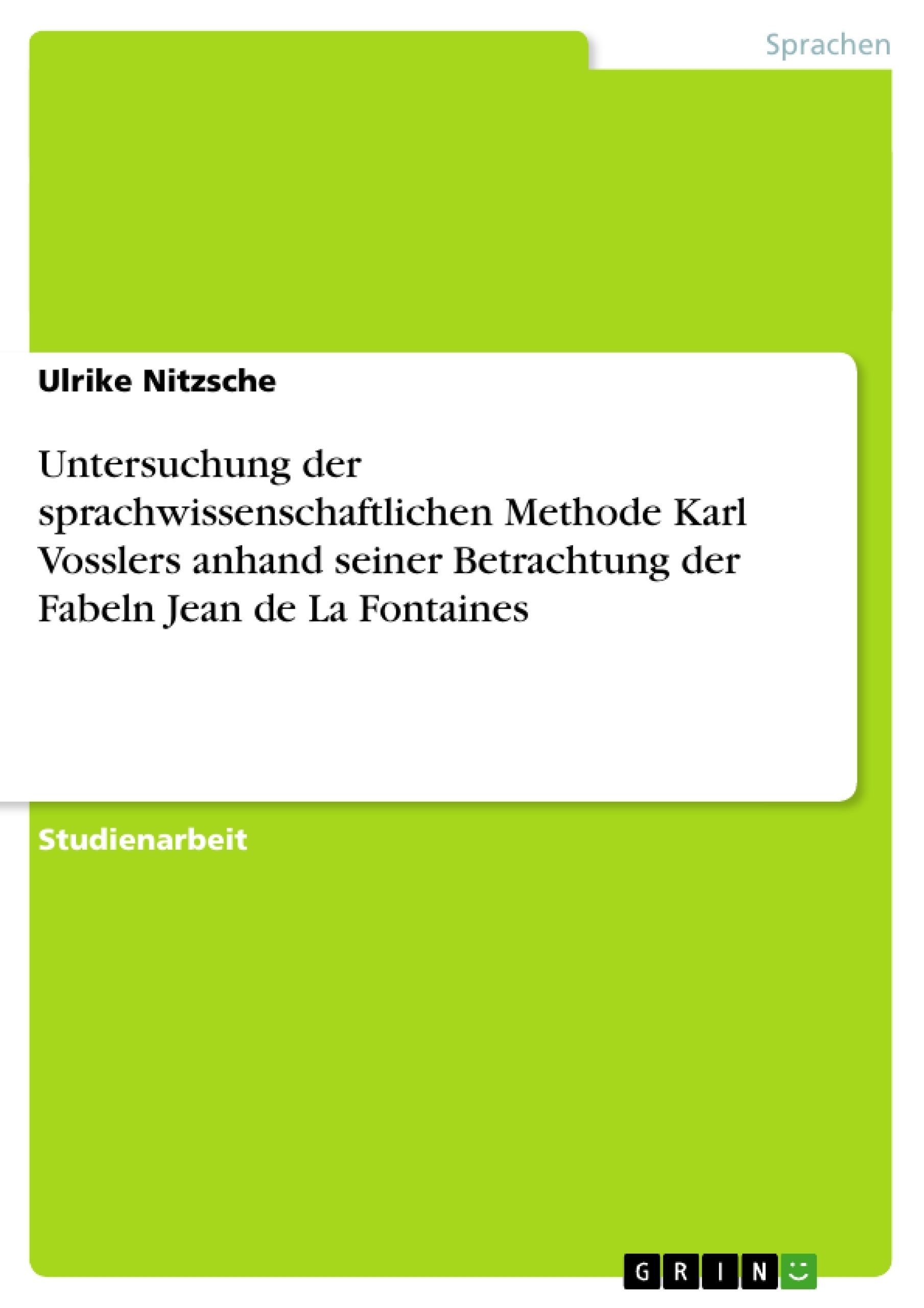Was steckt hinter der meisterhaften Feder Jean de La Fontaines? Diese Frage durchdringt Karl Vosslers tiefgründige Analyse von La Fontaines Fabelwerk, einer Epoche machenden Sammlung, die Generationen von Lesern verzaubert hat. Vossler entführt uns in die Welt des französischen Klassizismus, beleuchtet das kulturelle und gesellschaftliche Milieu, das La Fontaines Schaffen prägte, und enthüllt die subtilen Nuancen, die seine Fabeln so einzigartig machen. Jenseits einer bloßen literaturwissenschaftlichen Betrachtung erkundet Vossler die psychologischen Tiefen des Dichters, seine geistige Entwicklung und die Einflüsse, die sein Werk formten. Er spürt dem feinen Gespür La Fontaines für Ironie, Satire und Humor nach und zeigt, wie diese Elemente in seinen Fabeln auf meisterhafte Weise miteinander verwoben sind. Der Leser entdeckt, wie La Fontaine mit den Konventionen seiner Zeit spielte, moralische Botschaften auf subtile Weise vermittelte und dabei stets den Leser aufs Trefflichste unterhielt. Vossler analysiert La Fontaines Sprachstil, seine Verskunst und die rhythmische Struktur seiner Fabeln, und demonstriert, wie diese formalen Aspekte zur Gesamtwirkung seiner Dichtung beitragen. Dabei werden die Fabeln nicht isoliert betrachtet, sondern im Kontext der europäischen Literaturgeschichte verortet, wodurch Vosslers Werk weit über eine reine Interpretation hinausgeht. Es ist eine faszinierende Reise in das Herz der französischen Sprachkunst, eine Hommage an einen der größten Dichter Frankreichs und eine tiefschürfende Auseinandersetzung mit den zeitlosen Themen, die La Fontaines Fabeln bis heute relevant machen. Die Analyse der Fabeln "Der Rabe und der Fuchs," "Eiche und Schilfrohr," und weitere Meisterwerke bieten dem Leser neue Perspektiven und verdeutlichen La Fontaines Fähigkeit, komplexe menschliche Verhaltensweisen in einfachen, einprägsamen Geschichten darzustellen. Vosslers Buch ist somit mehr als nur eine wissenschaftliche Abhandlung; es ist eine Einladung, die Welt mit den Augen La Fontaines neu zu entdecken und die zeitlose Weisheit seiner Fabeln zu würdigen. Ein Muss für Liebhaber der französischen Literatur, Studierende der Romanistik und alle, die sich für die tieferen Bedeutungsebenen von Sprache und Dichtung interessieren. Tauchen Sie ein in die Welt der Fabeln, entdecken Sie die Kunstfertigkeit La Fontaines und lassen Sie sich von Vosslers profunder Analyse inspirieren.
Inhalt
1. Zur Einleitung
2. Einordnung Vossler in die romanistische Sprachwissenschaft
3. Die idealistische Theorie Vosslers
4. Vossler und La Fontaine
5. Vosslers Betrachtung des Fabelwerks
5.1 Struktur und Gliederung
5.1.1 Aussage der Inhaltsübersicht
5.1.2 Inhalt und Aufbau
5.1.4 Beschäftigung mit der Fabel
5.2 Die konkrete Sprachbetrachtung
5.2.1 Die erste Fabelsammlung
5.2.2 La Fontaines späte Fabeln
5.2.3 Der Anhang
6. Kritik und Zusammenfassung
Anhang
Abb.: Schulen und Strömungen der Linguistik
Biographie Vosslers
Literaturverzeichnis
1. Zur Einleitung
Vossler hat als Sprachwissenschaftler in einer Zeit der Rationalität, der Naturgesetze und Regeln das Neue ausprobiert: die Ästhetik, Kunst, Philosophie Teil dieser Wissenschaft, die zu dieser Zeit Sprache so unsensibel zergliedert, werden zu lassen. Wie geht er dabei vor? Wie kann er überzeugen? Denn dass er mindestens so viele euphorische Anhänger wie verächtliche Gegner hatte, kann nicht von Ungefähr kommen. Und obwohl sein Idealismus keinen Paradigmenwechsel innerhalb der Linguistik bedeutete, ist doch gerade heute der Geistbegriff in der Sprachwissenschaft wieder aktuell (vgl. Trabant).
An der Beschäftigung mit Jean de La Fontaines Arbeiten in seinem Buch "La Fontaine und sein Fabelwerk" soll hier Vosslers Weise der Sprachbetrachtung veranschaulicht und untersucht werden Zu Beginn soll jedoch ein kurzer Abriss über die anfängliche Entwicklung der romanischen Sprachwissenschaft und seine Theorie den Hintergrund seines Wirkens beleuchten.
2. Einordnung Vossler in die romanistische Sprachwissenschaft
Eine Beschreibung von Nationalsprachen findet sich bereits im Europa des 16. Jahrhunderts, jedoch kann man erst ab etwa 1800 von Sprachwissenschaft als Disziplin sprechen.
Der Beginn ist durch eine historisch-vergleichende Methode gekennzeichnet (vgl. Abb. im Anhang), die die gemeinsame Herkunft von indoeuropäischen Einzelsprachen erforscht. Diese Komparatistik liegt auch der romanischen Sprachwissenschaft zugrunde, welche sich um 1820 in Bonn entwickelt. Diez veröffentlicht die Grammatik der romanischen Sprachen(1936-1943)und einEtymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen (1953).
Beeinflusst durch das Aufblühen der Naturwissenschaften, insbesondere durch Darwins Lehre versammeln sich in Leipzig um 1870 die Junggrammatiker, die Sprachbetrachtung als exakte Wissenschaft betreiben und nach deren Ansicht Lautgesetze den Sprachwandel verursachen. Sie sammeln Material um sich empirisch mit Details der Sprache zu beschäftigen. Wichtige Momente werden 1880 von Paul in seinenPrinzipien der Sprachgeschichtezusammengefasst. Meyer-Lübke erstellt eineGrammatik der romanischen Sprachen(1890-1902).
In dieser Zeit des Diktates der Naturgesetze fordert nun Vossler mitIdealismus und Positivismus(1904) undSprache als Schöpfung und Entwicklung(1905) eine ästhetischen Sprachbetrachtung, negiert er die junggrammatisch-positivistischen Lehren als "Afterphilosophie" (Vossler, 1904). Seine Sprachwissenschaft, die er für die elementarste hält, soll Idealismus sein, soll den Geist als Ursache aller Sprachentwicklung erkennen. Auch die Kultur und Psychologie spielen später eine verstärkte Rolle in Vosslers Methode. Die von ihm gewünschte Reform der Sprachwissenschaft vollzieht sich trotz Vosslers Engagements nicht.
Wirklich revolutionär und erneuernd jedoch wirkt de Saussure, der ebenso wie Vossler die junggrammatikalische Denkweise zu überwinden sucht. Sein Strukturalismus, der Sprache als System begreift, beeinflusst alle folgende Sprachwissenschaft: Es bilden sich Schulen in Genf, Prag, Kopenhagen und den USA. Parallel dazu entwickelt sich noch das linguistische Gebiet der Sprachgeographie, die auf synchronischer Ebene nach Verbreitung und gebietstypischen Abwandlungen einzelner Worte forscht. DerAtlas linguistique de la France (ALF)(1902-1910) von Gilliéron und Edmont zeigt die regionalen Varietäten des Französischen.
3. Die idealistische Theorie Vosslers
Für Vosslers Theorie ist zunächst der Begriff Geist von zentraler Bedeutung. Entgegen der junggrammatikalischen Auffassung von Sprache als Materie, als Naturgegenstand, der sich nach festgelegten Lautgesetzen wandelt, sieht er in der Sprache eine schöpferische Tätigkeit des Geistes, die abhängig vom sprechenden Menschen und somit immer im Werden und Wandel begriffen ist, täglich neu erzeugt wird (vgl. Vossler 1905). Der individuelle Geist ist folglich die Ursache, die Triebkraft aller sprachlichen Erscheinungen.
Vosslers Auffassung des Sprachbegriffs umfasst also einerseits Motive Croces, für den Sprache mit Kunst, mit Poesie gleichzusetzen ist, andererseits Humboldts, der Sprache als Sprechen, als geistige Arbeit definiert.
Aus diesen Vorstellungen ergibt sich auch zwingend eine neue Richtung für die Sprachwissenschaft, die es zu Vosslers Zeit generell zur Naturwissenschaft hinzieht (vgl. Trabant); besonders die positivistische Methode der Beschreibung, Systematisierung und Analyse des Materials Sprache ist Vossler zuwider. Sein Methode geht mit einem neuen Gegenstand - verbundene Sprache, statt Worte und Laute - und der neuen synchronischen Perspektive den Schritt der ästhetischen Betrachtung, der Sinnsuche vorab: „erst Stilistik, dann Syntax, dann Lautlehre“ (Vossler, so zitiert in: Casirer). Zur Illustration seiner alternativen Linguistik interpretiert Vossler inSprache als Schöpfung und EntwicklungLa Fontaines Fabel "Le Corbeau et le Renard".
Die Bedeutung der Psychologie für die Sprachforschung lehnt Vossler anfangs rigoros ab: "die Psychologie übt auf die Ergebnisse der Sprachgeschichte dieselbe entscheidende Wirkung, wie die Wetterfahne auf die Richtung des Windes." (Vossler, 1905, 27), erkennt aber bald ein Verhältnis zwischen sprachlichen und psychologischen Kategorien an (vgl. Gamillscheg).
Vosslers Idee der Sprachbetrachtung ist im ganzen nicht unproblematisch und, trotz ihres revolutionären Charakters, weniger erfolgreich. Trabant legt in seiner Rede die Schwächen folgendermaßen dar: Die völlige Abwesenheit allgemeiner Gesetze erscheint zu Vosslers Zeiten - der Niedergang des Naturalismus hat gerade erst begonnen - als großes Manko. Auch ist die Sprachbetrachtung weder eine rein sprach-, noch literaturwissenschaftliche, worauf Vossler bereits selbst hinweist (vgl. Vossler, 1905), so daß letztendlich keine der beiden Disziplinen diese Innovation als die ihre annimmt. Da Vosslers Sprachwissenschaft den Geist derartig in den Vordergrund stellt, ist sie tatsächlich eher als "Geisteswissenschaft" anzusehen (vgl. Helbig).
Ein wichtiges Element stellt für Vossler die Berücksichtigung der sozialen und intellektuellen Geschichte eines Landes und deren Einfluß auf die Sprachentwicklung des Volkes dar. Hier findet sich der Gedanke einer kollektiven Sprachschöpfung: Nationalsprachen sind soziale Techniken, daher muß ein vom individuellen Geist kreierter Begriff vom Sprachgeist des Volkes übernommen und gefestigt oder doch zumindest passiv hingenommen werden, um sich einzubürgern. Da ein Sprecher an seine Zeit und seine Umgebung gebunden, von ihr geprägt ist, spiegelt seine Sprache die derzeitige Kulturgeschichte wider, die wiederum zum späteren Nachvollziehen der Geistestätigkeit berücksichtigt werden muß. Die Entwicklung einer Sprache vollzieht sich folglich abhängig von der Kultur, jedoch ohne feststehende Gesetze (vgl. Vossler, 1904).
Die zunehmende Konzentration auf dieses Kulturmoment ist laut Trabant die Ursache dafür, daß Vossler die angestrebte Reform der Sprachwissenschaft nicht gelingt, da er trotz seiner synchronischen Ansätze die Diachronie nicht in Frage stellt (vgl. Trabant):
"Die synchronische Wissenschaft vom individuellen Geist verschwindet in der Kulturwissenschaft, in einer historischen Wissenschaft des vergesellschafteten Geistes. Die 'ästhetische Sprachbetrachtung' (...) verpufft gleichsam im historischen Paradigma."
Vosslers Methode gerät aber schon damals ins Abseits, einerseits wegen seiner terminologischen Unentschiedenheit und Unschärfe (vgl. Helbig), andererseits wegen der wenig überzeugenden Beispiele, anhand derer er die Sprachbeeinflussung durch die Kultur zu belegen sucht.
Dennoch ist die Bedeutung der Methodik Vosslers innerhalb der Entwicklung der Sprachwissenschaft keine geringe. Er erweitert diese um die geisteswissenschaftliche Perspektive und schafft erst den Pla tz für Ästhetik und Sprachgeschichte (vgl. Baggioni).
4. Vossler und La Fontaine
Vossler beschäftigt sich als Romanist in seinen jüngeren Jahren vorwiegend mit der italienischen, französischen und später spanischen Sprache. Während ihn mit Italien eine herzliche Liebe verbindet, die ihm erst der Faschismus im Zweiten Weltkrieg vergällt, betrachtet er das Französisch wohl eher als einen notwendigen Teil seines Faches. Die provenzalische Troubadourdichtung gehört ab 1903 zu Vosslers Themen, er widmet sich auch Racine und La Fontaine. Bei Gamillscheg ist zu lesen, dass ihm seine Vorträge über die Größen der französischen Literatur als reiner Broterwerb dienen. Die Ausnahme bildet hier Jean de La Fontaine, dessen Fabeln ihn - vielleicht wegen ihrer spöttischen Überlegenheit - besonders anziehen (vgl. Gamillscheg). Bereits in Sprache als Schöpfung und Entwicklung taucht Vosslers Interpretation der Fabel Le Renard et le Corbeau als Beispiel für ästhetische Sprachbetrachtung auf. Sicherlich erscheint ihm solch ein Text schon aufgrund seines geringen Umfangs und der inhaltlichen Dichte gut geeignet; jedoch erkennt der Linguist hier eine Geistestätigkeit, die ihn fasziniert, die er meisterlich findet (vgl. Vossler, 1919). Die Monographie La Fontaine und sein Fabelwerk, hervorgegangen aus Münchner Vorlesungen, setzt nun diese Betrachtung mit mehreren praktischen Beispielen fort. Da hierin auch mit einigen Veränderungen die Interpretation von 1905 zu finden ist, Vossler übernimmt sie leicht verkürzt und formuliert verständlicher, beziehen sich die folgenden Untersuchungen ausschließlich auf das letztere Werk.
5. Vosslers Betrachtung des Fabelwerks
5.1 Struktur und Gliederung
5.1.1 Aussage der Inhaltsübersicht
Das Buch La Fontaine und sein Fabelwerk, erschienenen 1919, müsste nun anschaulich demonstrieren, wie Vossler Sprache behandelt wissen möchte: "... das ästhetisch Interpretierte wird historisch erklärt und in den Zusammenhang der Sprachentwicklung gestellt." (Vossler, 1904, 95) Zuerst soll die "Inhaltsübersicht"
betrachtet werden:
I. Leben und Dichtung in Frankreich unter Ludwig XIV 1
II. La Fontaines Bildungsgang 20
III. La Fontaine als Satiriker und Humorist 40
IV. Fabel- und Tierdichtung vor und nach La Fontaine 63
V. La Fontaines erste Fabelsammlung 87
VI. Die Fabeln aus La Fontaines Spätzeit 113
Anhang I. La Fontaine und das Königtum 142
Anhang II. Die Fabel von der Kutsche und der Mücke 154
Anhang III. Die Wolfsfabeln 160
Anhang IV. Einige Quellentexte 172
Anhang V. Bibliographische Winke 187
Schon allein hieraus ist die Bedeutung erkennbar, die Vossler dem Milieu, der Kultur, den aktuellen Umständen beimisst (I, IV)1. Auch erscheint ihm eine Annäherung an den Dichter selbst, die Kenntnis seines Lebenslaufes und seiner Eigenarten als unverzichtbar zum Verständnis der geistigen Entwicklung und Tätigkeit La Fontaines (II, III). Nach diesen, immerhin etwa ein Drittel des Buches umfassenden Einblicken beginnt die eigentliche Beschäftigung mit der Sprache (V, VI). Dabei handelt es sich erwartungsgemäß um zusammenhängende, poetische Texte - Fabeln. Wie sich diese Sprachbetrachtung genau vollzieht ist hier jedoch noch nicht ablesbar. Die Sinnsuche, also der Versuch, die Arbeit des Geistes zu verstehen, lässt hauptsächlich Interpretation erwarten.
Im Anhang nimmt Vossler vermutlich Bezug auf Inhalte spezieller Fabeln, womöglich auf ihre Besonderheiten, da er sie gesondert aufführt (Anhang II, III) und liefert "Einige Quellentexte"; hierbei handelt es sich entweder um die Quellen Vosslers Sprachbetrachtung - die La Fontaineschen Originalfabeln - oder um die Quellen aus denen der Dichter selbst seinen Stoff bezog. Mit einem kommentierten Literaturverzeichnis zu allen behandelten Themen beschließt Vossler sein Buch, mit dessen Form und Inhalt die Untersuchung von Vosslers Arbeitsweise beginnen soll.
5.1.2 Inhalt und Aufbau
Die inhaltliche Gliederung der Kapitel spiegelt Vosslers Weg der Sprachbetrachtung deutlich wider: vom kulturgeschichtlichen Hintergrund - der Beschreibung des Publikums La Fontaines, der Erläuterungen der Philosophie La Rochefaucoulds2 und des literarischen Zeitgeschmackes, des bon goût und bon sens - geht er aus. Er verweilt in der Auseinandersetzung mit dem Menschen und Dichter La Fontaine und zeichnet den Weg über erste dichterischen Versuche hin zur Meisterschaft, zu den Fabeln nach. Die Arbeitsweise La Fontaines, seine Geistestätigkeit beim Übersetzen, die Eigenheiten seiner Sprache im Allgemeinen und seine Art von Humor sind die folgenden Themen; auch mit der Geschichte der zu betrachtenden Textart, ihren Eigenarten beschäftigt er sich, verweist auf La Fontaines Vorbild und Hauptquelle. Schließlich wird aus der konkreten Deutung der Originaltexte das für La Fontaines Fabeln allgemeingültige, typische, seine schöpferische Individualität abgeleitet. Der Anhang soll vorerst keine Berücksichtigung finden.
Die anfänglichen Betrachtungen stellen keine Hinführung zu den Untersuchungen dar; sie sind ihre Grundlage und somit auch die der Sprachwissenschaft. Die Kenntnis der Lebensweise, der Kultur und des Geschmacks zu La Fontaines Zeiten erst ermöglicht es dem Sprachwissenschaftler den Hintersinn, die Hintergründigkeit zu entschlüsseln zu verstehen. Am Dichterleben interessieren ihn weniger die biographischen Fakten, als die Vertiefung in sein Wesen, seine Seele, seinen Charakter, sein Gemüt - also die Kenntnis seines Geistes, dessen Tätigkeit ja schließlich zu untersuchen ist. Erst mit diesem Wissen ist eine dem künstlerischen Geiste La Fontaines gerecht werdende Interpretation möglich.
Wenn der Anhang vorerst nicht berücksichtigt wird, ist das Werk also in zwei Teile geteilt. In diesen verfolgt Vossler unterschiedliche Absichten: die umfassenden Untersuchungen am Anfang unternimmt der Sprachwissenschaftler sämtlich mit dem Ziel zu beweisen, dass La Fontaines "echter" Geist in seinem Fabelwerk liegt und dass er nur hier seine Meisterschaft erringen konnte. Im Anschluss daran aber, und das tut Vossler durch Interpretation der Originaltexte, soll der Leser von der Meisterlichkeit der Dichtung auch überzeugt werden.
Wozu dienen denn die ersten Kapitel? Vossler beschreibt doch hier, warum diese Meisterschaft der La Fontaineschen Sprache gerade in der Textart der Fabel ihren Höhepunkt erfährt. Er stellt dabei folgende Fragen: Was zeichnet das damalige Publikum und dessen Geschmack aus? Wie muß man sich La Fontaines menschliche und dichterische Eigenarten vorstellen? Was macht die Fabel geeignet für die Art des Dichters? usw. Vossler erklärt alle diese Einzelheiten deutlich, um ein möglichst umfassendes Verständnis für den Geist des Dichters vor dem Hintergrund aller zeitlichen und kulturellen Gegebenheiten zu entwickeln. Die scheinbar zusammenhangslosen Elemente werden von ihm beleuchtet, da sie am Ende alle als Teile des Beweises, wie Puzzlesteine zusammengefügt, die Richtigkeit seiner These, den Zusammenhang aufzeigen sollen. Dies wird in der näheren Betrachtung von Details nachvollziehbar:
Vossler schildert die Hörerschaft der La Fontaineschen Dichtung (vgl. I, 9ff). Es ist die feine Gesellschaft in Paris, die zur Zeit des Sonnenkönigs weder politisch noch sozial bedeutsam und daher mit ihrer Selbstdarstellung beschäftigt ist. Bei Treffen in den Salons ist Unterhaltung oder Gesellschaftspsychologie erwünscht; der gute Geschmack sowie der gesunde Menschenverstand bestimmen die höfische Literatur, Verstöße dagegen sind tödlich für den Dichter. Unvereinbar erscheint dies mit La Fontaines umfassender Belesenheit auf dem "galanten und erotischen" (II, 22) Gebiet, der Langeweile und Unterhaltungssucht dieses "Genussmenschen und Müßiggängers" (III, 41), von der berichtet wird. Aber gerade hier, in den steifen, anständigen Salons erwacht und blüht die zweideutige sinnliche Erzählkunst des von Mäzen abhängigen Dichters. Vossler leitet sehr einleuchtend und schlüssig her, wie dies Unerwartete aus der Wesensart des Dichters heraus geschieht: La Fontaine muß natürlich Verse hervorbringen, um sich die Gunst seiner Gönner zu erwirken und zu erhalten. Was ihn aber stilistisch reizt und herausfordert, und hier spielt seine Wesensart eine Rolle, ist es, unsittliche, derbe und heikle Stoffe so künstlerisch in Worte zu fassen, dass sie außerordentlich unterhaltsam und gleichzeitig salonfähig werden, das heißt den gesellschaftlichen Anstand nicht verletzen. Dies bereitet ihm Spaß, hier vervollkommnet er die Schmiegsamkeit seiner Sprache. La Fontaines Umgang mit dem Stilproblem wird von Vossler am Beispiel einer Ariost- Übersetzung, dem "berüchtigsten und anstößigsten Gesang aus dem Orlando furioso" (III, 44), folgendermaßen beschrieben:
"Tänzelnd, witzelnd, mit neckischen Anspielungen und Reflexionen geht er um den Schmutz herum und gerät, je geistvoller er das Anstößige meidet, in das Schlüpfrige hinein, um das es ihm in letzter Hinsic ht auch zu tun ist." (III, 45)
Freilich versucht sich der Dichter auch in getragenem, feierlichen und heroischen Stil der höfischen Prunkliteratur. Oden, Theaterstücke, Auftragswerke beschäftigen ihn sein Leben lang. Jedoch bringt es La Fontaine auf diesem Gebiet nur zu mäßigem Erfolg; Vossler bezeichnet eine Dichtung von 1657, die die Geschichte von Venus und Adonis zum Thema hat, als "eine kalte, geklügelte Schaustellung von süßlichen Bildern, witzelnden Vergleichen, rhetorischem Lyrismus" (II, 34). Die anschauliche Beschäftigung Vosslers mit La Fontaines Wesen, seinem Geist dient dazu, die Logik und Bedingtheit der Schlussfolgerung Vosslers zu verdeutlichen: La Fontaine kann in diesen Dingen gar nicht erfolgreich sein, denn sein echter Geist, die "schelmischen Flatterseele" (II, 38) ist abwesend. Daher fehlt seiner meisterlichen Sprach- und Stilkunst, seiner vollendeten Technik das Leben, eben der Geist und macht sie fade und gewöhnlich. Seine Meisterschaft zeigt sich doch gerade deshalb in seinen Versnovellen, inLes Amours de Psychéet de Cupidonund in höchster Vollendung in seinen Fabeln, weil La Fontaine dort "seine kleine lyrische Seele" und "seine weltmännische und naive, gutmütige Schalkerei" (II, 38) in freier Entfaltung wirken, plaudern, scherzen lässt. Wie Vossler darlegt, dass die Fabel die natürlichste Ausdrucksform für La Fontaine ist, soll im Folgenden geprüft werden.
5.1.4 Beschäftigung mit der Fabel
Das vierte Kapitel widmet Vossler also der Frage nach der besonderen Eignung der Fabel für La Fontaines Zwecke. Er setzt sich dafür mit dem Ursprung der Fabel, ihren Formen auseinander, verfolgt ihre Entwicklungsgeschichte. Da dem Leser durch die vorangegangenen Kapitel das Wesen und die Zeit La Fontaines bereits bekannt sind, kann er weitestgehend selbst Parallelen ziehen, wie einige Beispiele zeigen:
Die Textart Fabel ist laut Vossler nicht festzulegen, sie zeigt Einflüsse aus Lyrik, Epik und Dramatik, ohne dass sie selbst jedoch einer Stilrichtung zuzuordnen wäre. Sie lässt eine Synthese verschiedener Stile zu, ermöglicht also entsprechende Freiheiten, die jedoch einen meisterlichen Umgang mit den Stilarten voraussetzen. Dass La Fontaine sich stetig in den Stilarten übt und somit Beherrscher einer meisterlichen Stilkunst ist, wurde vorher bereits deutlich dargestellt. Aber auch dass die Fabeln Platz zur eigenen Schöpfung und Meisterschaft bieten, sich individuell formen lässt, also für den freien, beweglichen Geist La Fontaines geeignet ist, wird durch den Hinweis auf die beständige Veränderung und Entwicklung dieser Textart offengelegt. Als "Zwittergattung" (IV, 71) angelegt bietet die Fabel Raum für Zweideutigkeiten, Hintersinn, Geschmeidigkeit des Geistes, was wiederum ganz im Sinne des Dichters ist. Zusammen mit der Doppeldeutigkeit ist die Möglichkeit gewöhnliche Tiere - Hahn, Fuchs, Wolf, Löwe, Schwan, Katze - zu den Akteuren zu machen in der Fabel gegeben. Als Anhänger der Maxime La Rochefaucoulds interessiert La Fontaine, auch das weiß der Leser schon, die Darstellung der Verkleidung und Verhüllung des Instinkthaften, Triebhaften, des typisch Menschlichen.
Für den Leser wird jedoch auch sichtbar gemacht, dass erst die Beschäftigung mit den Fabeln den Weg zur Meisterlichkeit des Dichters vollendet hat. Ein nachahmenswertes Vorbild für die Kunst der Bearbeitung, für die "Eleganz des Ausdrucks" (IV, 72) hat La Fontaine in Phaedrus, verschiedene Variationen desselben Stoffes reizen ihn an der FabelsammlungMythologia aesopicades Isaac
N. Nevelet. Hier findet der Dichter die Stichworte die er durch seine Formulierung, seine persönlichen Note und Stimmung zu kleinen Meisterwerken verarbeitet.
5.2 Die konkrete Sprachbetrachtung
5.2.1 Die erste Fabelsammlung
In Kapitel V und VI nimmt Vossler die Interpretation von Originaltexten in Angriff; die Meisterschaft La Fontaines soll nun als solche nachgewiesen werden. Dabei ist der Aufbau beider Paragraphen ähnlich: einer einleitenden Erklärung folgt die Sinnsuche im konkreten Text und allgemeinere Ausführungen zum betrachteten Phänomen schließen sich an.
So spricht er im ersten Fall anhand der Fabel vom Fuchs und vom Raben über die Sprachkunst La Fontaines, um zum Verhältnis des Dichters zur Sprache, zu seinem Umgang mit ihr zu kommen. In der ausführlichen Betrachtung meist ganzer oder sogar mehrerer Verse - die Texte gliedert Vossler entsprechend seiner Theorie: in Sinneinheiten - zeigt er die "verstandesmäßige und geistige Sprachnüance, eine witzige Verschlagenheit und Hintergründigkeit des Ausdrucks" (V,87). Kaum übersetzbar erscheint ihm La Fontaine gerade deshalb, weil seine Sprache nicht allein durch ihren Klang und die Wortwahl, sondern auch durch syntaktische Umstellung, Verkürzung und Parallelität dem Leser Sinn, wichtige Inhalte vermittelt. Nur so ist die "epigrammatische Kürze" (V, 95) möglich; die sorgfältige Wahl eines Wortes, einer vielleicht untypischen Wendung illustriert beispielsweise die "Gemütsart" der Tiere und ihre Beziehung zueinander: der Rabe thront aufgeblasen (perché), statt nur zu sitzen, der Käse wird als Beute bezeichnet (proie) und deutet so die Konkurrenz der beiden an usw. (vgl. V, 90, 95). Von der konkreten Sprachbetrachtung wird übergeleitet zur allgemeinen Erklärung: Sprache wird nun als ein Medium, Dichtung als ein Verhalten zu diesem behandelt. Dabei kann der Dichter sich motorisch verhalten - hier spielt dieBewegtheitseines Geistes eine Rolle; oder aber die Beweglichkeitdes Geistes bewirkt den sensiblen Umgang mit der Sprache, wie es, so Vossler, bei La Fontaine am ehesten der Fall ist (vgl. V, 96f):
"Das Geheimnis der La Fontaineschen Sprachkunst ist, der Sprache so wenig wie möglich zuzumuten und sich so viel wie möglich von ihr suggerieren zu lassen. Deshalb ist dieser Mensch so faul gewesen." (V, 97).
Die Untersuchung der Stilkunst führt Vossler mit der Interpretation der FabelLe Chêne et le Roseauebenfalls vom Besonderen zum Allgemeinen. Hier soll "die geschlossene und doch nach allen Seiten hin strahlende Form seiner Fabel" (II, 39) aufgezeigt werden. Wie der Leser schon weiter vorn erfahren hat, beherrscht La Fontaine alle und übt sich auch fortwährend in den verschiedenen Stilarten. So wählt La Fontaine in seiner Fabel einen heroischen Stil, um das Heldentum, die Größe der Eiche und auch die Schilderung des herannahenden Sturmes zu vermitteln. Jedoch erkennt Vossler hierin die reine Äußerlichkeit, denn der Dichter verweilt nicht bei der Erzählung des ruhmreichen Unterganges der Eiche, schreibt also keine "Heldentragödie" (V, 103). Den Stil wählt er, um den ironisch-heiteren Grundton der Fabel zu betonen: "der Stil vermag (...) die hohen (Worte) durch Komik und Ironie (zu) erniedrigen" (V, 98). Deshalb bekommt die heroische Eiche naiv-kindliche Rede in den Mund gelegt, die ein sehr beschränktes Denken zeigt, vermag der stürmisch brausende Nordwind nichts gegen ein Hälmchen auszurichten, obwohl er doch die mächtige Eiche umwirft, erweist sich die kleine, biegsame Binse, die von der Eiche wegen dieser Eigenschaften bemitleidet wird, zu guter Letzt als klüger und übersteht unbeschadet den Sturm. Dem Doppelsinn des tragische Sturz der Eiche und der Überlegenheit der Binse wird La Fontaine durch die Synthese zweier Stile gerecht. Die besondere Stilkunst besteht für Vossler des weiteren im Aussparen, Verkürzen, Verhüllen. So verwahrt er sich, besonders was die Moral betrifft, vor Banalitäten, lässt lieber die Ereignisse für sich sprechen. Für die allgemeine Arbeitsweise des Dichters fasst Vossler daraufhin zusammen, dass in jeder Fabel diese originelle Verknüpfung meist zweier Stilarten auftaucht, worin der Sprachwissenschaftler die Ursache für die "durchgehende dramatische Bewegtheit seiner Erzählungskunst" (V, 105) sieht, die doch niemals ihren gemütlichen, unterhaltenden Plauderton verliert.
Vosslers dritte Fabelbetrachtung hat Le Coq et la Perlezum Nachweis des Witzes der metrischen Symmetrie zum Gegenstand. Allerdings ist der Bezug zum Text hier nicht mehr so eng und umfangreich, wie in den vorangegangenen Darstellungen. Zuerst verweilt Vossler bei einer längeren Überleitung mit Vermutungen und ihrer Widerlegung. Bei allem, was der Leser über den freien, geschmeidigen und lebhaften Geist La Fontaines erfahren hat, müsste ihn des Dichters Neigung zu einengenden Reimen und Rhythmen verwirren. Für Vossler ist diese jedoch wiederum aus La Fontaines Geist und seiner Sprachschöpfung heraus zu verstehen: einerseits entspricht die rhythmische, gereimte Verarbeitung der Sprache dessen Geist. "Wie ein lebhaftes Kind hält er das schrittweise Gehen nicht lange aus und muß tanzen und hüpfen." (V, 105). Andererseits, und hier liegt wohl der Hauptgrund, erlaubt die gesellschaftliche Sitte dem Dichter in Versen eine viel kühnere, ungewohntere Wortwahl als in der Prosa. Und genau an dieser Ungezwungenheit und Eigenheit der Wendungen ist es La Fontaine ja gelegen. Innerhalb der Versdichtung nimmt er sich jedoch die größtmögliche Freiheit durch die Wahl des vers libre. Dort kann er Sinn schaffen mit Rhythmus und Reim, ohne dass er durch diese allzu sehr eingeengt ist (vgl. V, 106). Wie diese Sinnstiftung am vonstatten geht, erklärt Vossler nun an der Fabel vom Hahn. Hier liegt der Witz in der metrischen Symmetrie, der Parallelität: einerseits geht es um den Hahn, der eine wertvolle Perle gegen ein Hirsekorn, andererseits um einen Dummkopf, der ein wertvolles Papier gegen Geld tauscht. Das Wiederaufgreifen des Rhythmus, des Reims, die Gleichheit der einzelnen Partien in der Strophe des Hahnes und des Narren wirkt wie ein Echo, dass beider "Unfähigkeit für höhere Werte" (V, 107) noch ironischer deutlich macht. Die Metrik soll nicht klanglich wirken, sondern zur Vernunft des Lesers sprechen; La Fontaine vermittelt dadurch Hintersinn und Witz. Klang und Rhythmus der Sprache werden von ihm im Sinne seines Geistes, seiner Moral gebraucht und auch nur, wenn sie dieser Absicht zuträglich sind.
5.2.2 La Fontaines späte Fabeln
Vossler hält die La Fontainesche Sprach-, Stil und Verstechnik bereits in dessen erster Fabelsammlung für meisterlich und ausgereift. Eine Weiterentwicklung hält er, wenn überhaupt, nur durch die vollständige Entfaltung der persönlichen, menschlichen Note für möglich. Diese "menschliche Fülle und Tiefe" (VI, 114) nimmt bei La Fontaine im Alter zu und gleicht das Nachlassen seiner künstlerischen, komponierenden Kraft aus, woraus sich Vossler die Jahrzehntelang anhaltende Frische der Fabeln erklärt. Die weiteren Betrachtungen beziehen sich auf die Moral in La Fontaines Fabeln. Diese bleibt ethisch neutral und mittelmäßig, ist eher eine veränderliche Weisheit, die sich dem wirklichen Leben anpassen lässt, als eine starre Regel, n welche die Realität gezwängt wird. Hierin sieht Vossler den Beweis, dass selbst La Fontaines Moral ästhetischen Zwecken dient - nämlich der Erzeugung eines matten Hintergrundes für die lebhafte, farbige Geschichte, die in der Fabel erzählt wird. Diese Grundierung aber ist die Spiegelung der Stimmung und Laune des Dichters, der Formgedanke (vgl. VI, 116ff). Im Hinterkopf hat der Leser hier zusätzlich die Beschreibung des La Fontaineschen Gemüts, seines lockeren Lebensstiles, seiner Freude am Necken und Witzeln - diesen Menschen kann er sich schwerlich als Moralisten vorstellen. Umso einsichtiger erscheint dadurch Vosslers Schlussfolgerung, dass die in einigen Fabeln betonte Moral nur Schabernack und Ironie ist. Mit dem Hinweis auf die von La Fontaines Stimmung abhängige Varianz der moralischen Themen eröffnet Vossler den zweiten Teil, in dem er das Thema des Todes näher verfolgt. An drei inhaltlich sehr ähnlichen Fabeln - ein lebensmüder, unglücklicher Mensch fleht den Tod herbei, hält jedoch am Leben fest, als jener tatsächlich auftaucht - will er die jeweilige Gemütslage La Fontaines nachvollziehen. Ausgehend von "kalter Ironie" (VI, 121) in der ersten Fabel wird sie ein "sanftes, mitleidend resigniertes Lächeln" (VI, 123) in der zweiten und schließlich, indem sie eine neue Wendung nimmt - der Tod kommt seiner Pflicht nach und der Dichter gibt ihm darin recht - erscheint sie als aufgeklärter "heiterer Verzicht" (VI, 126) auf das erfüllte Leben. Hierin entdeckt Vossler einen Forschritt der individuellen Note, die La Fontaines zunehmende Lebenserfahrung sichtbar macht. Gleichzeitig spielt auch der Wandel der äußeren Umstände hin zur Aufklärung in des Dichters Werk eine Rolle, wodurch Vossler die in späteren Fabeln verstärkt auftauchende Moral, die anfangs meist verschwiegen wurde. Hier zieht er die Fabel von Ratte und Elefant heran, um sie mit der von Eiche und Binse zu vergleichen. Die Unterschiede in der Leidenschaftlichkeit seiner Moral - einmal phantastischer Pathos, beim anderen lehrhafte, nüchterne Sprache - sieht Vossler zusätzlich in der Stimmung des Dichters begründet. Als dritten Text, der den Gegensatz von Schein- und wirklicher Größe zum Thema hat, nimmt Vossler die Geschichte vom Donau-Bauern hinzu. Er möchte die Nähe des La Fontaineschen französischen Geistes, dessen Kunst im Zeichnen eines "Seelengemäldes" (VI, 131) darzustellen Vosslers Absicht ist, zum deutschen illustrieren. Hiervon leitet er dann auch zur grundsätzlichen Welt- und Lebensanschauung des Dichters über, dem Naturalismus, der das scheinbar Widersprüchliche, Unvereinbare als natürlich nebeneinander stellt. Und dies vermag ja auch La Fontaines Stil.
Zusammenfassend verweist Vossler schließlich auf die Kostbarkeit und Seltenheit des unterhaltenden, befreienden, Erholung spendenden Charakters der Fabeln Jean de La Fontaines.
5.2.3 Der Anhang
Nun soll auch der Anhang noch seine Beachtung finden. In drei Kapiteln fährt Vossler mit der Untersuchung von Fabeln fort, vertieft sich aber in speziellere Themen, zeigt, wie sich die Dichtkunst in Einzelheiten offenbart. Gemeinsamer Schwerpunkt der ersten beiden Kapitel ist es nachzuweisen, dass sich der La Fontainesche Geist in dessen Fabeln stets natürlich ausgedrückt hat, selbst wenn der Dichter das Entgegengesetzte versucht hat.
Dies erklärt Vossler zuerst an der Fabel vom Bauch, in der La Fontaine - statt das Königtum zu preisen, wie es eigentlich seine Absicht war - die "rein theoretische und gesinnungslose Erledigung" (Anhang I, 152) des Königtums unternimmt, sogar indirekt vom Prinzip der Solidarität spricht. In der FabelLe Coche et la Mouche, in der er gegen Wichtigtuerei und falsche Geschäftigkeit gepaart mit Impertinenz vorzugehen beabsichtigt, spürt der Leser trotzdem die Sympathie des Dichters für die Mücke, an deren widerlichen, aber allzu menschlichen Benehmen sich letztendlich nur der Moralist stört.
Mit der Betrachtung von vier Wolfsfabeln beleuchtet Vossler die Entwicklung eines moralischen Motivs - das des naturrechtlichen Verhältnisses von Wolf und Schaf - innerhalb der Schaffenszeit La Fontaines. Der Wolf macht dabei eine Entwicklung "von geistloser Tierheit" (Anhang III, 171) in der ersten Fabel über Denken, Heucheln, Selbsterziehung wieder nur zu seiner ursprünglichen Wolfsnatur, die er in der letzten Fabel philosophisch verklä rt annimmt, durch.
Zum Schluss liefert Vossler noch Quellen, derer sich La Fontaine bedient hat, und fügt ein kommentiertes Literaturverzeichnis hinzu.
6. Kritik und Zusammenfassung
In der Sprachwissenschaft, wie Vossler sie in diesem Buch betreibt, ist natürlich die Objektivität vielerorts verlorengegangen und das besonders, weil einzelne Texte interpretiert werden. Diese Deutungen sind ja ihrer Natur nach subjektiv, da es sich hauptsächlich um Vermutungen und Möglichkeiten handelt; Beweise sind daher durch eine solche Textbetrachtung, die tief in den Bereich der Literaturwissenschaft hineinreicht, kaum zu erbringen. Zweifel kommen auch an der Wahrhaftigkeit der Aussagen Vosslers auf: Er lehnt jegliche Empirie in der Linguistik ab und verzichtet daher selbst völlig darauf. Dennoch möchte er Eigenarten, Besonderheiten, das Typische an La Fontaines Sprache im Allgemeinen zeigen, indem aus der Beschäftigung mit einzelnen Fabeln generelle Schlussfolgerungen zieht. Dies führt jedoch zu sehr groben und großzügigen Verallgemeinerungen, die der Wissenschaftlichkeit seiner Arbeit Abbruch tun.
Verstärkt wird dies von Vosslers allzu deutlich gezeigter Sympathie für den Dichter. Von Anfang an zieht er den Leser auf seine Seite, lässt Widersprüche gar nicht erst aufkommen. Er spricht in seinen Betrachtungen über La Fontaines Meinung, Absicht, seinen Willen und sein Fühlen, zeigt, wie alles nur der Meisterschaft des Dichters zuträglich war, wie es seinem Geist entsprang; dies tut er freilich sehr überzeugend. Vosslers Sprache ist publikumswirksam, überzeugend, aber nicht wissenschaftlich. Ein Beispiel:
"Es ist sprachgeschichtlich nachgewiesen und steht fest, dass all die Freiheiten, Nachlässigkeiten, Inkorrektheiten und sogenannten Fehler, die man in seiner Sprache hat auffinden können, nichts anderes sind als Altertümlichkeiten, Archaismen." (V, 97)
Diesem Satz, der seiner Formulierung nach eine unumstößlichen Gültigkeit zu haben scheint, werden jedoch keinerlei Quellen hinzugefügt, die diese Aussage unterstützen könnten.3 Gleichzeitig liegt eine beinahe trotzige Verteidigung der Meisterschaft La Fontaines darin, in der er sagt: der Dichter hat es so gemeint, alles ist Absicht und macht Sinn. Auch an anderen Stellen findet sich dieser besonders emotionale Stil, der häufig malerische Adjektive gebraucht: die Fabel ist "allzu witzig" (33), "wundervoll" (99), "unendlich reich" (104), ein "Glanzstück" (110) usw. Vossler formuliert also seine Behauptungen, als wären sie Selbstverständlichkeiten. Und wo ihm dies selbst gelegentlich nicht ganz überzeugend erscheint, beruft sich Vossler auf die unterschiedliche Nationalität: "Wir Deutsche freilich stellen uns einen Humoristen anders vor..." (III, 55), "...mit französischer Selbstverständlichkeit." (VI, 137). Vosslers Sprachstil entbehrt übrigens jeglicher Fachausdrücke, was freilich die Verständlichkeit für das Publikum erhöht; sicherlich zu Recht hält Gamillscheg ihn für einen "Meister im Vortrag". Für Sprachwissenschaftler selber bedeutet dies aber womöglich einen Mangel an Kompetenz und Wissenschaftlichkeit.
Der Leser findet hier eine Sprachwissenschaft, die um jeden Preis ästhetisch sein will. Sie ist somit auch wieder einseitig, denn ihr fehlt völlig, was Vossler im Positivismus zu beherrschend ist: das Empirische, die Rationalität, das Naturwissenschaftliche. Sie kann darum nur eine, allerdings sehr gelungene und liebevolle, Hommage an La Fontaine und dessen Werk sein: "La Fontaine ist weder als Denker originell gewesen, noch als Erfinder, noch als Erzieher. Aber Französisch hat er gekonnt." (IV, 86).
Literaturverzeichnis
Baggioni, Daniel: Karl Vossler. In: Stammerjohann, H. (Hrsg.): Lexicon
Grammaticorum - Who’s Who in the History of World Linguistics. Tübingen, 1996.
Cassierer, Ernst: Der Begriff der symbolischen Formen im Aufbau der Geisteswissenschaften. 1956.
<http://www.mauthner-gesellschaft.de/mauthner/cass1.html> (03.02.2001)
Gamillscheg, Ernst: Karl Vossler. In: Sebeok, Thomas A. (Hrsg.): Portraits of
Linguists - A biographical Source Book for the History of Western Linguists, vol.2, 1746-1963. ²1967: 333-342.
Gerstenberg, Annette: Einführung in die französische Sprachwissenschaft - Proseminar. Jena, WS 2000/2001.
Helbig, Gerhard: Geschichte der neueren Sprachwissenschaft. Unter dem besonderen Aspekt der Grammatik-Theorie. ²1973.
J.M.B.: A la découverte de La Fontaine. <http://www.lafontaine.net/> (11.02.2001)
Stein, Achim: Einführung in die französische Sprachwissenschaft. Stuttgart+Weimar, 1998.
Trabant, Jürgen: Fünfzig Jahre nach Vossler: Geist und Kultur in der Sprachwissenschaft.
<http://www.romanistik.de/frames/vossler.html> (30.01.2001)
Vossler, Karl: Positivismus und Idealismus in der Sprachforschung. Heidelberg, 1904.
Vossler, Karl: Sprache als Schöpfung und Entwicklung. Heidelberg, 1905.
Vossler, Karl: La Fontaine und sein Fabelwerk. Heidelberg, 1919.
Vossler, Karl: Geist und Kultur in der Sprache. Heidelberg, 1925.
Karl Vossler (1872-1949)
(oder: Voßler)
1872 * am 6. September geboren in Hohenheim bei Stuttgart
Studium in Tübingen, Straßburg, Genf, Rom
Dissertation über das deutsche Madrigal
1898-1908 Assistent und Privatdozent am Romanistischen Seminar in Heidelberg
1900 Habilitation für romanische Philologie
1903 Ernennung zum außerordentlichen Professor
1904 Positivismus und Idealismus in der Sprachforschung (Heidelberg)
1905 Sprache als Schöpfung und Entwicklung (Heidelberg)
1910 Berufung nach Würzburg, Vorsitz des Bereichs Romanistik
1911 Berufung nach München
1913 Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung (Heidelberg)
- Titel späterer Auflagen:„Frankreichs Kultur und Sprache“
1925 Geist und Kultur in der Sprache (München)
1938 Versetzung in vorzeitigen Ruhestand wegen Verurteilung des
Nationalsozialismus
1943 hohe Auszeichnung durch Universität Madrid
1946 Berufung an die Universität München zum Wiederaufbau der
Romanistik
1949 † am 18.Mai in München gestorben
seit 1983 Verleihung des Karl-Vossler-Preises für wissenschaftliche
Darstellungen von literarischem Rang (Heidelberg)
[...]
1 Im Folgenden beziehen sich alle Verweise auf Vossler, 1919.
2 François de La Rochefaucoult bezeichnet in seinen 1665 veröffentlichten "Maximen" die Eigenliebe als Urtrieb der Menschen (Vossler, 1919, 13).
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments über Vossler und La Fontaine?
Dieses Dokument ist eine umfassende Analyse von Karl Vosslers Buch "La Fontaine und sein Fabelwerk". Es untersucht Vosslers idealistische Sprachtheorie, seine Methode der Sprachbetrachtung anhand von La Fontaines Fabeln und seine Einordnung in die romanistische Sprachwissenschaft.
Welche Themen werden in diesem Dokument behandelt?
Die behandelten Themen umfassen:
- Die Einordnung Vosslers in die romanistische Sprachwissenschaft.
- Vosslers idealistische Theorie der Sprache.
- Vosslers Analyse von La Fontaines Fabeln, einschließlich Struktur, Inhalt und sprachlicher Details.
- Kritik an Vosslers Ansatz und eine Zusammenfassung seiner Bedeutung für die Sprachwissenschaft.
- Ein Anhang mit zusätzlichen Informationen, wie Vosslers Biographie und ein Literaturverzeichnis.
Was ist Vosslers idealistische Sprachtheorie?
Vossler betrachtet Sprache als eine schöpferische Tätigkeit des Geistes, im Gegensatz zur junggrammatikalischen Auffassung von Sprache als Materie, die sich nach festen Lautgesetzen wandelt. Er betont die Rolle des individuellen Geistes, der Kultur und der Psychologie bei der Sprachentwicklung.
Wie analysiert Vossler La Fontaines Fabeln?
Vossler analysiert La Fontaines Fabeln, indem er sie in ihren kulturgeschichtlichen Kontext einbettet und die Eigenarten des Dichters La Fontaine berücksichtigt. Er interpretiert die Texte detailliert, um die Geistestätigkeit des Dichters, seinen Stil und seine sprachlichen Nuancen zu verstehen. Er betont das Wechselspiel von Stilarten, Ironie und Doppelsinn in La Fontaines Werk.
Welche Kritik wird an Vosslers Methode geübt?
Kritisiert wird Vosslers fehlende Objektivität, seine subjektiven Interpretationen und sein Verzicht auf empirische Daten. Es wird auch angemerkt, dass seine Sprachwissenschaft eher eine Hommage an La Fontaine als eine wissenschaftliche Analyse ist.
Was ist der Zweck des Anhangs in diesem Dokument?
Der Anhang enthält zusätzliche Informationen, die Vosslers Analyse ergänzen. Dazu gehören:
- Ergänzende Analysen spezifischer Fabeln und Motive.
- Quellen, die La Fontaine für seine Fabeln verwendete.
- Ein kommentiertes Literaturverzeichnis.
- Eine Biographie Vosslers
Wer war Karl Vossler?
Karl Vossler (1872-1949) war ein bedeutender romanistischer Sprachwissenschaftler, der sich durch seine idealistische Sprachtheorie und seine ästhetische Sprachbetrachtung auszeichnete. Er setzte sich für die Berücksichtigung des Geistes, der Kultur und der Psychologie bei der Analyse von Sprache ein.
Wer war Jean de La Fontaine?
Jean de La Fontaine (1621-1695) war ein berühmter französischer Dichter, der vor allem für seine Fabeln bekannt ist. Seine Fabeln zeichnen sich durch ihren Witz, ihre Ironie und ihre tiefgründigen Einsichten in die menschliche Natur aus.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Textes?
Einige der wichtigsten Schlüsselwörter sind: Vossler, La Fontaine, Fabel, Idealismus, Sprachwissenschaft, Romanistik, Sprachbetrachtung, Geist, Kultur, Stil, Interpretation, Kritik.
- Quote paper
- Ulrike Nitzsche (Author), 2001, Untersuchung der sprachwissenschaftlichen Methode Karl Vosslers anhand seiner Betrachtung der Fabeln Jean de La Fontaines, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105108