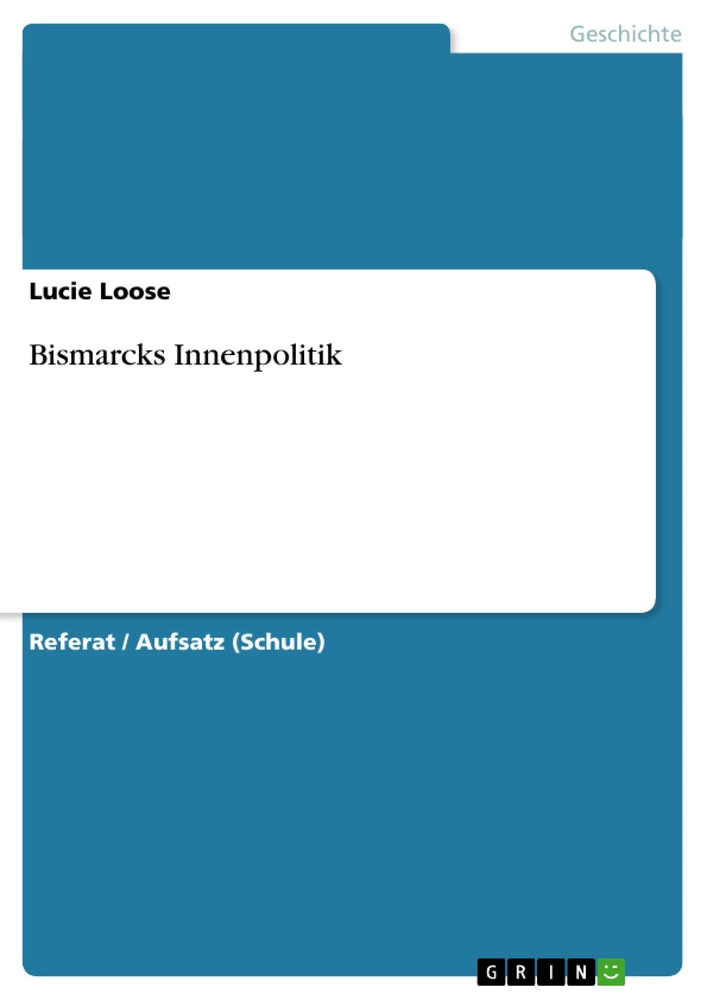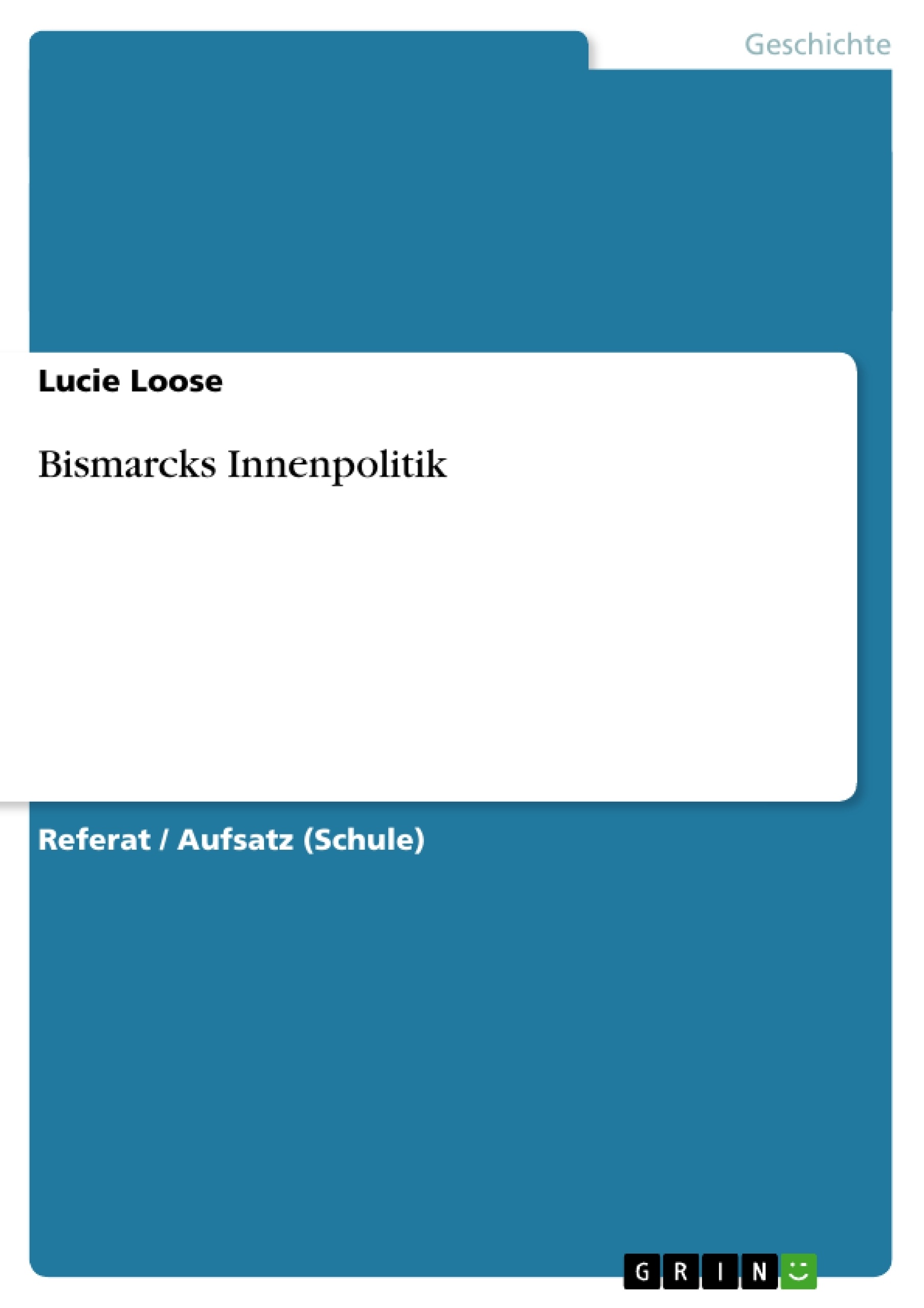Ein Mann, ein Reich, eine Ära: Tauchen Sie ein in die komplexe Welt Otto von Bismarcks und erleben Sie, wie dieser preußische Staatsmann das zerklüftete Deutschland des 19. Jahrhunderts in ein geeintes Kaiserreich verwandelte. Diese fesselnde Analyse beleuchtet Bismarcks Innenpolitik, von seinem taktischen Umgang mit den Parteien – Konservative, Nationalliberale, Zentrum, Fortschrittspartei und Sozialdemokraten – bis hin zur Reichsverfassung von 1871, die das Fundament für das neue Reich legte. Erforschen Sie den Kulturkampf, Bismarcks Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche, und seine überraschende Wendung zur Schutzzollpolitik, die die deutsche Wirtschaft revolutionierte. Entdecken Sie die Hintergründe und Auswirkungen des Sozialistengesetzes, mit dem Bismarck die aufstrebende Arbeiterbewegung unterdrücken wollte, und die Einführung der Sozialgesetzgebung – Kranken-, Unfall- und Altersversicherung –, die bis heute als Meilenstein gilt und das Leben von Millionen Menschen veränderte. Analysieren Sie Bismarcks widerwillige Hinwendung zur Kolonialpolitik, getrieben von wirtschaftlichen Interessen und dem Wunsch, innenpolitische Spannungen abzubauen. Diese umfassende Darstellung zeichnet ein vielschichtiges Bild von Bismarck als Machtpolitiker, der sein Land mit eiserner Hand führte, aber auch als Visionär, der die Grundlagen für den modernen deutschen Sozialstaat schuf. Verstehen Sie, wie Bismarck durch Kriege und Diplomatie, von der Vertreibung Dänemarks bis zur Kaiserproklamation in Versailles, die deutsche Einheit erreichte und Preußens Vormachtstellung sicherte. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für deutsche Geschichte, Politik und die Frage interessieren, wie ein Mann das Schicksal einer Nation prägen kann. Erfahren Sie, wie Bismarcks Vermächtnis bis heute nachwirkt und die deutsche Identität beeinflusst.
Gliederung
1. Innenpolitik
2. Thesenpapier
Otto Fürst von Bismarck
Erarbeiten Sie die innenpolitische Arbeit von Otto Fürst von Bismarck und stellen Sie seine Politik übersichtlich dar!
Innenpolitik:
die inneren politischen Angelegenheiten eines Landes mit Ausnahme der Justiz, des Finanzwesens sowie der Wirtschaft und der Arbeits- und Sozialfragen, so dass sich Innenpolitik in diesem Sinn auf die allgemeine innere Verwaltung und Polizei, unter Umständen auch auf Kulturangelegenheiten und ähnliches beschränkt.
(Jedoch wurde zu einer Früheren Zeit keine Tränung in einzelne Ministerien gemacht, somit kann man die Ausnahmen zur Zeit Bismarcks in die Innenpolitik einbeziehen.)
¨Stellung zu den Parteien:
-war nur auf das Vertrauen des Monarchen angewiesen; nicht auf das der Parteien
-daher spielte er die Parteien taktisch gegeneinander aus; je nachdem wozu er sie brauchte
-ihm waren die Parteien gleichgültig, deshalb hatten sie auch nur geringen Einfluss auf Staatsmacht
-System hatte demokratisches Wahlgesetz <--> volksunabhängige Regierung
-5 größere Parteien: -Konservativen (Großgrundbesitzer/Militär)
-National-Liberale (Großbürgertum/Wirtschaft)
-Zentrum
-Fortschrittspartei (Mittelstand)
-Sozialdemokraten (Arbeiter)
-Verfassung von 1871:
- entstanden am: 16.April 1871
- Aufbau: siehe Arbeitsblatt
- Deutsches Reich in Bundesstaaten geteilt
- einzelne Institutionen: siehe Arbeitsblatt
→Der Kulturkampf:
- Unfehlbarkeit des Papstes / seiner Lehren sollte durchgesetzt werden von der Kirche aus
- wurde nicht von allen anerkannt
- daher Spaltung der Katholiken
- Bismarck nutzte das aus >Gesetze, die Kirche aus dem öffentlichen Leben verdrängen, entstanden
- 1876: Festnahme von Bischöfen
- preuß. Bevölkerung hielt fest zur Kirche >Bismarck gab nach
- Gesetze beschränkt auf: Zivilehe erlaubt, staatliche Schulaufsicht, staatliche Bestrafungen, Jesuitenorden verboten
- Germanisierung; vor allem in Polen
- Die Schutzzollpolitik:
- Wende in der Wirtschaftspolitik „Neomerkantilismus“, „Schutzzollpolitik", "Protektionismus"
- 1873 forderte vor allem die Schwerindustrie eine wirksame staatliche Schutzzollpolitik
- andere Bereiche schlossen sich an: Landwirtschaft wegen Getreideimporte aus den USA und Russland und auch weite Kreise der Öffentlichkeit
- Ursachen: -Weltwirtschaftskrise
-Beendigung der Reparationszahlungen Frankreichs 1873
-industrieller Aufholbedarf in Deutschland
-schwacher Binnenmarkt, vom Export abhängig
-heimische Produkte durch Billigimporte gefährdet
=> Der Ruf nach wirksamer staatlicher Schutzzollpolitik wurde sowohl von Industrie als auch Landwirtschaft gefordert; auch Teile der Gesellschaft unterstützte diese Forderung, da sie von Arbeitslosigkeit bedroht bzw. betroffen war.
- Maßnahmen: -1875 Ankündigung Schutzzölle für die Landwirtschaft und die Industrie
-1877 wurden ausländische Eisenerzeugnisse mit Zöllen belegt
-1879 Schutzzollgesetz auf ausländisches Roheisen
-Einfuhrzölle auf Getreide und Vieh, Holz
-Gründung von Kartellen und kartellähnlichen Zusammenschlüssen zur Regulierung von Preisen
-Produktionszahlen und Absatzgebieten
-keine Gehaltserhöhungen
-Gründung von Verbänden mit eigenen Interessen gegenüber der Regierung
- Folgen/Auswirkungen:
- Das Sozialistengesetz:
-förderte wirtschaftliche Entwicklung, Preiserhöhung
-Einfuhrzölle auf Getreide und Vieh verteuerten die Lebenshaltungskosten erheblich
-Schutzzollpolitik begünstigte zwar die einheimische Industrie und Landwirtschaft
-Verschlechterung des Exports deutscher Waren im Maschinenbau, Elektro- und chemische Industrie
-Bundesländer hatten genug Geld, so dass sich deren Haushalt entspannte
-Reich hatte mehr Geld für Heeresreform, Sozialpolitik
-Zölle auf Eisen = teure Landwirtschaftliche Maschinen
-Lebenshaltungskosten erhöhten sich (Zölle auf Lebensmittel)
-steigende Arbeitslosigkeit >Armut stieg
-Unzufriedenheit in der Bevölkerung (Niederlage bei Reichtagswahl für Bismarck)
-günstige Transporttarife für Ausfuhrgüter, Steuervorteile, Subventionen und handelspolitische Hilfen wurden gewährte um die internationale Wirtschaft international konkurrenzfähig zu halten
- Definition: -vom 21.10.1878 bis 30.09.1890 geltendes Ausnahmegesetz zur Unterdrückung der sozialistischen Arbeiterbewegung
- Ursachen: -Zulauf zum Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein und zur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands seit der Wirtschaftskrise 1873
-Vereinigung des Arbeitervereins und der Partei zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) im Jahre 1875
-deutlich steigende Wahlerfolge bei den Reichstagswahlen 1874 und 1877
- Vorwand für das Vorgehen Bismarcks: -zwei Attentate auf Kaiser Wilhelm I. (1878) angeblichen Zusammenhang zwischen den Attentaten und der sozialdemokratischen Partei
- von Bismarck verlangtes erstes Ausnahmegesetz wurde nicht akzeptiert
- Auflösung des Reichstages durch Bismarck >Neuwahlen >Stimmzuwachs für die Konservativen auf Kosten der Liberalen
- das ,,Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie" (Sozialistengesetz) wurde vom 1878 neugewählten Reichstag angenommen
- Ziel: -Zerschlagung der Parteiorganisation und der Gewerkschaften
-Versuch Sozialdemokraten von pol. Macht fernzuhalten
-Inhalte: -nicht Verbot der Partei an sich, sondern der Untergruppen auf sozialistischer Ebene
-Auflösung aller Parteiorganisationen und der ihnen nahestehenden Gewerkschaften, nicht jedoch der Partei selbst
-Verbot aller „sozialdemokratischen, sozialistischen, kommunistischen “Versammlungen, Vereinigungen, Gewerkschaften > Brandmarkung als Reichsfeinde
-Verbot der Parteipresse
-Ausweisung / Verhaftung der Sozialdemokraten
-durften aber wählen und für Reichstag gewählt werden
- Folge: -trotz Verboten, Verhaftungen, Verurteilungen und Ausweisungen keine Chance zur Zerstörung der Partei und der Gewerkschaften
-es bildeten sich Tarnorganisationen wie Gesangs-, Turn- oder Gesellschaftsvereine
-Solidarität der Arbeiter führte zum Anwachsen der Partei
-Druckschriften wurden nach Deutschland eingeschleust
-äußerer Druck > enger zusammenrücken
-Empörung über die Unterdrückung
- 1890: Aufhebung der Gesetze wegen ständiger Unruhen
- Gesetz gegen d. gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, vom 21.10.1878 (Auszug)
§ 1 Vereine, welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats oder Gesellschaftsordnung bezwecken, sind zu verbieten.
§ 9 Versammlungen, in denen sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische, auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen zutage treten, sind aufzulösen.
Versammlungen (auch öffentliche Festlichkeiten), von denen durch Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass sie zur Förderung der im ersten Absatz bezeichneten Bestrebungen bestimmt sind, sind zu verbieten.
§ 11 Druckschriften, in welchen sozialdemokratische, sozialistische o. kommunistische [...] Bestrebungen in [...] zutage treten, sind zu verbieten.
§ 17 Wer an einem verbotenen Verein als Mitglied sich beteiligt, oder eine Tätigkeit im Interesse eines solchen Vereins ausübt, wird mit Geldstrafe bis zu 500 Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft... Gegen diejenigen, welche sich an dem Verein oder an der Versammlung als Vorsteher, Leiter, Ordner, Agenten, Redner oder Kassierer beteiligen, oder welche zu der Versammlung auffordern, ist auf Gefängnis von einem Monat bis zu einem Jahre zu erkennen.
±Die Sozialgesetzgebung
Die Sozialversicherungen
- Ursachen: -Bevölkerungsexplosion aufgrund der Industrialisierung
-Verstädterung
-viele Arbeiter, Besitzlose demgegenüber gesellschaftliche Elite: Adel, Militär, Unternehmer, diese Konstellation barg Zündstoff ·
-keine soziale Absicherung ·
-wöchentliche Arbeitszeit ca. 60 Std. ·
-konstruktive staatliche Maßnahmen: soziale Lage der Arbeiterschaft verbessern
-Beginn der Planung zeitgleich zu den Sozialistengesetzen, das erste Gesetz passierte den Reichstag 1883 ·
-,,kaiserliche Botschaft" war als Forderung nach Sozialgesetzen voraus gegangen
-Anstieg der Armut und sich ständig verschlechternde Lebensbedingungen
-schwere Rezessionsphase vor allem in Großindustrie (Metall, Bergbau)
-Schutzzollgesetze brachten keine Verbesserung der Lage der Arbeiter
-Arbeiter bildete Klassenbewußtsein
-Herausbildung und Erstarken von Parteien (Sozialdemokraten) und Gewerkschaften
-“Hilfe von oben“ >Bindung Arbeiter an den Staat
- Vorbild: Sozialversicherungssystem von Napoleon der III
- Beiträge richten sich nach der Höhe des Einkommens aber Leistungen sind vom Bedarf abhängig
- Berater: - Theodor Lohmann (Handelsministerium) >Gesetzesvorlage für Unfallversicherung
- Generaldirektor des Vereins für Bergbau und Gußstahlfabrikation Louis Baare seitens der Unternehmer
der Arbeiter, der keine hohe Rente in Aussicht habe, vorsichtiger bei der Arbeit sein werde und sich die Rente oder die Unterstützung für seine Hinterbliebenden nicht fahrlässig oder absichtlich erwerbe, indem er, lebensmüde geworden, vielleicht freiwillig in den Tod gehe, wenn er seine Familie versorgt wisse
- Folgen: -soziale Sicherheit der Arbeitnehmer stieg erheblich, da sie im Krankheitsfall und im Alter einen Rechtsanspruch auf finanzielle Leistungen besaßen ·
- deutsche Sozialgesetzgebung im internationalen Vergleich auf lange Zeit konkurrenzlos, Vorbild für die Welt ·
- Durchsetzung -alle Sozialgesetze wurden erst nach mehreren Änderungen von den Parteien im Reichstag gebilligt
-geplante Steuerreform (direkte durch indirekte Steuern ersetzt werden)
-z. Bsp. eine Tabak-, Bräu- und Luxussteuer >Steuerreform scheiterte
- Grundlage Haftpflichtgesetz von 1871 und Hilfskassengesetz von 1876
- Haftpflichtgesetz: -Arbeitern, die durch einen Unfall im Betrieb verletzt worden waren, wird eine Entschädigung für Heilkosten und Lohnverlust vom Unternehmer gezahlt nur wenn die Schuld am jeweiligen Unfall nachgewiesen werden kann
-endlosen Zahl von Prozessen was zu einer Verhärtung der Gegensätze zwischen Arbeitern und Unternehmern führte
-beide Seiten an einer neuen Regelung interessiert
- Hilfskassengesetz: sollte das damalig überkommende Kassensystem reglementiert werden.
Krankenversicherung (1883)
- Pflichtversicherung
- Leistungen und Zahlungen neu festgelegt
- zahlten vom 3. Krankheitstage an in den ersten 13 Krankheitswochen (später 26) eine Beihilfe an den arbeitsunfähigen Arbeitnehmer
- Finanzierung: ärztliche Behandlung, Krankengeld, Medikament, Krankenpflege, bei Todesfall Beihilfe für Hinterbliebene
- für leichte Unfälle sollte Krankenunterstützung gewährt werden
- Arbeitgeber hatte ein Drittel und der Arbeiter zwei Drittel der Beiträge zu zahlen
- verschiedene Kassen gegründet: -Gemeindekassen von Verwaltungsbehörden
-Fabrikkassen von Unternehmern
-Knappschaftskassen nur für Bergleute
-freie Kassen von Gewerkschaften (von diesen Gesetz aber stark benachteiligt >von den Behörden kontrolliert wurden
>um den Einfluss der Gewerkschaften auf die Kassen so gering wie möglich zu halten
Unfallversicherung (1884)
-lösten Haftpflichtgesetze auf
-Schutz bei Arbeits- und Wegunfällen
-Arbeitgeber verpflichtet für Arbeitnehmer Versicherung abzuschließen
-Arbeiter brauchten nichts einzuzahlen
-Berufsgenossenschaften der Arbeitnehmer übernahmen Zahlungen bei Unfall eines Arbeiters
-trat nach Ablauf der Krankenversicherung ein, also nach Ablauf der 13. Woche der Arbeitsunfähigkeit
-Arzt- und Heilmittelkosten ab der 14. Woche von der Unfallversicherung übernommen ·
-bei dauernder Invalidität als Folge eines Unfalls erhielt der Arbeitnehmer zwei Drittel seines Lohns, bei Tod Hinterbliebenenrente in Höhe von 60 Prozent des Monatslohnes
-keine Unterschiede zwischen verschuldeten und unverschuldeten Unfällen
-ausgeschlossen von der Versicherung waren Land-, Forst- und Bauarbeiter, Beschäftigte im Kleingewerbe, in der See- und Flussschifffahrt und Eisenbahner
Alters- und Invaliditätsversicherung (1889)
-alle Arbeitnehmer dazu verpflichtet (außer Beamte)
-regelten Beihilfe für Hinterbliebene
-Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Staat zahlten zu gleichen Anteilen
-funktionierte nicht nach dem Solidarprinzip (Leistungen sind beitragsunabhängig) sondern nach dem Versicherungsprinzip (je höher die Beiträge desto höher die Leistungen)
-sicherte jedem Arbeiter, der weniger als 2000 Mark im Jahr verdient hatte eine Altersrente nach dem 70. Lebensjahr zu, sowie eine Invaliditätsrente bei Arbeitsunfähigkeit ·
-gelten für alle industriellen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Arbeiter sowie für Lehrlinge, Dienstboten und Betriebsbeamte
-jedoch durchschnittliche Lebenserwartung damals bei 34 und 37 Jahren (Männer, Frauen) lag >Rente ab 70 >es musste auch 30 Jahre lang eingezahlt werden.
-Invalidenrente hingegen konnte schon nach 5 Jahren Zahlung beantragt werden
Meinungen zu den Sozialversicherungsgesetze
-Sozialdemokraten: -es gab umfangreiche Veränderungen ohne die Mitwirkung der Sozialdemokraten, sogar gegen ihre Stimmen im Reichstag
-Reformen als völlig unzureichend bewertet
-Bismarck: wollte Volk an den Staat binden und weg von den Sozialdemokraten holen
-Bürger: -SG nicht genügend, wollten mehr Gleichberechtigung
-weiterer Zulauf zu den Sozialdemokraten
-andere Parteien: -SG = Kirchenaufgabe
-jeder sollte sich selber für die Not versorgen
-durch Zwangsversicherung wird die Freiheit eingeschränkt
-finazielle Beteiligung des Staates wurde abgelehnt
²Kolonialpolitik
-legte Schwerpunkt seiner Politik auf die Erhaltung des "Status quo" in Europa
-wollte nicht die Nachbarstaaten durch Erwerb von Kolonien reizen und dadurch möglicherweise einen Krieg auslösen
-befürchtete Probleme mit England, die eine expansive Kolonialpolitik Deutschland als unfreundlichen Akt werten könnten
-1871 Franzosen wollten ihren Kolonialbesitz in Cochinchina an das Deutsche Reich abtreten,
-Bismarck lehnte ab
-hohen Kosten einer Kolonie >mussten geschützt werden >Flotte war nötig >Beamte für Verwaltung nötig
-1881 erklärte Bismarck: "So lange ich Reichskanzler bin, treiben wird keine Kolonialpolitik. Wir haben eine Flotte, die nicht fahren kann... und wir dürfen keine verwundbaren Punkte in fernen Weltteilen haben, die den Franzosen als Beute zufallen, sobald es losgeht"
-er lenkte dann doch ein
-Gründe: - "Export der sozialen Frage“
-Auswanderungsmöglichkeiten für die Deutschen
-Bismarck wollte Interesse der Bevölkerung nach außen ablenken, um innenpolitische Probleme zu verschleiern und die Gefahr einer Revolution zu verringern
-Sorge um den Außenhandel (Kolonialmächte (besonders Frankreich, England und Spanien) errichteten ihre Einflussbereiche und beschränkten damit den freien Handel)
-Konjunktur könnte durch neue Rohstoffquellen und Absatzmärkte belebt werden
-man wollte "Handels-, Bergbau- und Plantagenkolonien" gründen und den Handel intensivieren.
-Bekämpfung von Depressionen in der Wirtschaft
große Zollschutzzonen um
- Auswertung Bismarcks Innenpolitik:
Otto Fürst von Bismarck hatte es geschafft das in kleine Teilstaaten und Fürstentümer zerlegte Deutschland zu vereinigen und sie zu stabilisieren.
Darum bemühte er sich von seiner ersten Amtshandlung (1862) bis er die Gründung des Deutschen Reiches unter der Vorherrschaft Preußens erreicht hatte. In einem gut durchdachten Plan gelang ihm die Vereinigung schrittweise
-Vertreibung Dänemarks aus deutschen Gebieten um weitere Aufspaltung zu verhindern mit Österreichs Hilfe
-wirtschaftliche Verdrängung Österreichs aus deutschen Gebieten
-1866 Krieg gegen Österreich >endgültige Verdrängung
-Vormachtstellung Preußens im neu-gegründeten Norddeutschen Bund
-zur Verbündung süddeutsch mit norddeutsch = Appelle an Nationalbewusstsein / -stolz der Deutschen
-1870/71 Krieg gegen Frankreich (Emser Depesche) >Sieg >Kaiserproklamation Wilhelm des I. in Versailles
-Kriegsentschädigung von Frankreich brachte viel Geld in den dt. Haushalt (5Milliarden RM) neue Banken, Aktiengesellschaften entwickelten sich
Zu diesen Zeitpunkt war er Reichskanzler; er musste nur auf den König hören, brauchte das Parlament nicht zum Regieren und hatte ein Vetorecht gegen alles.
Durch geschickte Politik und unter Ausnutzung der Fehler seiner innen- und außenpolitischen Gegner, gelang es ihm seine Macht und seinen Einfluss zu vergrößern, auch wenn sein Ansehen immer weiter sank, denn es gab viele innenpolitischer Misserfolge (Steuerreform). Doch es kam Bismarck nicht auf sein Ansehen im Volk an, er genoss vollstes Vertrauen des Königs und hatte somit sehr viel Macht im Staat. Das war für ihn das wichtigste. Um diese, die Stellung Preußens in Deutschland und in der Welt mit Deutschland, die innere Stabilität und die Wirtschaft zu halten setzte er viele Gesetze und Reformen durch.
Sein Kulturkampf scheiterte zwar letztendlich, aber trotzdem konnte man an ihm erkennen, wie Bismarck die innere Sicherheit sichern wollte, durch die Verstaatlichung der Kirche und die Germanisierung in Polen.
In diesem Zusammenhang sind aber auch viele heute bestehenden Veränderungen getroffen worden :
die Aufhebung der katholischen Abteilung im preußischen Kultusministerium
die staatliche Übernahme der Schulaufsicht von der Kirche der Kirchenaustritt
die Zivilehe
die Staatsaufsicht über die Vermögensverwaltung der kirchlichen Gemeinden
Auch seine Sozialistengesetze waren nicht geschaffen, weil die Sozialisten das Deutsche Reich gefährden, sondern weil sie ständig mehr Anhänger bekamen und dadurch Bismarcks Macht bedrohten, so musste er auch hier schließlich nachgeben.
Deshalb versuchte er die Arbeiter durch die Sozialgesetze wieder an den Staat zu binden, was ihm auch nicht gelang, da diese Gesetze den Bürgern noch nicht reichten.
Egal aus welchen Gründen Bismarck die Sozialgesetze erlassen hat, sie haben noch heute Bestand. Er war der Politiker überhaupt in der Welt, der den Arbeitern soziale Sicherungen gab.
die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer stieg erheblich
was ein erster Schritt hin zur Sozialpartnerschaft war
Bismarckscher Ansatz zur heutigen Struktur der Sozialversicherungen
Es gelang ihm die soziale Not zu lindern und 1883 einen Grundsatz zu einer umfassenden Absicherung der Arbeiterschaft auszubauen, indem er in diesem Jahr das Krankenversicherungsgesetz erließ, dann 1884 kam eine Unfallversicherung dazu und letztendlich 1889 trat eine gesetzliche Altersversorgung in Kraft, deren Kosten zum Teil vom Staat aufgebracht wurden Man merkt an seinen Handlungen, dass es ihm sehr schwer fällt, den Bürgern mehr Rechte zu geben und in seiner konservativen Haltung nachzugeben, was nicht unbedingt notwendig war, um die Bürger zu beruhigen und an sich zu binden wurde nicht getan, z. Bsp. hat er durch seine Vetorecht bis zum Ende seiner Amtszeit ein Verbot der Sonntags-, Frauen-, und Kinderarbeit in Fabriken verhindert.
Aber nicht nur auf sozialem Gebiet, sondern auch auf wirtschaftlichem versuchte er das dt. Reich zur Blüte zu verhelfen. Da Deutschland und die Welt in einer Krise steckten, entwickelte er einen neuen Wirtschaftsplan für Deutschland „Neomerkantilismus“, in dem er gesetzlich Preise und Zölle festlegte und Subventionen auf verschiedene Güter legte, damit die dt. Wirtschaft im internationalen Vergleich mithalten konnte.
Diese Zölle brachten dem Staat mehr Geld für bevorstehende Heeresreformen und die Sozialgesetze.
Doch gingen die Zölle auf Kosten der einzelnen Bürger, die Preise stiegen aber die Löhne nicht, es entstand eine neue Armut in Deutschland, und auch die Arbeitslosigkeit stieg.
Schließlich musste Bismarck dann auch zurücktreten, weil seine antidemokratische und seine Sichtweise gegen das Volk zu konservativ für den neuen König waren.
Auch wenn die Wege und Gründe für verschiedene Reformen / Gesetze; z. Bsp. hat er den amtierenden Handelsminister durch Intrigen zum Rücktritt bewogen, und übernahm im Jahr 1880 zusätzlich die Führung über das Handelsministerium, welches für die Sozialpolitik zuständig war, um dadurch die Vorbereitungsarbeiten für die Versicherungsgesetze direkt zu kontrollieren, nicht richtig waren, so waren die Ergebnisse doch ein großer Schritt in Richtung Sozialstaat, wie wir ihn heute kennen und die Einigung darf man auch nicht vergessen.
SEIN WEG:
1. 1864 Krieg gegen Dänemark; Vertreibung Dänemarks aus deutschen Gebieten
2. 1866 Krieg gegen Österreich; Isolation Österreichs dem Deutschen Bund
3. 1866 Vormachtsstellung Preußens im Norddeutschen Bund
4. Verbindung mit Süddeutschem Bund; wecken des Nationalgefühls
5. 1870 Krieg gegen Frankreich; Kriegsentschädigung musste Frankreich zahlen
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Gliederung"?
Der Text behandelt die Innenpolitik Otto Fürst von Bismarcks.
Welche innenpolitischen Aspekte werden in dem Text behandelt?
Der Text behandelt Bismarcks Stellung zu den Parteien, die Verfassung von 1871, den Kulturkampf, die Schutzzollpolitik, das Sozialistengesetz und die Sozialgesetzgebung.
Wie war Bismarcks Verhältnis zu den politischen Parteien?
Bismarck war hauptsächlich auf das Vertrauen des Monarchen angewiesen und spielte die Parteien taktisch gegeneinander aus. Er maß ihnen keine große Bedeutung bei.
Was war der Kulturkampf?
Der Kulturkampf war ein Konflikt zwischen dem Staat und der katholischen Kirche, der durch die Unfehlbarkeit des Papstes ausgelöst wurde. Bismarck nutzte die Spaltung der Katholiken aus und erließ Gesetze, um die Kirche aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Der Kulturkampf wurde letztendlich beendet und die Gesetze wurden entschärft.
Was war die Schutzzollpolitik?
Die Schutzzollpolitik war eine Wende in der Wirtschaftspolitik hin zu "Neomerkantilismus". Es wurden Zölle auf ausländische Waren erhoben, um die heimische Industrie und Landwirtschaft zu schützen. Dies führte zu Preiserhöhungen und Unzufriedenheit in der Bevölkerung, hatte aber auch positive Auswirkungen auf die Wirtschaft.
Was war das Sozialistengesetz?
Das Sozialistengesetz war ein Ausnahmegesetz zur Unterdrückung der sozialistischen Arbeiterbewegung. Es verbot sozialdemokratische Versammlungen, Vereinigungen und die Parteipresse. Trotz Verboten und Verhaftungen konnte die Partei nicht zerstört werden und wuchs weiter. Das Gesetz wurde 1890 aufgehoben.
Was war die Sozialgesetzgebung?
Die Sozialgesetzgebung umfasste die Krankenversicherung (1883), die Unfallversicherung (1884) und die Alters- und Invaliditätsversicherung (1889). Diese Gesetze sollten die soziale Lage der Arbeiterschaft verbessern und sie an den Staat binden. Sie waren im internationalen Vergleich lange Zeit konkurrenzlos und ein Vorbild für die Welt.
Wie funktionierte die Krankenversicherung (1883)?
Die Krankenversicherung war eine Pflichtversicherung, die ab dem 3. Krankheitstag eine Beihilfe an den arbeitsunfähigen Arbeitnehmer zahlte. Die Finanzierung erfolgte durch Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Wie funktionierte die Unfallversicherung (1884)?
Die Unfallversicherung löste die Haftpflichtgesetze auf und schützte bei Arbeits- und Wegunfällen. Arbeitgeber waren verpflichtet, für ihre Arbeitnehmer eine Versicherung abzuschließen. Die Zahlungen wurden von Berufsgenossenschaften übernommen.
Wie funktionierte die Alters- und Invaliditätsversicherung (1889)?
Die Alters- und Invaliditätsversicherung war für alle Arbeitnehmer (außer Beamte) verpflichtend. Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Staat zahlten zu gleichen Anteilen. Sie sicherte jedem Arbeiter eine Altersrente nach dem 70. Lebensjahr und eine Invaliditätsrente bei Arbeitsunfähigkeit zu.
Was waren die Meinungen zu den Sozialversicherungsgesetzen?
Die Sozialdemokraten bewerteten die Reformen als unzureichend. Bismarck wollte das Volk an den Staat binden und von den Sozialdemokraten holen. Bürger forderten mehr Gleichberechtigung. Andere Parteien sahen die SG als Kirchenaufgabe und lehnten eine finanzielle Beteiligung des Staates ab.
Was war Bismarcks Kolonialpolitik?
Bismarck legte den Schwerpunkt seiner Politik auf die Erhaltung des "Status quo" in Europa und wollte die Nachbarstaaten nicht durch Kolonialerwerb reizen. Er befürchtete Probleme mit England. Später lenkte er jedoch ein und befürwortete Kolonien aus wirtschaftlichen Gründen und zur Ablenkung von innenpolitischen Problemen.
Wie bewertet der Text Bismarcks Innenpolitik insgesamt?
Der Text bewertet Bismarcks Innenpolitik als ambivalent. Einerseits schaffte er es, Deutschland zu vereinigen und zu stabilisieren und legte mit der Sozialgesetzgebung den Grundstein für den modernen Sozialstaat. Andererseits scheiterte er mit dem Kulturkampf und den Sozialistengesetzen und seine Politik war oft von antidemokratischen Zügen geprägt.
- Citation du texte
- Lucie Loose (Auteur), 2001, Bismarcks Innenpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105096