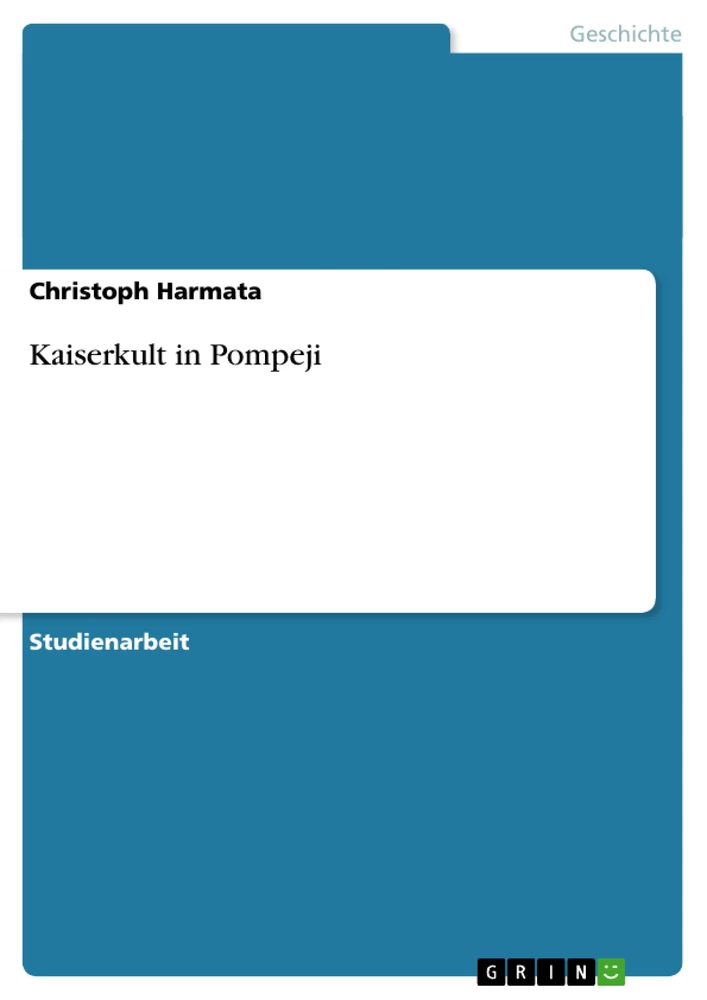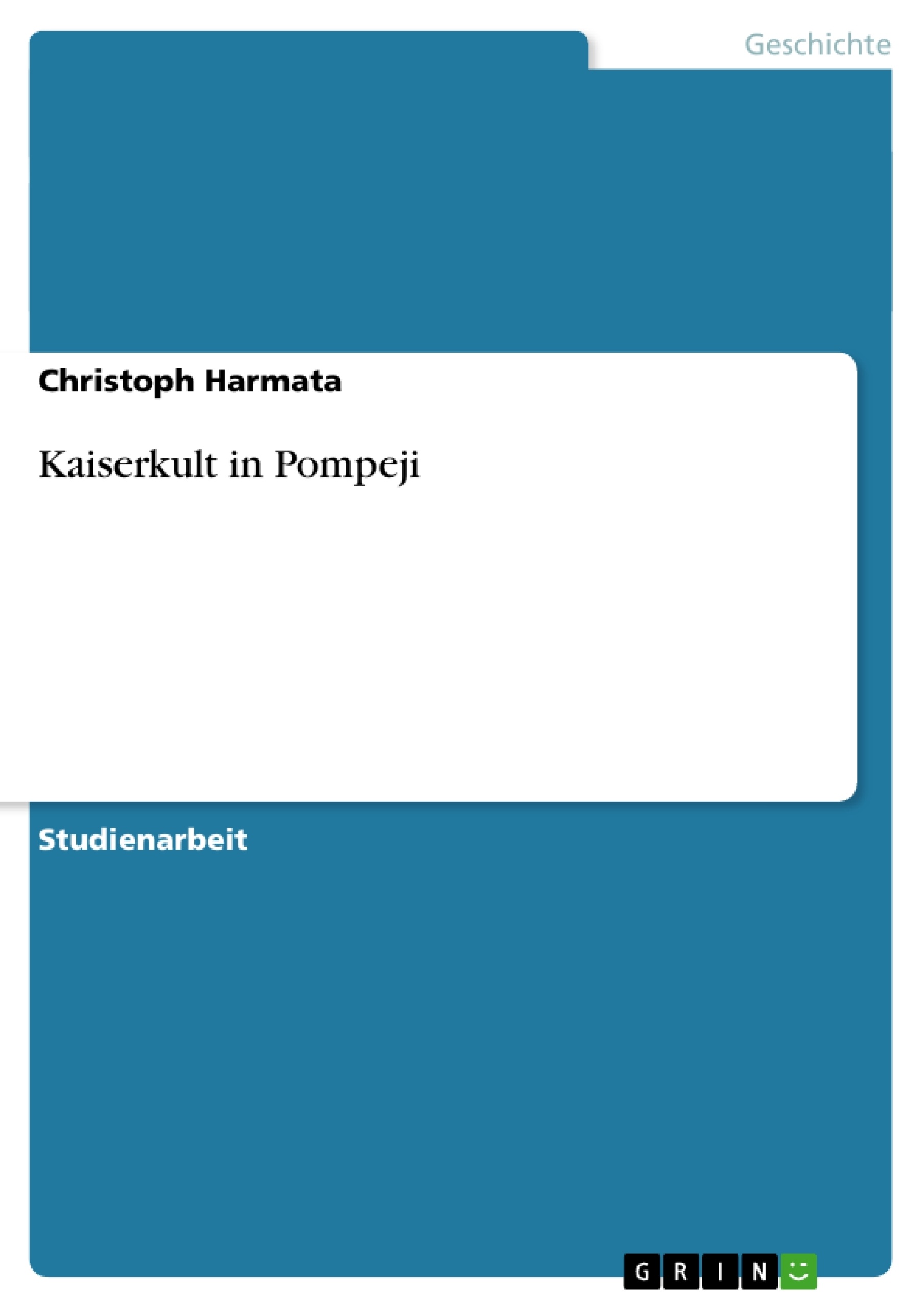1. Einleitung
Diese Arbeit befaßt sich mit der Frage nach der Funktion des Kaiserkults im römischen Reich, und es wird schließlich anhand überlieferter pompejanischer Inschriften überprüft, in wieweit der Kaiserkult in seiner Funktion in Pompeji in Erscheinung tritt. Zu diesem Zweck wird zuerst das Phänomen des Herrscherkultes im griechisch - hellenistischen Raum behandelt. Im Folgenden konzentriert sich die Arbeit auf die Formen des Herrscherkultes in der römischen Republik und im Kaiserreich.
Letztlich wird versucht, für die Funktion des Kaiserkults eine allgemeingültige Definition zu finden und diese auf die Stadt Pompeji anzuwenden.
Der römische Kaiserkult, an dessen Anfang Julius Caesar als Initiator und Augustus als Begründer stehen, war erst das Ergebnis einer Entwicklung der diversen Wohltäter - und Herrscherkulte im griechisch - hellenistischen Raum. Es werden in dieser Arbeit einige bedeutsame Personen und Ereignisse behandelt , welche die Frage nach der Entstehung und der Funktion des Kaiserkults beantworten. Dabei soll zwar aufgrund der Komplexität dieses Themas eine tiefgreifende Behandlung vermieden, dennoch aber eine möglichst umfangreiche Darstellung zielführender Fakten versucht werden. Eine Vielzahl inschriftlicher Quellen aus dem griechisch-hellenistischen Raum zeigt diverse Fälle des Personenkultes, liefert dafür Gründe und trägt überhaupt erst zum Verständnis des Herrscherkults bei.
2. Welche Funktion hat der römische Kaiserkult und findet man den Kaiserkult in seiner Funktion in Pompeji wieder?
2.1. Die Entstehung des Kaiserkults
2.1.1. Der Herrscherkult in Griechenland
Bei der Betrachtung der Anfänge des hellenistischen Herrscherkults schlägt Charlesworth vor, den Begriff „Wohltäterkult“1 zu gebrauchen, denn der Herrscherkult ist nur ein Teil eines größeren Ganzen, der erst mit dem Hegemoniestreben Alexanders des Großen und der Diadochen begann, und sich zunächst einmal über Jahrhunderte entwickeln mußte.
Die Odyssee Homers aus dem 8. Jahrhundert v. Chr. liefert bereits das erste Beispiel für eine göttliche Verehrung eines lebenden Menschen2: „Nausikaa, qugater megalhtoroj Alkinooio, outw nun Zeuj qeih, erigdoupoj posij Hrhj, oikade t/ elqemenai kai vostimou hmar idesqai: twi ken toi kai keiqi qewi wj eucetowimhn aiei hmata panta: su yap m/ ebiwsao, kourh:“ Odysseus verspricht hier „Nausika wie eine Göttin zu verehren, wenn er heil heimkehre, weil sie ihm das Leben gerettet und das Überleben gesichert habe“. Wenn Homer diese Art des Dankes schon in jener Zeit so deutlich ausdrücken konnte, darf man annehmen, daß der Wortlaut bei die Griechen keine Entrüstung aufgrund eines möglichen sittlichen Verfalls bewirkt habe, wo doch ein solcher Dank normalerweise den Göttern gebührt, sondern es läßt sich eher daraus schließen, daß der Grieche es als üblich empfand, auf eine Wohltat mit Verehrung des Wohltäters zu reagieren.3 Je mißlicher seine Situation und je größer die Wohltat, nämlich Rettung wie Sicherung des Wohlergehens und des Guts war, desto heftiger fiel der Akt des Dankes in Form der göttlichen Verehrung aus. Die Quelle enthält die zwei Elemente, welche die Struktur des Wohltäterkults bilden:
a) Nausika ist Wohltäter (Euergethj) und Retter (swthr) für Odysseus;
b) Odysseus erweist ihr Dank, indem er seinem swthr göttergleiche Ehren zukommen läßt. Für die Griechen war die göttliche Verehrung ihrer Wohltäter in heiligen Bezirken, an Altären mit Opfergaben etwas Geläufiges, womit sie Dankbarkeit für die euergesiai zeigten.
„Lysander war der erste Grieche, dem die Städte Altäre errichteten und Opfer darbrachten wie einem Gott, der erste auch , auf den religiöse Lieder gesungen wurden. Der Anfang von einem davon lautet nach der Überlieferung folgendermaßen:„Den Feldherrn des heiligen Hellas, der aus dem weiträumigen Sparta kam, wollen wir feierlich besingen. Oh! Io! Paian“ Die Samier faßten auch den Beschluß, ihr der Göttin Hera gewidmetes Hauptfest in „Lysanderfest“ umzubenennen.“4 Dieses zweite Beispiel zeigt die starke Motivation der Griechen auf Samos, ihrem Wohltäter höchste Ehren zu erweisen, weil Lysander, ein spartanischer Feldherr in der Endphase des Peloponnesischen Krieges 404 v.Chr. u.a. eben Samos im Zuge der Liquidierung des Attisch-Delischen Seebundes von der Hegemonie Athens befreite und die vertriebene herrschende Oberschicht zurückholte. Die Stiftung des Kultes durch die aus dem Exil zurückgekehrten Menschen war ein Ausdruck des Dankes für die erfahrene Rettung und Hilfe.
Obwohl das Vorkommen vergleichbarer Ehrungen anderswo nicht auszuschließen ist, konnten sie bisher nicht nachgewiesen werden. Sicherheit besteht darüber, daß es jedoch keine ganz Griechenland umfassende Verehrung des Lysander gegeben hat 5. Diese freiwilligen und individuellen Ehrenbeschlüsse besaßen meistens eine lokal begrenzte Reichweite, und richteten sich oft an politische und militärische Größen, weil nur diese die nötigen Machtmittel zur wirksamen Hilfe in einer griechischen Stadt oder auf einer Insel hatten.
Es kommt die Frage auf, welche Überzeugung die Griechen dazu bewog, verdienten Menschen die gleichen Ehren wie den Göttern zu erweisen. Der Sinn der göttlichen Ehren gegenüber Menschen lag wohl darin, daß es bei ihnen die Vorstellung gab, diese Personen verdienten die Ehren, weil sie die spezifisch göttliche Funktion des Rettens und Helfens ausübten, was sie schließlich mit den Göttern verband.6
Dieser swthr-und-euergethj-Kult war bereits voll entwickelt, als die Römer um 200 v. Chr. anfingen, im Osten des Mittelmeerraumes politisch tätig zu werden. Zwangsläufig wurden sie mit dieser Art der Dankerstattung konfrontiert, da sie sich als Verbündete der Griechen, gegen ihre Feinde z.B. gegen den König Antiochos militärisch vorgehend, bei vielen poleij des höchsten Dankes verdient gemacht hatten. Seit dieser Zeit galten die Kulte immer häufiger Imperienträgern der Römischen Republik, nämlich als Vertretern der aufsteigenden neuen Großmacht. „Die Bewohner Griechenlands und Kleinasiens reagierten also in gewohnter Weise: Sie übertrugen den variablen Herrscherkult, ..., auf die Römer.“ 7
Im Rahmen des swthr-und-euergethj-Kultes wurde dem Prokonsul Titus Quinctius Flaminius, als erstem römischen Gottmenschen, ein ständiger Kult mit Festtag, Opfer Priester und Paian von der griechischen polij Chalkis gestiftet aus einem besonderen Anlaß zur Dankbarkeit, denn er befreite 191 v. Chr. die poleij Griechenlands von der Herrschaft Philipps V..
„Wir ehren fromm die Treue (pistin) der Römer, Gebete und Eide mögen sie schützen. Singet, ihr Mädchen, dem großen Zeus, preist Rom und Titus und die Treue der Römer: Heil dir, Paian! O Titus, du Retter!“8 Aus diesem Ausschnitt des Kultliedes, dessen Ende Plutarch in der Titusvita festgehalten hatte, geht hervor, daß Titus als swthr gepriesen und zusammen mit der pistij, also der Treue der Römer und mit der Göttin Roma, qea Rwmh, verehrt wurde. Die Göttin Roma ist nichts Anderes als die Verkörperung der Macht Roms, welcher die Stadt Smyrna 195 v. Chr. einen Tempel mit dem dazugehörigen Kult einrichtete, was von A. Wlosok als rein „politischer und diplomatischer Akt“ gedeutet wird9.
Für die Römer der republikanischen Epoche bot sich nur die Verehrung verdienter Beamter, als Vertreter Roms, und die Preisung der personifizierten Macht Rom, da es in der römischen Republik keine individuelle Zentralautorität gab, anders als in den Städten des griechisch-hellenistischen Raumes, in denen Könige die individuellen Empfänger waren und ebenfalls anders als zur Zeit des Prinzipats im römischen Reich, als der Kaiser die Zielperson war. Es muß festgehalten werden, daß die den Römern gewidmeten Kulte bedeutend seltener waren als die Romakulte. Es gibt eine Liste mit über zwanzig Namen der römischen Verwaltungsbeamten, für die solche Ehrungen inschriftlich und literarisch bezeugt sind.10 Zu ihnen gehörten u.a., um nur einige zu nennen: Sulla, Pomejus, Cicero, Caesar, Antonius. Die letzten Fälle dieser Art werden auf 2/3 n. Chr. datiert. Die Ursache für das Erlöschen dieser Sitte war die Zentralautorität des Kaisers Augustus in Rom.
Eine andere sehr wichtige Gestalt, die im Rahmen des swthr-und-euergethj- Kultes und besonders für die Einrichtung des Kaiserkultes eine große Rolle spielte, war Julius Caesar. Mit seiner Alleinherrschaft im Osten nach dem Sieg über Pompejus veränderte sich die Situation des Wohltäterkults zunehmend. Der Inschrift aus Ephesos 11 zufolge wurde Caesar als erster Römer als qeoj epifanhj , also als „in Erscheinung tretender Gott“ bezeichnet neben swthr und euergethj. Außerdem wird ihm sogar eine göttliche Genealogie zugeschrieben, denn es lautet darin, er stamme von Ares (lat. Mars) und Aphrodite (lat. Venus) ab. Der Anlaß zu dieser Vergöttlichung war die Neuregelung des Abgabensystems durch Caesar. Äußerungen dieser Art waren in Rom zu dieser Zeit unerhört.
Bisher wurde der swthr-und-euergethj-Kult behandelt, welcher eine der beiden Stützen bei der Entwicklung des Kaiserkultes bildet, mit denen die Römer am häufigsten in Berührung kamen und welcher wahrscheinlich den größten Einfluß auf die Entstehung des Kaiserkultes hatte12. Neben diesem Wohltäterkult, der auf freiwilligen Entschluß einzelner Städte zurückging, der oft als politischer und diplomatischer Akt gegenüber einem mächtigen Wohltäter gedeutet wird, häufig auch numinöse Aspekte tragend13, gab es auch ab dem 3. Jahrhundert parallel die offiziellen Reichskulte hellenistischer Könige und damit einen institutionalisierten Herrscherkult, wobei hier die Initiative vom Herrscher selbst ausging, der Interesse daran hatte, seiner Macht sakrale Fundierung zu verleihen und seine Herrscherstellung somit zu erhöhen.14
Bei den Ptolemäern und Seleukiden entwickelte sich der Herrscherkult und erfuhr seine Reife und am Ende der Entwicklung implizierte der hellenistische Herrscherkult die Apotheose, also die Entrückung eines Königs zum Göttlichen. In diesem Zusammenhang beschäftigt die Forscher die Frage, in wieweit Alexander der Große als Begründer des Herrscherkultes anzusehen ist. Eduard Meyer ist der Meinung, daß Alexander göttliche Ehren verlangt und zielbewußt die absolute Monarchie angestrebt hatte, wonach der Kult zu Lebzeiten ein wirklicher Herrscherkult gewesen wäre, während Balsdon die Gegenposition vertritt, daß Alexander der Große jegliche Ehren nicht einmal gewünscht habe . Wilcken und Habicht dagegen nehmen an, Alexander habe im Einklang mit den zeitgenössischen griechischen Vorstellungen die Apotheose beansprucht als Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen, ohne einen politischen Zweck zu verfolgen15. Also ein Ausdruck der Anerkennung für außergewöhnliche Taten ohne eine Herrschaftsbeziehung. Bei den Kulten der Diadochen, der Nachfolger Alexanders des Großen, war diese aber enthalten. Während bei der Beurteilung der Alexanderkulte Unsicherheit herrscht, bezeichnet man die Reichskulte der Diadochen mit der implizierten Apotheose als die klassischen Beispiele des hellenistischen Herrscherkultes. Am besten erkennbar ist die Herausbildung des dynastischen Herrscherkultes bei den Ptolemäern und zwar in folgenden Etappen16:
1. wurde Alexander der Große als Stadtgründer in Alexandria heroisiert.
2. schuf Ptolemäus I . Soter einen offiziellen Alexanderkult mit Priesterschaft.
3. divinisierte Ptolemäus II, den Verstorbenen Vater Ptolemäus I mit seiner Gattin und errichte ihnen nun als „ qeoi swterej“ einen Tempel mit Priestern und Festspielen17.
4. heiratete Ptolemäus II seine Schwester und vergöttlichte sie möglicherweise noch zu Lebzeiten und sich selbst gesellte er sich wenig später als Lebender diesem Kult zu.
5. Unter dem Namen „qeoi adelfoi“ ließ er sich und seine Schwester als
Tempelgenossen in den Reichskult Alexanders des Großen aufnehmen.
Diese Linie der qeia basileia setzten die Generationen der Ptolemäer bis zum Ende der Dynastie fort.
In diesem Gottkönigtum unterschied sich der Herrscher wesentlich von den übrigen Menschen durch göttliche Natur und die Anteilnahme am Göttlichen. Seine Stellung auf Erden entsprach nämlich der des höchsten Gottes im Universum. Er besaß Qualitäten wie Güte und Erhabenheit und war Gott an Tugend gleich. Schließlich bestand seine Hauptfunktion im Retten und Helfen wie die der Götter.18 Die qeia basileia beinhaltet also einen Synkretismus, denn sie ist die Identifizierung des Herrschers mit einer Gottheit, was damals auf zeitgenössischen Epiphanievorstellungen basierte.
2.1.2 Das römische Verhältnis zum Herrscherkult
Für die Römer war die Vergottung19 eines Menschen zu Lebzeiten oder nach dem Tode von Haus aus fremd. Bis an die Schwelle des 1. vorchristlichen Jahrhunderts hat es in Rom wohl keine kultische Verehrung großer Persönlichkeiten zu Lebzeiten gegeben. Die Römer praktizierten bisher nur den Ahnenkult der römischen Familie. Dieser galt den Geistern der Verstorbenen, den Manes oder Di Parentum, wobei sie als ein unbestimmtes Kollektiv angesehen wurden, ohne daß auch ein besonders Verdienter als Individuum durch besondere Ehren herausgehoben worden wäre.
Erst der griechische Einfluß, der über Literatur und Philosophie verlief, deren Träger viele griechische Lehrer waren, die als servi oder liberti nach Rom kamen, bewirkte, daß östliche Religionsformen in Rom Fuß faßten und als attraktiv empfunden wurden20. Durch die militärischen Aktivitäten im Osten, gewannen auch viele römische Imperienträger wie Caesar, der eine ganz besonders wichtige Rolle im Hinblick auf den römischen Kaiserkult einnimmt, Erfahrungen mit dem dortigen Herrscherkult, welche sie mit sich nach Hause brachten. Die römische Plebs tendierte überschwenglichen Huldigungen zu überhäufen, dennoch machten sie kurz vor der
Vergöttlichung Halt. Das heißt also, daß es Ehrungen an Lebende in Rom durchaus gegeben hat, allerdings handelte es sich bei ihnen immer um spontane Danksagungen an die jeweiligen Wohltäter für ganz spezielle politische Leistungen, nicht jedoch um die Apotheose im eigentlichen Sinne.
„Der hellenistische Einfluß, der durch zahllose Kanäle in alle Schichten der römisch-italischen Gesellschaft eingedrungen war“21, hat den Boden für eine Religionswandlung in Rom geebnet. Weil Caesar eine eigene Apotheose auf römischen Boden haben wollte, vollzog er im Jahr 60 v. Chr. die Gleichsetzung des Archegeten der Römer, nämlich Romulus mit dem altrömischen Gott Quirinius, um ein „Vorbild für die Behandlung seiner eigenen Person zu schaffen“22.
Die Fragen nach Caesars Bestreben können auch heute nicht eindeutig beantwortet werden und zwar ob Caesar planmäßig an seiner sakralen Überhöhung gearbeitet hat, ob er wirklich die Königswürde für sich beansprucht hat und wenn ja, ob er sich dabei an den hellenistischen Herrscherkulten orientiert hat in Anlehnung an Alexander den Großen. Tatsächlich sind Spuren der Alexanderimitation und der Nachahmung des Romulus nachgewiesen23. Dann ergibt sich aber die Frage, ob Caesar das altrömische Königtum romuleischer Art wiederherstellen wollte oder eine Synthese24 aus diversen Elementen schaffen wollte. Außerdem wird die Möglichkeit erwogen, daß nicht Caesar selbst die treibende Kraft war, sondern ein übereifriger Senat und eine mit fremden Anteilen durchsetzte römische Stadtbevölkerung ihm die göttlichen Ehren von 46/44 v.Chr.25 aufdrängten26. Es kann keine Klarheit in diesen Fragen erzielt werden, da die Zeit von den göttlichen Ehrungen bis zur Ermordung Caesars 44 v. Chr. zu kurz war, als daß die Linien der weiteren Entwicklung noch hätten deutlicher zutage treten können. Die Ermordung Caesars 44 v. Chr. markiert nämlich einen irreversiblen Einschnitt.
Fakt ist, daß durch die Ehrenbeschlüsse an Caesar deine Machtposition immer sakraler wurde und er nach und nach von Rom und von vielen griechischen Städten27 vergottet wurde, z.B. wurde er nach dem Sieg über die Republikaner bei Thapsus 46. v. Chr. als Halbgott in nächster Nähe zum höchsten Gott Iuppiter gesehen. Im folgenden Jahr nach dem Sieg über die Söhne des Pompeius bei Munda wurde Caesar durch Aufstellung seiner Statue im Tempel des Quirinius(-Romulus) zu dessen sunnaoj erhoben28. Diese Tempelgemeinschaft mit Quirinius bedeutete daher eine Anwartschaft auf Vergottung.
Erst kurz vor dem Tod wurden für Caesar im Januar/Februar 44 v. Chr. im Hinblick auf den bevorstehenden Aufbruch in den Partherfeldzug eindeutige Vergottungsbeschlüsse29 gefaßt. Vorgesehen waren ein Kultname für Caesar, ein als flamen nominierter Priester und ein Tempel, der ihm mit seiner Clementia zusammen geweiht werden sollte. Diese Beschlüsse sind vor Caesars Tod nicht mehr zur Ausführung gekommen. Viele Römer konnten sich aber auch mit der wachsenden göttlichen Stellung Caesars nicht anfreunden. Für viele wirkte er immer unrömischer.
2.2 Beginn des Römischen Kaisertums und des Kaiserkults
Nach Caesars Ermordung bemühte sich sein Adoptivsohn Oktavian darum, Caesars Apotheose zu fördern, weil er von Anfang an darauf bedacht war, sich als Erbe Caesars in Verbindung mit den Göttern zu bringen. Die Erscheinung eines Kometen bei den Bestattungszeremonien im Juli 44 v. Chr. war für die Menschen ein Zeichen dafür, daß Caesars Seele unter die Götter gegangen ist. Dieser Volksglaube erleichterte dem Prinzeps die Aufgabe, Caesars Consecretio (= Apotheose) durchzusetzen. Schließlich wurde Caesar via Senats- und Volksbeschluß im Januar 42 v.Chr. konsekriert und als Divus Iulius30 unter die Götter der römischen Gemeinde aufgenommen.
Die Vielzahl der Ehrenbeschlüsse31 vom Januar 42 v. Chr. wie z.B. die gesetzliche Festlegung der Vergötterung Caesars und des Namens Divus Julius, der Bau eines Tempels an der Stelle des Scheiterhaufens u.s.w. waren keine neuen Ehren an Caesar, sondern die Bestätigung der Ehren im Staatskult, die mit dem Titel Divus Julius vor Caesars Tod bewilligt wurden32. Caesars Konsekration war der erste rechtliche Schritt auf dem Weg zum institutionalisierten römischen Kaiserkult.
Oktavian selbst übernahm im Jahre 40 v. Chr. im Frieden zu Brundisium den Titel Divi Filius33 und zugleich setzte er sich in ein Nahverhältnis zu Apollo34. Spätestens mit dem Sieg über Sextus Pompeius im Jahr 36 v. Chr. hat er seine Bindung an Apollo politisch hervorgekehrt und fortan propagandistisch gegen das Dionysiertum des Antonius ausgespielt. In demselben Jahr wurden Oktavian von den dankbaren italischen Munzipien göttliche Ehren zuerkannt. Diese haben Oktavian neben ihren Schutzgöttern verehrt.
Nach dem endgültigen Sieg über Antonius und Kleopatra, der den jungen Caesar zum Alleinherrscher machte, wurden ihm im Jahr 30 v. Chr. auch vom römischen Senat göttliche und göttergleiche Ehren zuerkannt. Es wurde nämlich verfügt, daß sein Geburtstag als offizieller Festtag unter Darbringung von Opfern gefeiert und bei allen Gastmählern ihm ein Libationsopfer, also eine Spende dargebracht werden sollte35. Im Jahr 27 v. Chr. erhielt er schließlich den sakralen Namen Augustus : Quo pro merito meo senatu[s consulto Aug. appe]llatus sum36. Dieser Titel hob Oktavian aus dem Kreis der Menschen heraus und rückte ich näher an die Götter.
Im Jahr 14/13 v Chr. wurde der Genius Augusti durch senatus consultum offiziell in den Staatskult aufgenommen, vorbereitet durch die Ehrenbeschüsse vom Jahr 30 v. Chr. Der augusteische Genius - er ist ein Schutzgeist, der das Individuum während des ganzen Lebens begleitet - wurde zum Empfänger der göttlichen Ehrungen, denn in ihm steckten die Macht und das Wirkungsprinzip des Mannes. So erfolgte die Verehrung des Augustus auf Umwegen, „über diese, den Gegebenheiten der römischen Religion angepaßten, vergöttlichten Potenzen des Herrschers, der in Analogie zum römischen Hausvater, nämlich Pater Familias, und zugleich dem Himmelsvater, dem Iuppiter Optimus Maximus, als Landesvater Pater Patriae gesehen werden sollte“37. Entsprechend stand der Genius Augusti als Kultempfänger im Vordergrund. Gesondert davon wandte man sich an sein Numen38, an die in ihm anwesende göttliche Macht, der Tiberius noch vor Augustus Tod, nämlich im Jahr 11 v. Chr. einen Altar geweiht hat.
Ab 17 v. Chr. wurden auch personifizierte Abstrakta wie pax, concordia, iustiatia, victoria, fides u.s.w. die einem Herrscher zugeschrieben wurden , deifiziert und verehrt. Im Fall des Augustus wurde besonders die Pax Augusta verehrt, weil der römische Frieden zu seinen bedeutendsten Leistungen zählte. Aus dem Grund wurde u.a. im Jahr 13 v. Chr. in Praeneste ein Altar der Pax Augusta errichtet39: „Paci August(ae) sacrum decuriones populusque Praenestin“. Nach dem Tode des Prinzeps wurde er aufgrund seiner hervorragender politischer Leistungen durch Senatsbeschluß konsekriert und als Divus Augustus in die Reihe der römischen Staatsgötter versetzt40: „post redditum caelo patrem, et corpus eius humanis honoribus, nomen divinis honoratum.“ Ab diesem Zeitpunkt wurden alle Kaiser, die sich nicht gerade unbeliebt gemacht haben, vom Senat konsekriert. Die Person des toten Kaisers und alles, was in Beziehung mit ihm stand, war heilig. Die Verehrung der Kaiser wurde letztlich allen Bewohnern des römischen Reiches zur Pflicht gemacht. Das Vorbild, das Augustus gegeben hatte, blieb an die drei Jahrhunderte für die äußere Gestaltung des Kaiserkultes maßgeblich.
2.2.1 Die Eigenschaften und Funktionen des Kaiserkults
Der Kult der römischen Kaiser variierte häufig in bestimmten zeitlichen und räumlichen Abschnitten in der Erscheinungsform und Intensität. Es war oft vom taktischen Wirken des Kaisers selbst und der Mentalität der Bevölkerung sowie den temporären sozialpolitischen Verhältnissen abhängig. Obwohl Augustus beispielsweise bewußt den Kult um seine Person förderte, da er erkannt hatte, daß eine kultische
Verehrung seiner Person zur Stabilisierung der neuen monarchischen Herrschaftsform beitragen konnte, mußte er oft besonders in Rom Zurückhaltung und Behutsamkeit zeigen, um unerwünschte Reaktionen in Rom zu vermeiden. Deshalb ließ er dort den Kult des Divus Julius und seinen eigenen Kult nur in Verbindung mit dem Kult der Dea Roma zu41. In Rom wäre der Prinzeps eher auf Unwillen der Bürger gestoßen, wenn er seinen Kult rücksichtslos propagiert hätte als im Osten, da die Menschen dort ganz und gar nichts Anstößiges an der Verehrung eines lebenden Herrschers gefunden hätten, außerdem sahen die Menschen in Augustus den Soter, Euergetes und Ktistes42, nachdem er Kleinasien befreit hatte.
Im Osten des Reichs war die Bereitschaft und Eigeninitiative zur kultischen Verehrung des Kaisers so groß, daß Oktavian diese sogar auf das römische Niveau bremsen mußte. Im Westen wiederum hat es die Voraussetzungen für eine spontane Entstehung von Kaiserkulten nicht gegeben, so daß ihre Einführung erst eines Anstoßes von Rom bedurfte und gerade in den neu erworbenen und wenig romanisierten Provinzen erfolgte. Mit anderen Worten regulierte der Kaiser permanent die ihm entgegengebrachten Ehren mit dem Ziel, die Bevölkerung des Reiches an sich zu binden und im Fall junger Provinzen, sie erst zu zivilisieren und zu romanisieren.
Obwohl gewöhnlich nur die Verehrung toter Kaiser nach deren Apotheose erlaubt und zugleich obligatorisch war, bildeten die westlichen Provinzen eine Ausnahme darin, daß sie die Kaiser schon zu Lebzeiten ehren durften, solange er in Kultgemeinschaft mit Dea Roma auftrat. Dieses von Augustus geschaffene Modell sollte auch seinen Nachfolgern dienen. Dabei handelte es sich allerdings um eine rein politische und keine religiöse Schöpfung, um ein Mittel, die Bande der Loyalität fester zu knüpfen.43 Neben den Provinzen übten auch die Klientenstaaten den Kaiserkult. Zur Zeit des Prinzipats des Augustus hat besonders der König Herodes in den nichtjüdischen Städten viele Augustustempel errichten lassen und gegenüber den Juden durfte er behaupten, daß er dabei auf Weisung gehandelt habe. Offenbar forderte die römische Regierung von Herodes den Augustuskult als ein Zeichen der Loyalität44. Auch er forderte von seinen Untertanen den Loyalitätseid nicht für sich allein, sondern auch für Augustus. In den meisten Gemeinden des römischen Reiches jedoch erhielt nicht der Kaiser selbst, sondern sein Genius und separat von ihm sein Numen den Kult45.
Der Kaiserkult übertraf im Grunde alle anderen bestehenden Kulte dadurch, daß er sämtliche Bevölkerungsschichten verband, Sklaven, Freigelassene und Freie. Im Prinzip galt die Verehrung nicht so sehr dem Betreffenden persönlich als vielmehr der Weltmacht Rom, die in der Person des Kaisers individuelle Gestalt gewonnen hat.
Im 34. Kapitel der „res gestae“ liefert Augustus eine gute Charakterisierung der sichtbaren Zeichen, welche seine Alleinherrschaft und die der Nachfolger optisch faßbar machten46: „ ... Für dieses mein Verdienst wurde ich durch den Senatsbeschluß Augustus genant; an meinen Türpfosten wurden von Staats wegen zwei Lorbeerbäume angebracht; über meinem Eingangstor wurde der Kranz der Bürgerrettung aufgehängt. Und in der curia Iulia wurde ein goldener Ehrenschild aufgestellt, den nach dem Zeugnis seiner Inschrift der Senat und Römervolk als Lohn meiner Kriegstugend, Milde Gerechtigkeit und Pietät anerboten haben.“ Davon hatte erst nur das Cognomen Augustus eine religiöse Prägung, der Eichenkranz kennzeichnet ein ehrenvolles Verdienst der Rettung der römischen Bürgerschaft, früher eine Ehrenauszeichnung eines römischen Soldaten für die Rettung eines Kameraden, während die Lorbeerbäume, die, aus der Vorzeit stammend mit einer geheiligten Rolle versehen, veranlaßt durch Vorstellungen der Magie und des Aberglaubens, statt der prähistorichen Zaubervorstellung von einer unheimlichen Macht des Mannes aufgestellt wurden, von dem das Schicksal von Millionen Menschen abhing, neu potenziert wurden47.
Durch den Synkretismus, die Anknüpfung des Kaiserkultes an bereits vorhandene Kulte anderer Gottheiten, ergab es sich von selbst, daß deren Priesterschaften auch die Pflege des Kaiserkultes übernahmen. So begegnen in Pompeji die ministri Mercurii Maiae, die sich später ministri Augusti Merurii Maiae und seit dem Jahr 2 v. Chr. einfach ministri Augusti nannten48: „A. Veius Phylax N. Popidius s Moschus T. Mesinius s Amphio Primus s Arrunti s M.L. min. Aug. ex. d. d. iussu M. Holconi Rufi IV A. Clodi s Flacci s III d. v. i. d. P. Caesti s Postumi N. Tintiri s Rufi [d] v..v. s. p. p. [imp. cae]sare s XIII [m. plautio si]lano s cos.“ Nur ein Jahr später treten in Pompeji die ersten ministri
Fortunae Augustae49: „Agathemerus s Vetti Suaris s Caesiae s Primae Pothus s
Numitori Anteros s Locutulani minist. Prim. Fortun. Aug. iussu. M Stoi Rufi.Cn. Melissaei d. v. i. d. P. Silio. L. Volusio s Saturn s cos.“
Die Träger des Kultes waren in Italien und den Westprovinzen die Augustales, meist liberti, selten ingenui, die ein Kollegium bildeten und zusammen mit früheren Augustales bald als ein eigener Stand zwischen der Plebs und dem Dekurionenstand galten. Neben den Augustales gab es auch die seviri Augustales und magistri Augustales50. Das Augustalenamt war zwar einjährig, doch war Wiederwahl nicht ausgeschlossen. Durch die Einrichtung des munzipialen Augustuskultes war es dem Prinzeps möglich, die wohlhabenden liberti als eine bevorrechtete Schicht zu konstituieren und eng an seine Person zu binden. Da gerade die Freigelassenen einen wichtigen Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung nach den Bürgerkriegen hatten, wurden sie schnell zu loyalen Anhängern des Prinzeps und zu wichtigen Trägern der neuen Ordnung51.
Das Erlangen der Apotheose durch den verstorbenen Kaiser, deren letzter förmlicher Anteilnehmer wahrscheinlich der entschiedene Christusgegner Kaiser Julian war, hing von zwei Faktoren ab. Erstens mußten die Caesaren beim Volk und Senat einen positiven Eindruck hinterlassen haben und indem sie die Funktionen des Soters und des Euergetes, möglichst stark praktiziert haben, um Gefallen vor allem bei den einflußreichen Kreisen zu wecken. Haben sie sich schon durch große soziale und politische Leistungen beliebt gemacht, mußte zweitens ein Zeuge nach ihrem Tod in der Senatsversammlung auftreten und schwören, gesehen zu haben, daß er die Seele des Verstorbenen in welcher Form auch immer zum Himmel aufsteigen sah. Gab es dieses Zeugnis, wie es im Falle Caesars der erschienene Komet war, stand der Konsekration nichts mehr im Wege52.
Zusammenfassend darf gesagt werden, für die Menschen war der Kaiser nicht nur ein einer Gottheit naher Repräsentant des römischen Reiches, dem es daran gelegen hat, den Zusammenhalt und Wachstum des Reiches zu fördern, indem er durch die behutsame Verbreitung des Kultes seiner Person und des Kollektivs der konsekrierten Kaiser in Verbindung mit anderen Göttern, besonders der Dea Roma die Loyalität aller untergebenen Schichten zu erreichen suchte, wodurch er diese zusammen verband, sondern er war vor allem (im Idealfall) der Euergetes schlechthin, von dem das Schicksal der ganzen Bürgerschaft abhing. Im göttlichen Synkretismus stehend, sollte er geradezu Güte, Gnade, Schutz und Friedenswillen reflektieren wie die Götter selbst, was bei Bedarf ersucht, wofür dann schließlich als Dank starke Kaisertreue demonstriert wurde wie im Beispiel Pompeji.
2.2.2 Pompeji und der Kaiserkult
Pompeji als eine Provinzstadt des römischen Reiches nahm den Kaiserkult nicht nur einfach hin, sondern praktizierte ihn sehr stark. Den ersten Beleg dafür liefern Quellen, laut welchen der Priester Holconius Rufus den Kaiser Augustus noch zu Lebzeiten ehrte53. Die schon im vorangegangenen Kapitel zitierten Quellen54 weisen auch auf die sich fortlaufend vermehrende Priesterschaft des Kaisers Augustus in Pompeji hin. Pompeji begrüßte die Thronbesteigung eines jeden Kaisers, auch die kaiserliche Familie erfuhr immer viel Beachtung. Die kaiserlichen Statuen55 auf dem Forum von Pompeji zeugen in diesem Zusammenhang von großem Eifer. Unter den Caesaren genossen besonders Vespasian und Nero besondere Popularität, weil sie sich den Bewohnern der Stadt gegenüber als Euergetai erwiesen haben. Nero erwies sich den Pompejanern gnädig, weil er das Verbot für die Spiele im Jahr 59 n. Chr. aufgehoben hatte, nachdem diese zuvor wegen eines blutigen Streits zwischen den Pompejanern und den Bewohnern von Nuceria für zehn Jahre vom Senat untersagt worden waren56. Die Kaisertreue förderte auch noch Neros Vermählung mit Poppaea Sabina, einer Pompejanerin aus einer wohlhabenden Familie, die bei den Mitbewohnern hohes Ansehen genoß. Sie und der Kaiser wurden aufgrund des Beschlusses, der die Spiele im Amphitheater wieder erlaubte, hoch verehrt57: „IVDICIS AVGVSTI P P ET POPPAEAE AVG. FELICITER“ und folgendermaßen58: „IVDICIS AVGVSTI AVGVSTAE FELICITER NOBIS SALVIS FELICES SUMUS PERPETUO“. Vespasian wurde wiederum in der Person eines Richters verehrt, da er durch die Abordnung eines gewissen T. Suedius Clemens nach Pompeji dafür gesorgt hat, daß in den Kataster der Stadt Ordnung eingekehrt ist und sie Grund und Boden wiedererhalten hat, welcher zuvor durch Privatleute unrechtmäßig weggenommen worden war59: „M EPIDIVM SABINVM II VIR I D O V F DIGNISSIMVM IVVENEM SANCTUS ORDO FACIT CLEMENTI SANCTO IVDICI FEL“. Die Bilder des Kaisers Vespasian fanden überall in der Stadt
Platz, auf dem Marktplatz, im Laren-Heiligtum und im Tempel selbst, der ihm selbst geweiht war.
3. FAZIT
Zum ersten Mal seit der republikanischen Zeit hatten die Römer, die Bewohner der Provinzen und der Klientenstaaten eine zentrale greifbare Gottheit, der sie, mit anderen wetteifernd, schmeichelnde göttliche Ehrungen entgegen bringen konnten, um für sich selbst Hilfe durch die kaiserliche Gnade zu erbitten. Nur durch die so immense politische Leistung, mit der Kaiser Augustus die Menschen als Retter der römischen Bürgerschaft und Friedensstifter aufs Stärkste beeindruckt hatte, konnte der Kaiserkult in Rom und im Westen Fuß fassen.
Da Pompeji selbst stark unter hellenistischen Einflüssen gestanden hat, und viele Griechen dort neuen Lebensraum fanden, während sie ihr religiöses Gedankengut verbreiteten, war Pompeji verhältnismäßig früh bereit, den Herrscherkult zu praktizieren, im Gegensatz zu anderen Städten in Richtung Westen, wo die Voraussetzungen dafür nicht sofort existierten.
Der Kaiserkult in Pompeji ist als Wohltäterkult zu sehen, denn man trifft dort auf das Wechselspiel von swzein und timan, die Grundstruktur des Wohltäterkults, vor allem bei den Kaisern Nero und Vesapian. Man muß aber auch noch betrachten, daß die Kultivierung des Staatskultes durch die Pompejaner den Zweck zur Selbsthilfe hatte, zumindest nach 62 n Chr.. Pompeji war nämlich nach dem Erdbeben vom Februar 62 n. Chr. auf Kredite angewiesen und daher gezwungen, Kaisertreue zu demonstrieren60. Ganz gleich ob zuerst Pompeji dem Kaiser mit Ehren schmeichelte, um Hilfe von ihm zu bekommen, oder ob zuerst der Kaiser die Initiative zum Helfen ergriff, wofür er geehrt wurde, die Funktion des römischen Kaiserkultes zur Bindung der Kolonien und Provinzen an Rom ist jedenfalls durch die daraus erwachsenen gegenseitigen Erwartungen voll erfüllt. Anzunehmen ist auch, daß die Funktion der Romanisierung wie der Verbindung von Menschen jeglicher Herkunft ebenfalls im Staatskult in Pompeji Erfüllung fand.
Literaturverzeichnis
Alföldi, Andreas.: Die zwei Lorbeerbäume des Augustus, 1973 in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 403 - 422 Balsdon, J.P.V.D.: Rezension von: Gerhard, Dobesch: Caesars Apotheose zu Lebzeiten und sein Ringen um den Königstitel in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 364 - 367
Bowersock, G. W.: Augustus und der Kaiserkult im Osten in Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 389 - 402 Charlesworth, Martin Percival.: Einige Beobachtungen zum Herrscherkult, besonders in Rom in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 163 - 200
Étienne, Robert.: Pompeji, Das Leben in einer antiken Stadt, Aufl. 5, Philipp Reclam jun. Stuttgart 1998
Gelzer, Matthias.: Ehrenbeschlüsse für Caesar (im Jahre 45) in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 334 - 340 Heinen, Hubert.: Zur Begründung des römischen Kaiserkultes, Chronische Übersicht von 48 v. bis 14 n. Chr., Diss. Tübingen 1910
Kienast, Dietmar.: Augustus, Prinzeps und Monarch, Aufl. 3, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1999
Klauck, Hans.-Josef: Die religiöse Umwelt des Urchristentums II. Herrscher- und Kaiserkult, Philosophie, Gnosis. Bd. 9. Stuttgart u.a. 1996
Mommsen, Theodor.: Monumentum Ancyranum, 2. Aufl. 1883
Taylor, Lily Ross.: Divus Julius in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 333
Wlosok, Antonie.: Einführung in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 1 - 52
Zanker, Paul.: JdAI 90, 1975
Quellennachweis
CIL IV,3726, 1074, 7579 ; CIL X, 830, 837, 824, 890; CIL XIV, 2898 SIG³ 760 ; Vell. II, 124
Homer: Odyssee, Reclam, Stuttgart 1979, übersetzt von Hampe, Roland
Plutarch: Tit, in: Große Griechen und Römer, Hrsg v. Ziegler, Konrat, Zürich 1957 Plutarch: Lys, übers. u.a. bei Nilsson, Martin.P., Religion, Beck, München 1977
Theokrit:.: Gedichte (TuscBü), Hrsg. v. Fritz, F.P, München 1970
[...]
1 Charlesworth, M. P.: Einige Beobachtungen zum Herrscherkult, besonders in Rom in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 163f
2 Odyssee VIII, 464 ff.
3 Vgl. Charlesworth, M. P.: Einige Beobachtungen zum Herrscherkult, besonders in Rom in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 164 - 173
4 Zitiert aus Plutarch, Lys 18,3f; Übers. u.a. bei Nilsson, M.P., Religion
5 Vgl. Klauck, Hans-Josef: Die religiöse Umwelt des Urchristentums II. Herrscher- und Kaiserkult, Philosophie, Gnosis. (Kohlhammer Studienbücher Theologie) Bd. 9. Stuttgart u.a. 1996, S. 19f
6 Wlosok, Antonie: Einführung in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S.4.
7 Zitiert nach Klauck, Hans-Josef: Die religiöse Umwelt des Urchristentums II. Herrscher- und Kaiserkult, Philosophie, Gnosis. Bd. 9. Stuttgart u.a. 1996, S. 41
8 aus Plutarch; Tit 16,3f. abgedruckt in: Klauck, Hans-Josef: Die religiöse Umwelt des Urchristentums II. Herrscher- und Kaiserkult, Philosophie, Gnosis. Bd. 9. Stuttgart u.a. 1996, S. 41
9 Wlosok, Antonie: Einführung in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 5
10 vgl. Bowersock, G. W.: Augustus und der Kaiserkult im Osten in Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978 S. 401f
11 SIG³ 760: „ai poleij ai en thi Asiai kai oi [dhmoi] kai ta eqnh Gaion Ioulion Gaio[u ui]on
Kaisara, ton arcierea kai autokratora kai to deuteron upaton, ton apo Arewj kai Afrode[i]thj qeon epifanh kai koinon tou anqrwpinou biou swthra“ ; Übersetzung nach Verfasser
12 Siehe Kapitel 2.1.2
13 Wlosok, Antonie: Einführung in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 5
14 Wlosok, Antonie: Einführung in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 7
15 zu den Forscherpositionen: Wlosok, Antonie: Einführung in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 7-11
16 Klauck, Hans-Josef: Die religiöse Umwelt des Urchristentums II. Herrscher- und Kaiserkult, Philosophie, Gnosis. Bd. 9. Stuttgart u.a. 1996, S. 37f
17 Vgl. Fritz, F.P., Theokrit: Gedichte (TuscBü), München 1970, Z.121-130 erst in spätrepublikanischer Zeit oft dazu, ihre besonderen Lieblinge wie die Gracchen oder Marius mit
18 Zum Gottkönigtum s. Wlosok, Antonie: Einführung in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 14
19 Wlosok, Antonie: Einführung in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 16f
20 Klauck, Hans-Josef: Die religiöse Umwelt des Urchristentums II. Herrscher- und Kaiserkult, Philosophie, Gnosis. Bd. 9. Stuttgart u.a. 1996, S. 42f
21 Gelzer, Matthias: Ehrenbeschlüsse für Caesar (im Jahre 45) in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 335f
22 Klauck, Hans-Josef: Die religiöse Umwelt des Urchristentums II. Herrscher- und Kaiserkult, Philosophie, Gnosis. Bd. 9. Stuttgart u.a. 1996, S. 42
23 Wlosok, Antonie: Einführung in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 26f
24 Wlosok, Antonie: Einführung in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 26
25 zu den Ehrungen an Caesar vom Senat s. Heinen, Hubert: Zur Begründung des römischen Kaiserkultes., Chronische Übersicht von 48 v. bis 14 n. Chr., Diss. Tübingen 1910., S. 2-5
26 Klauck, Hans-Josef: Die religiöse Umwelt des Urchristentums II. Herrscher- und Kaiserkult, Philosophie, Gnosis. Bd. 9. Stuttgart u.a. 1996, S. 47
27 Inschrift aus Ephesos: SIG³ 760
28 Wlosok A. ermahnt , diese Maßnahmen nicht für die strickte Apotheose, als Erhebung zum Gott, zu halten, denn hinsichtlich des unter Augustus eingeführten römischen Herrscherkultes würden diese Ereignisse überbewertet werden. Tatsächlich waren diese Maßnahmen ein beträchtlicher Fortschritt in der Vergöttlichung.
29 Balsdon, J.P.V.D.: Rezension von: Gerhard, Dobesch: Caesars Apotheose zu Lebzeiten und sein Ringen um den Königstitel in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 356
30 Taylor, L. R.: Divus Julius in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 333
31 Vgl. Heinen, Hubert: Zur Begründung des römischen Kaiserkultes., Chronische Übersicht von 48 v. bis 14 n. Chr., Diss. Tübingen 1910, S. 7f
32 Taylor, L. R.: Divus Julius in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 333
33 Vgl. Heinen, Hubert: Zur Begründung des römischen Kaiserkultes., Chronische Übersicht von 48 v. bis 14 n. Chr., Diss. Tübingen 1910, S. 12
34 Oktavian entschied sich bewußt für den Gott Apollo als Leitstern, weil dieser für Klarheit ,Maß und Nüchternheit steht, ganz im Gegensatz zum Dionysos des Antonius, welcher Rausch und Ekstase symbolisiert. Vgl. Klauck, Hans-Josef: Die religiöse Umwelt des Urchristentums II. Herrscher- und Kaiserkult, Philosophie, Gnosis. Bd. 9. Stuttgart u.a. 1996. S. 49f
35 Vgl. Heinen, Hubert: Zur Begründung des römischen Kaiserkultes, Chronische Übersicht von v. bis 14 n. Chr., Diss. Tübingen 1910, S. 15-19
36 Mommsen: Monumentum Ancyranum, 2. Aufl. 1883, p. 144
37 Zitiert nach Wlosok, Antonie: Einführung in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 38f
38 Dadurch, daß einem Menschen ein Numen zugeschrieben wird, das ist die spezifische Eigentümlichkeit einer römischen Gottheit, ist sein Wirken, sein Wille, seine Machtausübung als göttlich prädiziert und somit letztlich auch der Mensch selbst. Vgl. Wlosok, Antonie: Einführung in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 39f
39 CIL XIV, 2898 (ara eleganter sculpta)
40 Vell. II, 124
41 Kienast, Dietmar: Augustus, Prinzeps und Monarch, Aufl. 3, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1999, S. 246f
42 Wlosok, Antonie: Einführung in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 42f
43 Charlesworth, M.P.: Einige Beobachtungen zum Herrscherkult in: Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 180ff
44 Zum Kaiserkult des Herodes und zu den vom ihm errichteten Augustustempeln s. Otto, W., RE Suppl. II 1913, 64ff. Taylor, L.R. Divinity 171.
45 Kienast, Dietmar: Augustus, Prinzeps und Monarch, Aufl. 3, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1999, S. 253
46 abgedruckt und übersetzt bei Alföldi, Andreas: Die zwei Lorbeerbäume des Augustus, 1973 in Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 403
47 Zur Bedeutung der einzelnen Ehrenelemente s. Alföldi, Andreas: Die zwei Lorbeerbäume des Augustus, 1973 in Wlosok, Antonie: Römischer Kaiserkult, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1978, S. 404 - 422
48 CIL X, 890 (Inschrift aus Pompeji)
49 CIL X, 824 (Inschrift aus Pompeji)
50 Zu den Priesterschaften s. Kienast, Dietmar: Augustus, Prinzeps und Monarch, Aufl. 3, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1999, S. 253ff
51 Vgl. dazu Zanker, P.: JdAI 90, 1975, 281ff
52 Zur Consecratio des Prinzeps vgl. Klauck, Hans-Josef: Die religiöse Umwelt des Urchristentums II. Herrscher- und Kaiserkult, Philosophie, Gnosis. Bd. 9. Stuttgart u.a. 1996, S. 47f
53 CIL X, 830, 837 ( sacerdos Augusti ); 838, 947, 948 ( Flamen Augusti)
54 CIL X, 824, 890 (Inschrift aus Pompeji)
55 siehe Plan des Forums in: Étienne, Robert: Pompeji, Das Leben in einer antiken Stadt, Aufl. 5, Philipp Reclam jun. Stuttgart 1998, S. 121; Legende zum Forumsplan S. 120
56 Étienne, Robert: Pompeji, Das Leben in einer antiken Stadt, Aufl. 5, Philipp Reclam jun. Stuttgart 1998, S. 114
57 CIL IV, 3726
58 CIL IV, 1074
59 CIL IV, 7579
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über den römischen Kaiserkult?
Diese Arbeit untersucht die Funktion des Kaiserkults im römischen Reich. Sie analysiert anhand von pompejanischen Inschriften, inwieweit sich der Kaiserkult in Pompeji manifestiert. Zuerst wird der Herrscherkult im griechisch-hellenistischen Raum betrachtet, dann die Formen des Kultes in der römischen Republik und im Kaiserreich. Ziel ist, eine allgemeingültige Definition für die Funktion des Kaiserkults zu finden und diese auf Pompeji anzuwenden.
Wie begann der Kaiserkult im griechischen Raum?
Der Herrscherkult entwickelte sich aus dem "Wohltäterkult". Dieser Kult begann mit dem Hegemoniestreben Alexanders des Großen und der Diadochen. Die Verehrung von Wohltätern, die Rettung und Wohlergehen sicherten, war ein wichtiger Bestandteil. Diese Verehrung konnte die Form göttlicher Ehren annehmen.
Wer waren die "swthr" und "euergethj" und welche Rolle spielten sie?
"Swthr" bedeutet Retter und "euergethj" Wohltäter. Die Griechen verehrten Personen, die diese Rollen erfüllten, oft mit göttlichen Ehren. Dieser Kult des "swthr-und-euergethj" beeinflusste später die Entwicklung des römischen Kaiserkults.
Wie reagierten die Römer auf den hellenistischen Herrscherkult?
Als die Römer im Osten des Mittelmeerraumes politisch aktiv wurden, wurden sie mit dem Herrscherkult konfrontiert. Sie wurden oft als Wohltäter angesehen und erhielten entsprechende Ehrungen. Die Römer der Republik verehrten verdiente Beamte als Vertreter Roms sowie die personifizierte Macht Roms.
Welche Rolle spielte Julius Caesar bei der Entstehung des Kaiserkults?
Caesar wurde nach seinem Sieg über Pompejus im Osten als "qeoj epifanhj" (in Erscheinung tretender Gott) bezeichnet. Ihm wurde sogar eine göttliche Abstammung zugeschrieben. Durch die Ehrungen erhielt seine Macht eine immer sakralere Bedeutung, und er wurde nach und nach von Rom und vielen griechischen Städten vergöttlicht.
Wie entwickelte sich der Herrscherkult bei den Ptolemäern und Seleukiden?
Bei den Ptolemäern und Seleukiden entwickelte sich der Herrscherkult bis zur Apotheose, der Erhebung des Königs zum Göttlichen. Die Ptolemäer führten dynastische Kulte ein, in denen sie sich selbst und ihre Familienmitglieder vergöttlichten.
Wie standen die Römer der Vergottung eines Menschen gegenüber?
Für die Römer war die Vergottung eines Menschen zu Lebzeiten oder nach dem Tod ursprünglich fremd. Sie praktizierten den Ahnenkult. Erst der griechische Einfluss bewirkte, dass östliche Religionsformen in Rom Fuß fassten. Die Plebs neigte zu überschwänglichen Huldigungen, hielt aber kurz vor der Vergöttlichung inne.
Wie begann der römische Kaiserkult unter Augustus?
Nach Caesars Ermordung förderte sein Adoptivsohn Oktavian die Apotheose Caesars. Caesar wurde als Divus Iulius unter die Götter der römischen Gemeinde aufgenommen. Oktavian selbst nahm den Titel Divi Filius an und setzte sich in Beziehung zu Apollo. Später erhielt er den sakralen Namen Augustus. Der Genius Augusti, sein Schutzgeist, wurde in den Staatskult aufgenommen.
Welche Eigenschaften und Funktionen hatte der Kaiserkult?
Der Kaiserkult diente der Stabilisierung der monarchischen Herrschaftsform. Er verband die Bevölkerung des Reiches an den Kaiser und im Fall junger Provinzen zur Zivilisierung und Romanisierung. Der Kaiser regulierte permanent die ihm entgegengebrachten Ehren, um die Loyalität der Bevölkerung zu gewinnen. Auch Klientelstaaten praktizierten den Kaiserkult als Zeichen der Loyalität.
Wer waren die Träger des Kaiserkultes?
In Italien und den Westprovinzen waren die Augustales, meist Freigelassene, die Träger des Kultes. Das Augustalenamt ermöglichte es dem Prinzeps, die wohlhabenden Freigelassenen eng an seine Person zu binden.
Wie gelangte ein verstorbener Kaiser zur Apotheose?
Für die Apotheose war ein positiver Eindruck beim Volk und Senat erforderlich, der durch die Ausübung der Funktionen des Soters und Euergetes erweckt wurde. Außerdem musste ein Zeuge schwören, die Seele des Verstorbenen zum Himmel aufsteigen zu sehen.
Wie äußerte sich der Kaiserkult in Pompeji?
Pompeji praktizierte den Kaiserkult sehr stark. Der Priester Holconius Rufus ehrte Kaiser Augustus noch zu Lebzeiten. Statuen der Kaiser waren auf dem Forum zu finden. Besonders Vespasian und Nero genossen Popularität als Euergetai. Nero erfuhr Verehrung, da er die Spiele im Amphitheater nach einer zehnjährigen Untersagung wieder erlaubte.
Welche Bedeutung hatte der Kaiserkult für Pompeji?
Der Kaiserkult in Pompeji kann als Wohltäterkult gesehen werden. Man findet das Wechselspiel von swzein (retten) und timan (ehren). Nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. demonstrierte Pompeji Kaisertreue, um Kredite zu erhalten. Der Kaiserkult erfüllte die Funktion zur Bindung der Kolonien und Provinzen an Rom.
- Quote paper
- Christoph Harmata (Author), 1999, Kaiserkult in Pompeji, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104964