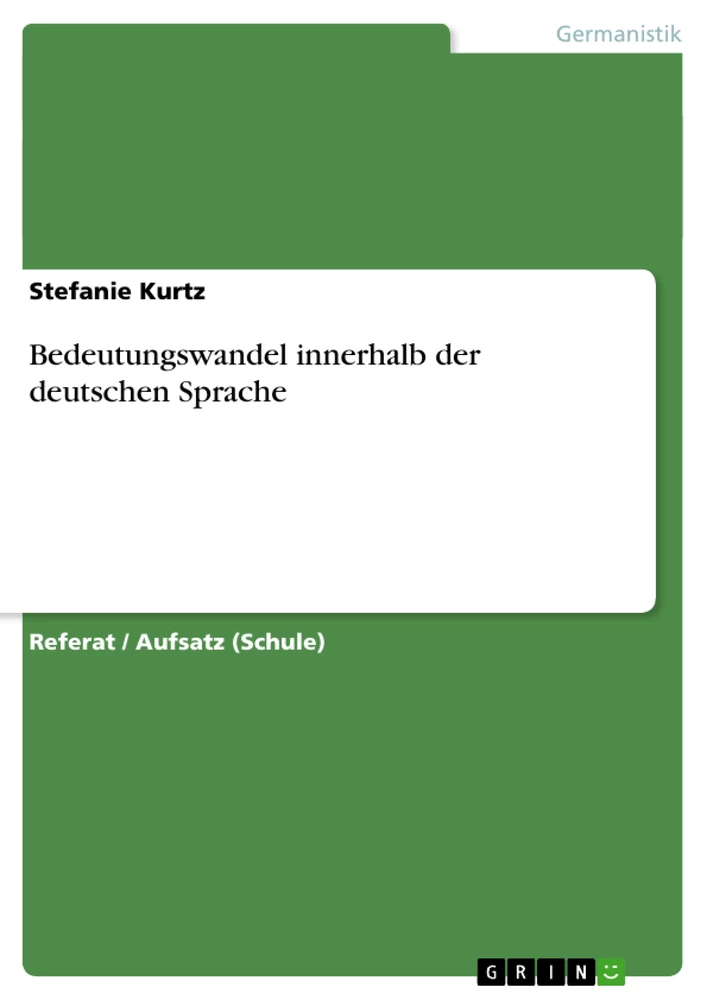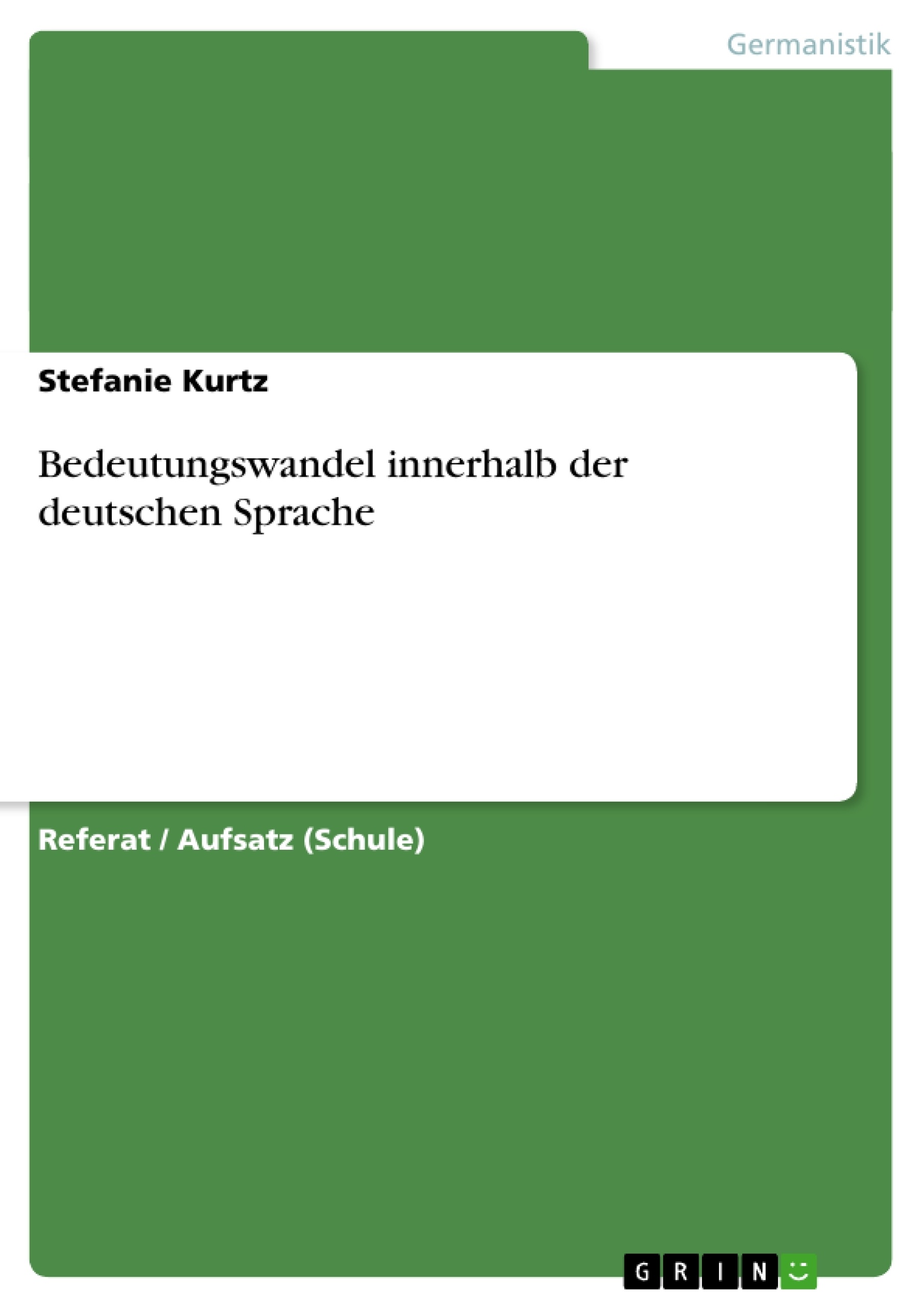Haben Sie sich jemals gefragt, wie die Worte, die wir täglich benutzen, ihre heutige Form angenommen haben? Begeben Sie sich auf eine faszinierende Reise durch die Epochen der deutschen Sprache, von ihren indogermanischen Wurzeln bis hin zur modernen Alltagssprache. Diese tiefgründige Untersuchung enthüllt die vielfältigen Einflüsse, die unsere Sprache geprägt haben, von den Römern über die französische Ritterschaft bis hin zur heutigen globalisierten Welt. Entdecken Sie, wie sich das Althochdeutsche mit seinen klangvollen Endungen zum Mittelhochdeutschen unter französischem Einfluss wandelte, und wie Humanismus und Renaissance das Frühneuhochdeutsche formten. Verfolgen Sie die Entwicklung der neuhochdeutschen Schriftsprache, die durch Luthers Bibelübersetzung und den Buchdruck gefördert wurde, und erleben Sie, wie die germanische und hochdeutsche Lautverschiebung die Sprachlandschaft veränderten. Erfahren Sie mehr über die Integration von Fachsprachen, die Internationalisierung des Wortschatzes und die feinen Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation. Dieses Buch bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über die Geschichte der deutschen Sprache, sondern auch ein tiefes Verständnis für die Dynamik des Sprachwandels und die Bedeutung von Lehnwörtern, Standardsprache, Fachsprache und Umgangssprache. Tauchen Sie ein in die Welt des Hildebrandliedes, des Nibelungenliedes und der Werke von Lessing, Heine und Brecht, und gewinnen Sie neue Einblicke in die reiche literarische Tradition, die unsere Sprache geformt hat. Lassen Sie sich von den überraschenden Zusammenhängen zwischen Sprache, Geschichte und Kultur fesseln und entdecken Sie, wie die deutsche Sprache zu dem geworden ist, was sie heute ist – ein Spiegelbild unserer Vergangenheit und ein Schlüssel zu unserer Zukunft. Dieses Werk ist ein Muss für Sprachliebhaber, Studierende der Germanistik und alle, die ein tieferes Verständnis für die deutsche Sprache und ihre Entwicklung suchen.
Gliederung
1.Einleitung
2. Bedeutungswandel der deutschen Sprache
2.1 Ursprung
2.2 Althochdeutsche Sprachperiode
2.3 Mittelhochdeutsche Sprachperiode
2.4 Frühneuhochdeutsche Sprachperiode
2.5 Neuhochdeutsche Sprachperiode
2.6 Erste Lautverschiebung
2.7 Zweite Lautverschiebung
2.8 Gegenwartssprache
2.9 Begriffserklärung
3. Schluss
4. Literaturverzeichnis
5. Anhang
1.Einleitung
Die Sprache ist ein System von Lautzeichen, das dem Menschen die Möglichkeit gibt, Bewusstseinsinhalte auszudrücken, die sich ihrerseits auf Dinge der Außenwelt, auf Vorstellungen und Gefühle beziehen. Die Sprache ist die Gesamtheit der sprachlichen Ausdrucksmittel, die einer menschlichen Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Ihrer Verwendung nach ist die Sprache ein Ausdrucksmittel, besonders aber, da Sprache niemals unabhängig von Menschen existiert, ein Mittel der Verständigung und zur Mitteilung. Die Sprache ist eine gesellschaftliche Erscheinung und wird benutzt um die Ergebnisse des Denkens unter den Menschen auszutauschen. Deshalb ist die Sprache weder an gesellschaftlichen Überbau noch an Klassen gebunden. Das Wort Sprache bezieht sich also sowohl auf die Sprachfähigkeit des einzelnen als auch auf den Sprachbesitz einer Gemeinschaft. Als Muttersprache ist sie ein geschichtlich erworbenes, geordnetes Ganzes aus einem gegliederten Wortschatz, aus Satzgliedern und aus Grundformen des Satzbaus.
2. Bedeutungswandel der deutschen Sprache
2.1. Ursprung
Es gab in Europa 2 Sprachfamilien um das 5. Jahrhundert vor unserer Zeit. Man unterschied zwischen Ural-Altische Sprachfamilie, dazu gehörte Finnisch, Estnisch, Ungarisch und es gab noch die Indoeuropäische Sprachfamilie, dazu gehörte Indisch, Iranisch, Armenisch, Griechisch, Albanisch, Lateinisch, Romanisch, Keltisch, Slawisch, Germanisch, Baltisch. Aus diesen Sprachgruppen entwickelten sich später Einzelsprachen. zum Beispiel: Germanisch Deutsch, Englisch, Niederländisch, Dänisch,
Norwegisch, Schwedisch
In der germanischen Sprache traten vor allem im 1. Jh. unserer Zeit Veränderungen auf. Diese wurden durch die 2 Lautverschiebung hervorgerufen.
Die deutsche Sprache beginnt sich seit dem 5. Jh. auf der Grundlage von Stammessprachen zu entwickeln: Stammessprache der Allemannen, der Franken, der Thüringer, der Sachsen und teilweise der Friesen. Unsere Sprache ist aber erst seit dem 8 Jh. schriftlich überliefert, frühere Formen wurden durch Sprachwissenschaftler untersucht, indem sie verwandte Sprachen miteinander verglichen.
Die Ursachen für die Entwicklung unserer Sprache durch Übernahme von Wörtern aus anderen Sprachen waren im 1 Jahrhundert u.Z. die Begegnung mit den Römern und ihrer höheren Kultur. Man übernahm Lateinisches Wortgut aus den Gebieten Handel, Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwesen, Kochkunst und Schifffahrt. Im 3-5. Jh. übernahm man von den Germanen die 7 Tage Woche.
Durch einen längeren Entwicklungsweg ist die deutsche Sprache entstanden so wie wir sie jetzt kennen. Man teilt die deutsche Sprache in vier Sprachperioden ein: Althochdeutsche, Mittelhochdeutsche, Frühneuhochdeutsche und die Neuhochdeutsche Sprachperiode.
2.2 Althochdeutsche Sprachperiode 750-1050 u.Z.
Die Sprache entstand aus dem Lateinischen. Die Ursache dafür war die Christianisierung des gesamten Sprachgebietes, die entwickelnde Klosterkultur und die Lehnprägung der Missionare. Lehnübersetzung kam aus den Bereichen: Schule, Schriftwesen, Gartenbau, Koch- und Buchkunst, Heilkunst.
Sprachliche Merkmale dieser Periode waren:
- klangvolle Endungen,
- Abschwächnug der Vokale in den Endsilben zu unbetonten „e“:
i-Umlaut - die Folge war auf der Stammsilbe ein i oder j, so wurde oft das `a` der Stammsilbe zu `e` umgelautet. Zum Beispiel gast > gesti
- der Wortschatz des Althochdeutschen
- das Lehnwort wurde aus dieser Sprache übernommen und eingedeutscht
- es wurde nicht die Lautung und Flexion der aufnehmenden Sprache angenommen
das Althochdeutsche war sehr reich an Formen, deshalb gab es auch einen lockeren Satzaufbau.
Literarische Beispiele für das Althochdeutsche wären das Hildebrandlied und Heliand.
Außerdem sind vor allem Übersetzungen kirchlicher Texte erhalten und auch ein Teil der germanischen Literatur.
2.3 Mittelhochdeutsche Sprachperiode 1050-1350 u. Z.
Diese Sprache entwickelte sich unter Einflüssen aus Frankreich. Die Ursache waren die vielfältigen kulturellen und literarischen Beziehungen zu Frankreich und die Beziehungen zu der französischen Ritterschaft ( 2. Kreuzzug 1149-49). Es gab Entlehnungen aus den Bereichen: z.B. Abenteuer, Turnier, Panzer, Palast.
Das Französische hatte auch Einfluss auf die Wortbildung im Deutschen z.B. die Infinitiv- Endungen -ie, -ieren, -lei. Die franz. Endung -ie finden wir heute noch in den Wörtern Drogerie oder Garantie oder später in der eingedeutschten Form -ei in Wörtern Bäckerei und Malerei. Zum ersten Mal wurden in der höfischen Zeit auch Verben auf -ieren gebildet. Diese Endung ist bis heute eine wichtige Form zur Bildung neuer Zeitwörter. Außerdem gab es den Verfall der vollen End- und Mittelsilbenvokale. Es war auch der Beginn der Doppellaute bzw. Zwielaute z.B. hûs - Haus, mîn - mein und teilweise der Monophthongierung z.B. liep - lieb, muot - Mut. Es gab die ersten Versuche, eine übermundartliche hochdeutsche Sprachform zu finden.
Beispiele für diese Periode sind das Nibelungenlied und der Minesänger Walther von der Vogelweide.
2.4 Frühneuhochdeutsche Sprachperiode 1350-1650
Die lateinische Sprache beeinflusste um diese Zeit die Sprachperiode stark. Die Ursache war, dass die Idee des Humanismus von Italien nach Deutschland vordrang, genau wie die Idee der Renaissance. Fremde Wörter z.B. aus dem Lateinischen, bekamen eine fremde Endung, Komma oder Semikolon, denn die Endsilben wurden abgeschwächt. Die Bereiche die die lateinische Sprache beeinflussten waren Wirtschaft (Text, Patient, operieren,...), Rechtswesen (Prozess, Klient,...), Bildungswesen (Abitur, Gymnasium).
Außerdem wurde diese Periode durch die spanische Sprache beeinflusst. Das kam daher, dass die Deutschen Handelsbeziehungen und politische Beziehungen zu den Habsburgern hatten. Entlehnung aus den Bereichen Handel (Kredit, Kasse, Bilanz,...), Seefahrt (Kapitän, Regatte,..).
Auch die französische Sprache hatte einen übermächtigen Einfluss auf die deutsche Sprache, durch das Vorbild des franz. Hofes unter Ludwig XIV. Die Lehnübersetzung kam aus den Bereichen Mode, Hofleben, politische u. gesellschaftliche Bereiche, gesellschaftliches Vergnügen (Karussell, Ballet, Ball,...), Küche (Kompott, Sauce, Schokolade, Torte,...)und Militärwesen (Offizier, Spion, Kamerad, Bombe,...).
Literarische Beispiele für die frühhochdeutsche Sprachperiode waren Hans Sax und das Volksbuch von Till Eulenspiegel.
Es bildeten sich Sprachgesellschaften - eine Gegenbewegung setzte ein Ihr Ziel war es, die Überfremdung der deutschen Sprache zu verhindern. Mitglieder dieser Gegenbewegung waren deutsche Gelehrte und Schriftsteller des 17 Jh. (Martin Opitz, Philipp v. Zersen). Man bemühte sich um eine einheitliche Orthographie und eine überregionale Sprache. Für Fremdwörter setzte man entsprechend deutsche Wörter ein. Die deutschen Entsprechungen setzten sich nur zum Teil durch, da sie oft überzogen waren und lächerlich wirkten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.5 Neuhochdeutsche Sprachperiode seit 1650
Die Sprache entwickelte sich auf Grundlage der ostmitteldeutschen Sprache, die seit Mitte des 17 Jh. vorherrschte. Im 15. /16. Jh. begann sich im Osten eine hochdeutsche Schriftsprache zu bilden, diese wurde durch den Buchdruck und Luthers Bibelübersetzung gefördert. Es gab einen ständigen Ausgleich regional unterschiedlicher sprachlicher Erscheinungen. Daraus folgte, dass es ein überregionales Kommunikationsmittel für das gesamte Sprachgebiet gab. In dieser Zeit nahm das Ansehen der deutschen Sprache zu. Hochdeutsch wurde Sprache der Wissenschaft. Dabei ging die Stellung der lateinischen Sprache als Bildungssprache stark zurück. Am Ende des 18. Jh. waren Ausgleichsprozesse abgeschlossen. Außerdem wurde diese Sprachperiode durch das Englische im 19. Jh. beeinflusst. Aber erst am Ende des 19 Jh. gab es eine einheitliche Orthografie und Orthoepie.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literarische Beispiele für diese Sprachperiode sind Lessing, Heine und Brecht.
2.6 Die (germanische) Lautverschiebung
Sie hat etwa 1.Jh. v.Chr. stattgefunden und trennte die germanische Sprache von der indogermanischen Sprache. Die Lautverschiebung fand in allen germanischen Sprachen statt. Die Veränderungen sind:
- Wortakzent wurde fest auf die Stammsilbe gelegt z.b. Pater - Vater
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- im Konsonantischen System wurden die Verschlusslaute abgeändert
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Veränderungen im Formbestand
- es gab eine Tendenz zur Vereinfachung
1. von acht auf vier Fälle
2. Verben standen nur noch im Präsens und Präteritum Formen im Aktiv
3. Entstehung der schwachen Verben z.B. malen, malte, gemalt
4. Veränderung der Adjektivdeklinationen und Ausbau des Wortbestandes
geschichtlicher Hintergrund der 1. Lautverschiebung
Es kam zur Auflösung der indogermanischen Sprache durch Wanderung, Trennung und Vermischung mit anderen Völkern. Herausbildung der gemeinsamen Vorstufe der heutigen germanischen Sprachen (2000-5000 v.u.Z.). Es gab einen Ausbau des Wortbestandes, der auf soziale, kulturelle und technische Entwicklung zurückzuführen ist.
2.7 Zweite (hochdeutsche) Lautverschiebung
Sie fand ab dem 5. Jahrhundert statt und ging vom Süden Deutschlands aus. Diese Lautverschiebung trennte die hochdeutschen Mundarten von den westgermanischen Sprachen im 6. /7. Jh. . Sie hat nur die hochdeutschen Mundarten erfasst!
Durch die unterschiedliche Verbreitung der Lautverschiebung gliederten sich die hochdeutschen Mundarten in zwei Gruppen:
- Oberdeutsch (Südfränkisch, Ostfränkisch, Bayrisch, Schwäbisch-Alemannisch
- Mitteldeutsch (westmitteldeutsch: Rhein - und Mittelfränkisch
- Ostmitteldeutsch: Thüringisch, Schlesisch, Obersächsisch)
Unberührt blieben durch die Lautverschiebung jedoch die Niederdeutschen Mundarten (Niederfränkisch, Sächsisch, Ostniederdeutsch).
Die Intensität der Lautverschiebung nimmt in Richtung Norden ab. Man kann eine deutliche Trennlinie erkennen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das nennt man Benrather Linie, da die Grenze vom hoch - u. dem niederdeutschen Sprachgebiet sich von Aachen über Benrath am Rhein, Kassel und Magdeburg bis Fürstenberg an der Oder entlangstreckte.
Veränderungen:
germ. b d g < p t k althochdeutsch
- findet nur im oberdeutschem Gebiet statt
germ. p t k < f z hh (hh = ach-Laut)
- im gesamten hochdeutschen Gebiet
Beispiele: opan < offan (offen)
etan < ezzan (essen)
ik < ih (ich)
historischer Hintergrund
Seit dem 3. Jahrhundert u.Z. kann nicht mehr von Germanen schlechthin gesprochen werden. Denn die Spracheinheit löst sich auf:
1. Nordgermanen
2. Ostgermanen
3. Elbgermanen
4. West-Rhein-Germanen} Süd- o. Westgermanen
5. Nordseegermanen
2.8 Die Entwicklung der Gegenwartssprache
Bei der Entwicklung der Gegenwartssprache gab es unterschiedliche Entwicklungslinien.
1. Integration: Elemente aus Fachsprachen und Umgangssprachen dringen in die Standartsprache ein
2. Internationalisierung: Elemente der Lexik, die in mehreren wichtigen Sprachen eine fast gleiche Bedeutung haben, wurden in gleicher oder ähnlicher Form übernommen.
3. Differenzierung: - Gruppen- und Fachsprache, die sich von der Allgemeinsprache unterscheiden (spezifische Wörter, Wortbedeutungen, jedoch keine Besonderheiten in der Grammatik)
- Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache werden verstärkt
4. Sprachökonomie: - Bestreben mit wenig Zeichen viele Informationen zu übermitteln
- stärkste Entwicklungslinie der Sprachentwicklung
2.9.Begriffserläuterung
Lautverschiebung: Eine Lautverschiebung ist eine lautliche Veränderung im Konsonantensystem, deren Ursachen noch nicht endgültig geklärt sind. Lehnwort: Das Lehnwort ist ein Wort, das aus einer anderen Sprache übernommen wurde. Lehnübersetzung: Ist die ursprüngliche Bedeutung in den eigenen Wortschatz übersetzt
Standardsprache: Ist auch die Hoch- oder Schriftsprache. Sie ist die Form des deutschen, die auch überregionale Geltung besitzt (für das gesamte Sprachgebiet).
Fachsprache: 1. Berufssprache
2. Sondersprache ( spezifischer Wortschatz und Redestil der Wissenschaft o. Technik; viele Internationalismen)
Gruppensprache: Sondersprache; ist der Wortschatz einer sozial eng zusammengehörigen Gruppe; ist die Entwicklung eigener Bezeichnungen für verschiedene Dinge und Erscheinungen (Schülersprache, Soldatensprache usw.), Jargon
Umgangssprache: Ist durch jeweilige Mundart der Sprecher bestimmte überlandschaftliche Form der vorwiegend gesprochenen Sprache, die sich zwischen Mundart und Hochsprache bewegt.
Es gibt aber keine einheitliche Umgangssprache.
Literatursprache: Ist die Sprache der schönen Literatur - vielfältig
Ist die Bezeichnung für höherentwickelte schriftliche (Schriftsprache) und und mündlicher Form (Hochsprache) einer Nationalsprache (Hochdeutsch).
3. Schluss
Man sieht das die deutsche Sprache sich über einen langen Zeitraum hin entwickelt hat. An dieser Entwicklung haben die Fremdsprachen einen maßgeblichen Anteil. Vor allem die französische und lateinische Sprache prägten die deutsche Sprache in ihrer Ausdrucksweise. Denn viele Wörter und Wortendungen wurden aus den Fremdsprachen übernommen, die man noch heute in unserer Sprache finden kann. Die deutsche Sprache ist deshalb auch mit Lehnwörtern durchzogen, auch wenn sich einige Gegner dagegen gewehrt haben. Es war sehr interessant diese Entwicklung auszuarbeiten, denn vorher konnte man sich nicht erklären, warum sich so viele Fremdwörter in unserer Sprache befinden. Auch das die Geschichte an der Entwicklung so stark beteiligt war, war für mich neu. Es war auf jeden Fall lehrreich, dieses Referat zu schreiben.
Thesenblatt
1.These: Die deutsche Sprache gliedert sich in die Sprachperioden!
2.These: Die deutsche Sprache ist durch Fremdsprachen maßgeblich beeinflusst wurden!
3.These: Die Mundarten wurden von der Lautverschiebung nicht beeinflusst!
4.These: Die Geschichte hat einen wichtigen Anteil an der Entwicklung der deutschen Sprache!
5. These: Die Lautverschiebungen waren sehr wichtig für die Entwicklung!
Sprechvorlage
- Einleitung
Definition Sprache
- System von Lautzeichen
- drückt Bewusstseinsinhalte, Gefühle und Gedanken aus
- Gesamtheit der Ausdrucksmittel, zur Verständigung, Mitteilung
- Muttersprache, gegliederter Wortschatz, Satzglieder, Satzaufbau
- Bedeutungswandel der deutschen Sprache Ursprung
- 2 Sprachfamilien Ural- Altisch, Indoeuropäisch
- Entwicklung Einzelsprachen germanisch - deutsch, Englisch
- Entwicklung Stammessprachen seit 5. Jh., schriftlich seit 8. Jh.
- Ursachen Römer getroffen, Übernahme lateinische Wortgutes
Althochdeutsche Sprachperiode 750-1050
- Ursprung Latein, Ursache Christianisierung, Klosterkultur, Lehnprägung
- klangvolle Endungen, Abschwächungen in den Endsilben, Lehnwortübernahme,
- Hildebrandlied, Heliand, kirchliche Texte, germanische Literatur
Mittelhochdeutsche Sprachperiode 1050-1350
- Ursprung Frankreich, Ursache kulturelle u. literarische Beziehungen, Ritterschaft
- Einfluss Infinitivendungen -ie, -ieren, -lei, -ieren
- Verfall End- u. Mittelsilbenvokale, Doppellaute hûs-Haus, einf. Vokale liep-lieb
- Nibelungen Lied, Walter von der Vogelweide
Frühneuhochdeutsche Sprachperiode 1350-1650
- Einfluss Latein dabei war Ursache Idee Humanismus, Idee Renaissance
- fremde Wörter fremde Endungen, Abschwächung der Endsilben
- Einfluss Spanien, Entlehnung Handel, Seefahrt
- Einfluss Frankreich durch Vorbild Ludwig XIV.
- Hans Sax, Volksbuch Till Eulenspiegel
Gegenbewegung
Neuhochdeutsche Sprachperiode als 1650
- Grundlage ostmitteldeutsche Sprache
- Bibelübersetzung, Buchdruck
- Hochdeutsch als Wissenschaftssprache, Latein ging zurück
- 19.Jh. Beeinflussung Englisch
- Lessing, Heine, Brecht
1. Lautverschiebung
- 1. Jh.v.Chr. in allen germ. Sprachen, Trennung germanische von indogermanischer Sprache
- Formbestand: vier von acht Fälle, Verben in Präsens u. Präteritum, schwache
Verben, Ausbau Wortbestand, Adjektivdeklination
- Geschichtlicher Hintergrund
2. Lautverschiebung
- 5. Jh. vom Süden Deutschlands, Intensität nimmt Richtung Norden ab,
- Trennung hochdeutsche Mundarten von westgermanischen Sprachen
Gliederung der hd. Mundarten
- Trennlinie erkennbar Benrather Linie
- historischer Hintergrund
- Begriffserklärung
Schluss
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments "Bedeutungswandel der deutschen Sprache"?
Das Dokument ist eine umfassende Übersicht über die Entwicklung der deutschen Sprache, beginnend mit ihren Ursprüngen bis zur Gegenwartssprache. Es behandelt die verschiedenen Sprachperioden, Lautverschiebungen und den Einfluss anderer Sprachen auf die deutsche Sprache.
Welche Sprachperioden werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die folgenden Sprachperioden:
- Althochdeutsche Sprachperiode (750-1050 u.Z.)
- Mittelhochdeutsche Sprachperiode (1050-1350 u. Z.)
- Frühneuhochdeutsche Sprachperiode (1350-1650)
- Neuhochdeutsche Sprachperiode (seit 1650)
Was sind die Ursachen für den Bedeutungswandel der deutschen Sprache?
Mehrere Faktoren haben den Bedeutungswandel der deutschen Sprache beeinflusst, darunter:
- Christianisierung
- Kulturelle und literarische Beziehungen zu anderen Ländern (z.B. Frankreich, Italien, Spanien)
- Handelsbeziehungen
- Politische Beziehungen
- Buchdruck und Luthers Bibelübersetzung
Was sind die germanischen Lautverschiebungen?
Es werden zwei Lautverschiebungen im Dokument beschrieben:
- Die erste (germanische) Lautverschiebung, die die germanischen Sprachen von den indogermanischen Sprachen trennte.
- Die zweite (hochdeutsche) Lautverschiebung, die die hochdeutschen Mundarten von den westgermanischen Sprachen trennte.
Welche Fremdsprachen hatten einen großen Einfluss auf die deutsche Sprache?
Die folgenden Fremdsprachen hatten einen großen Einfluss auf die deutsche Sprache:
- Latein
- Französisch
- Spanisch
- Englisch
Was ist die Benrather Linie?
Die Benrather Linie ist eine Trennlinie, die das hochdeutsche vom niederdeutschen Sprachgebiet abgrenzt.
Was versteht man unter Lehnwort und Lehnübersetzung?
Ein Lehnwort ist ein Wort, das aus einer anderen Sprache übernommen wurde. Eine Lehnübersetzung ist die Übersetzung der ursprünglichen Bedeutung eines Wortes in den eigenen Wortschatz.
Welche Entwicklungslinien gibt es in der Gegenwartssprache?
Die Entwicklung der Gegenwartssprache wird durch folgende Entwicklungslinien beschrieben:
- Integration
- Internationalisierung
- Differenzierung
- Sprachökonomie
Welche Thesen werden im Dokument aufgestellt?
Die folgenden Thesen werden im Dokument aufgestellt:
- Die deutsche Sprache gliedert sich in die Sprachperioden!
- Die deutsche Sprache ist durch Fremdsprachen maßgeblich beeinflusst wurden!
- Die Mundarten wurden von der Lautverschiebung nicht beeinflusst!
- Die Geschichte hat einen wichtigen Anteil an der Entwicklung der deutschen Sprache!
- Die Lautverschiebungen waren sehr wichtig für die Entwicklung!
- Quote paper
- Stefanie Kurtz (Author), 2001, Bedeutungswandel innerhalb der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104953