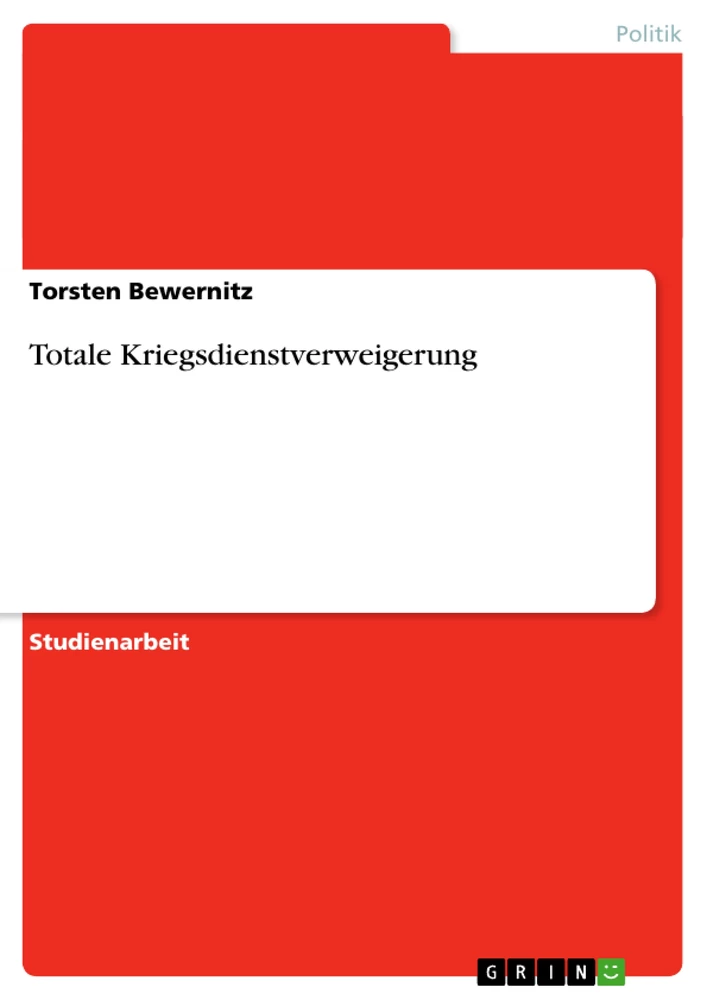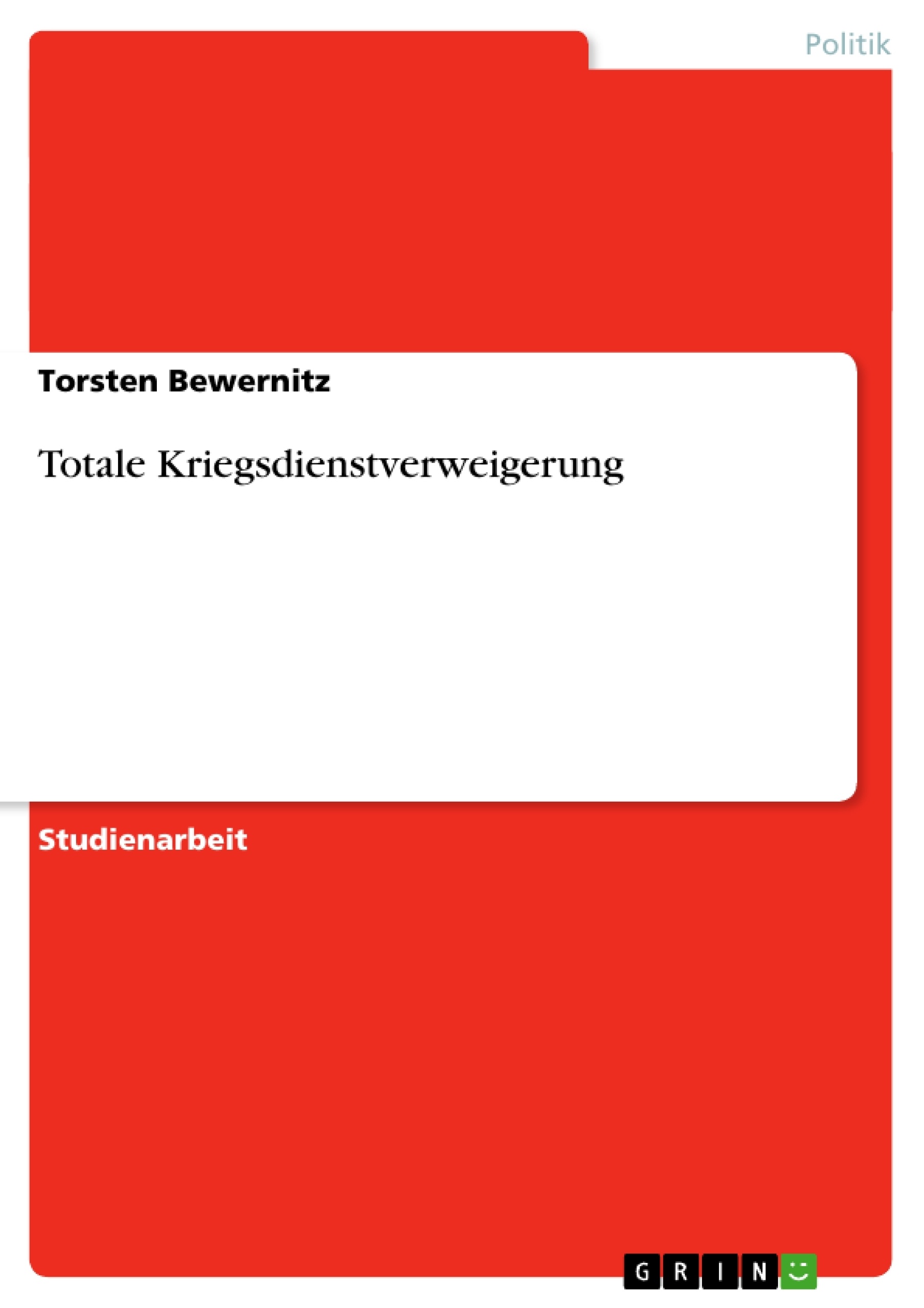Stell dir vor, du stehst am Scheideweg, konfrontiert mit einer Entscheidung, die dein Leben für immer verändern wird: Kriegsdienst leisten oder dich dem System verweigern? Dieses Buch wirft einen intimen und kritischen Blick auf die vielschichtige Thematik der Kriegsdienstverweigerung in Deutschland, insbesondere auf die oft missverstandene Position der Totalverweigerer. Es analysiert die historische Entwicklung des deutschen Militärs vom Kaiserreich über die Weimarer Republik und das Dritte Reich bis hin zur Bundeswehr, beleuchtet die Rolle des Zivildienstes als vermeintliche Alternative und deckt dessen militärischen Charakter auf. Warum entscheiden sich Menschen, jeglichen Dienst zu verweigern, selbst angesichts strafrechtlicher Konsequenzen? Welche Motive – religiöser, politischer oder individueller Natur – treiben sie an? Das Buch untersucht die Strukturen der Bundeswehr, ihre Finanzierung, ihre neuen Aufgaben im globalen Kontext und die damit einhergehende Erosion des Verfassungsgrundsatzes. Es zeigt auf, wie der Zivildienst zur Aufrechterhaltung der Wehrpflicht beiträgt und die kritische Auseinandersetzung mit Militarismus untergräbt. Diese tiefgreifende Analyse des Kriegsdienstes, der Kriegsdienstverweigerung, des Zivildienstes, der Rolle des Militärs, der Geschichte Deutschlands, des Wehrpflichtgesetzes, des Grundgesetzes, der Friedensbewegung, des Antimilitarismus, der Totalverweigerung, der Gewissensfreiheit, der Menschenrechte, der politischen Motivation, der religiösen Motivation, der individuellen Entscheidung, der juristischen Konsequenzen, der Bundeswehr, des Zivildienstgesetzes, des Soldatengesetzes, der Wehrmacht, des Kaiserreichs, der Weimarer Republik, des Dritten Reichs, der NATO, der WEU, der Friedenspolitik, der Sicherheitspolitik, der Militärstrategie und der Rolle Deutschlands in der Welt ist ein Must-Read für alle, die sich mit Fragen von Krieg und Frieden, Gewissen und Widerstand auseinandersetzen wollen. Es fordert dazu auf, die vermeintlichen Sicherheiten des Systems zu hinterfragen und den Mut zur eigenen Überzeugung zu finden. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der die Entscheidung für oder gegen den Dienst zur Waffe zu einer Frage von Leben und Tod werden kann und erfahren Sie, was es bedeutet, für seine Ideale einzustehen, komme was wolle. Die komplexe Materie wird anhand zahlreicher Beispiele und historischer Bezüge verständlich aufbereitet und regt zum Nachdenken über die eigene Positionierung an.
INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
1. DIE ROLLE DES DEUTSCHEN MILITÄRS IM 20. JAHRHUNDERT
1.1 Das Militär im Kaiserreich und während des 1. Weltkrieges
1.2. Das Militär in der Weimarer Republik
1.3. Der Militarismus des Dritten Reichs
1.4. Die Anfänge der Bundeswehr in der Bundesrepublik Deutschland
2. DIE NEUE BUNDESWEHR
2.1 Struktur
2.2 Finanzierung
2.3 Neue Aufgaben / Erweiterung der bundesdeutschen Interessen
2.4 Verfassungsänderung ohne Verfassungsmehrheit
3. KRITIK DES ZIVILDIENSTES
3.1 Verweigerung des Wehrdienstes nach Art. 4 Abs. 3 GG
3.2 Zivildienst als ziviler Kriegsdienst
3.3 Der militärische Charakter des Zivildienstes
3.4 Erhaltung und Anerkennung der Wehrpflicht durch den Zivildienst
3.5 Friedenspolitischer Anspruch und politische Realität der ZDL
4. MOTIVE FÜR DIE TOTALE KRIEGSDIENSTVERWEIGERUNG
4.2 Religiöse Gründe für die Totalverweigerung
4.2 Die Totalverweigerung als politischer Akt
4.3 Die Totalverweigerung als individueller Akt
SCHLUß
LITERATURVERZEICHNIS
Einleitung
In den letzten Jahren brach eine erneute Diskussion um den Kriegsdienst aus, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern zumindest in den meisten der westlichen Staaten. Jüngstes Beispiel ist wohl die faktische Abschaffung der Wehrpflicht in Frankreich, ersetzt durch einen einzigen „Vorbereitungstag“ zur Landesverteidigung ab dem Herbst 1998. Bis zum Jahr 2003 soll Frankreich eine reine Berufsarmee haben.1
In der BRD ist diese Diskussion vor allem an den Auseinandersetzungen um die Out-of-area-Einsätze bemerkbar, und vielleicht noch mehr durch die Streitigkeiten um das Tucholsky-Zitat „Soldaten sind Mörder“ und dem aus dieser Diskussion resultierenden Gesetzesentwurf zum Ehrenschutz der Soldaten. Weiterhin ist zu beobachten, daß die Zahl der Zivildienstleistenden, der sogenannten Kriegsdienstverweigerer, konstant steigt2, insbesondere steigt diese Zahl nach Ereignissen wie z.B. dem Golfkrieg 1992.
Einigen reicht es jedoch nicht, ihrer antimilitaristischen oder pazifistischen3 Denkweise durch die Alternative des Zivildienstes gerecht zu werden. Konse- quent verweigern sie jeden Kriegsdienst und bezeichnen sich als Totalverweige- rer. Auch ihre Zahl steigt zunehmend, trotz der Kriminalisierung dieser Art des passiven Widerstandes.
Welches nun Gründe und Argumente für eine solche Totalverweigerung sind, soll in dieser Arbeit erläutert werden. Dazu beleuchten wir sowohl die Rolle des deut- schen Militärs in diesem Jahrhundert und seine gesellschaftliche Stellung, als auch insbesondere die Rolle des Zivildienstes im System der BRD und im Kriegs- fall.
Die Arbeit beschränkt sich auf das Phänomen der Totalverweigerung in der Bundesrepublik Deutschland, obwohl eine Betrachtung z.B. der viel breiter organisierten „Insumision“ (span. für Verweigerung)-Bewegung in Spanien für diese Diskussion von sehr großem Interesse wäre.
1. Die Rolle des deutschen Militärs im 20. Jahrhundert
1.1 Das Militär im Kaiserreich und während des 1. Weltkrieges
Im kaiserlichen Deutschland gab es zwar rechtlich eine allgemeine Wehrpflicht, praktisch hatte diese jedoch nicht bestanden. Dies änderte sich 1893 mit einer Vergrößerung des Heeres um 84.000 Mann und einer parallelen Verkürzung der Wehrdienstzeit von drei auf zwei Jahre.4 Zu dieser Zeit wurden die Reservisten auch regelmäßig zu Übungen einberufen.
Der Beruf des Soldaten war allgemein hochgeachtet. Neben der Tatsache, daß es als Auszeichnung galt, im Heer zu dienen, da sich dort viele Adelige im Dienst befanden, war die herrschende Politik ein Grund dafür. In den Zeiten des Imperia- lismus und der Kolonisation, in der auch Deutschland einen „Platz an der Sonne“ ergattern sollte, schien ein starkes Militär für den kaiserlichen Staat Vorteile zu bieten. Die Propaganda, sowohl von Verbänden wie z.B. dem „Alldeutschen Ver- band“, der auch in der Weimarer Republik noch bestand und dort den Nationalso- zialisten in die Hände spielte, als auch von staatlicher Seite, leistete ihren Teil, um solches Denken in der Gesellschaft zu bestärken. So wurde etwa ohne Heimlich- keit über die Möglichkeit eines Präventivkrieges nachgedacht, Militärparaden und das Erscheinungsbild des Kaisers in Uniform taten ihr übriges. Als Beispiel sei das Engagement des Kaisers Wilhelm II. im Flottenbau genannt. Seine Devise lautete: „Weltpolitik als Aufgabe, Weltmacht als Ziel, Flotte als Instrument“.5 Der Flottenbau und damit auch das gesamte Militär war für den Kaiser und damit auch für den Mainstream in der Bevölkerung eine Prestigefrage.
Eine Ausnahme in diesem Stimmungsbild bot die sozialistische bzw. auch die sozialdemokratische Bewegung, die weitgehend kriminalisiert war. Auch eine pazifistische Bewegung, vertreten etwa durch Personen wie Bertha von Suttner, existierte zu der Zeit. Das Bestreben, eine Abrüstungskonferenz von russischer Seite aus zu organisieren, wurde von kaiserlicher Seite in Deutschland allerdings als „Komödie“ bezeichnet, entsprechend lehnte der deutsche Militärsachverstän- dige, Oberst Schwarzhoff, eine Abrüstung von deutscher Seite rundweg ab.6 Dieses Meinungsbild änderte sich auch mit Beginn des 1. Weltkrieges nicht: Die deutschen Reservisten, durch die staatliche Propaganda angeheizt, gingen großen- teils voller Begeisterung in den Krieg - galt es doch, sich mit dem „Erbfeind“ Frankreich, zu schlagen. Selbst die im Parlament vertretene SPD stimmte Kriegs- renditen noch zu, als der Krieg für das Kaiserreich als verloren gelten konnte, abgesehen von einigen wenigen Abgeordneten die daraufhin die USPD gründe- ten, die später als Spartakus-Gruppe die Keimzelle der KPD bildete.7 Aufgrund der Parteidisziplin riefen jedoch weder Sozialdemokraten noch Kom- munisten zur Kriegsdienst- oder Gehorsamsverweigerung auf, im Gegensatz zu anarchistischen Antimilitarismus-Strömung, in Publikationen wie etwa dem „Sol- daten-Brevier“ von Siegfried Nacht, einer Übersetzung des französischen „Manu- el du Soldat“.8
Auch im kaiserlichen Deutschland gab es Kriegsdienstverweigerungen, motiviert durch sozialistische und pazifistische Agitationen gegen das Militär. Der Antimilitarismus in Deutschland war beeinflußt durch französische und russische pazifistische Schriften, beispielsweise von Leo Tolstoi. Bekannt geworden ist der Fall des Schuhmachers Paul M., der sich 1901 weigerte, zu einer Reserveübung einzurücken. Dieser Fall wurde in den Charité-Annalen unter dem Titel „Ueber einen reinen Fall von überwertiger Idee und über seine forensische Beurteilung“ aufgearbeitet. Antimilitaristen wurden nicht nur kriminalisiert, sondern auch als psychisch krank abgestempelt.9 Daß Desertionen im 1. Weltkrieg ebenfalls nichts außergewöhnliches waren, insbesondere, als der Krieg für Deutschland eine nega- tive Wende erfuhr, dürfte ebenfalls klar sein.
1.2. Das Militär in der Weimarer Republik
Aufgrund des Versailler Vertrags, der für die junge deutsche Republik ein 100.000 Mann-Heer vorsah, stellte sich die Frage der Wehrpflicht in der Weima- rer Republik nicht. Trotzdem ist die gesellschaftliche Stellung des Militärs zu die- ser Zeit eine Betrachtung wert, ebenso wie der Umgang mit dem Gebot aus die- sem Vertrag und dem weit verbreiteten Phänomen der Freikorps. Mehr noch als zur Kaiserzeit war das Heer in der Weimarer Republik ein Sam- melbecken für Adelige, die ihr politisches Betätigungsfeld und ihren Reichtum durch Abschaffung der Monarchie zu einem großen Teil verloren hatten. Entspre- chend herrschte im Militär reaktionäres Gedankengut vor. Die Wahl eines Solda- ten zum Reichspräsidenten, Hindenburg, zeigt, daß dieses reaktionäre und militä- rische Gedankengut auch in der Bevölkerung verankert war. Die „alte Schule“ des Kaiserreichs war noch nicht vergessen. Dabei ist zu bedenken, daß an den staatli- chen Stellen zu einem Großteil noch dieselben Leute saßen wie zur Zeit der Monarchie.10
Durch die Einführung des 100.000 Mann-Heeres arbeitslos gewordene Berufssol- daten rotteten sich in Freikorps zusammen, die nationalistischen und revisionisti- schen Charakter hatten. Die SS kann als in der Tradition dieser Freikorps stehend bezeichnet werden, erkennbar schon durch die fortlaufende Symbolik des Toten- kopfs.
Die Freikorps wurden Ende 1918 als Freiwilligenverbände gegründet, um im Bürgerkrieg in Deutschland zu kämpfen. Dies war ein Bruch mit der militärischen Tradition der Wehrpflicht.
„Den Kern der zahlreichen Freikorps sehr unterschiedlicher Größe, die nun entstanden, stellten vielfach Sturmkompanien aus Offizieren und Unteroffizieren dar. Auch von der Universität und den höheren Schulen, aus dem Wandervogel, aus dem Kleinbürgertum und aus der Bevölkerung der gefährdeten Grenzgebiete erhielten sie Zustrom. Für den Höhepunkt der Freikorpsbewegung Mitte März 1919 schätzte Groener ihre Zahl auf etwa 250000 Mann. [...] Einige wenige zuverlässige republikanische Wehren wurden in die
Freikorps eingegliedert. Ihnen standen auf der anderen Seite extrem konterrevolutionäre Korps gegenüber.“11
Diese letzteren behaupteten sich und trieben ihr Unwesen lange Zeit in der Wei- marer Republik. Sie spielten ihre Rolle während des Kapp-Putsches und des Hitlerputsches.12 Auf ähnliche Weise organisierten fast alle Parteien paramilitärische Verbände, nicht nur die Nationalsozialisten mit der SA und SS, sondern auch die bürgerlichen Parteien mit dem Reichsbanner. Nicht nur in Bezug auf die geographischen und wirtschaftlichen Verluste, sondern ebenfalls in Bezug auf das Militär wurde der Versailler Vertrag als „Versailler Diktat“ angesehen. Konservative Kräfte wollten die materielle Wehrlosigkeit durch eine geistig-moralische Aufrüstung des ganzen Volkes kompensieren, d.h., massive promilitärische Propaganda betreiben. Selbst Stimmen, die für einen „Volksbefreiungskrieg“ plädierten, wurden laut (ein solcher wäre aber aufgrund des Zahlenverhältnisses zwischen deutschem und benachbarten Heeren schon ein Ding der Unmöglichkeit). Es gab aber auch offensive Brüche des Versailler Ver- trags, eine illegale Aufrüstung („schwarze Reichswehr“).13
Trotz einer allgemeinen Differenz zwischen demokratischer Staatsordnung und eines auf Befehl und Gehorsam ausgerichteten Militärs14 (einem Gegensatz, der auch heute noch nicht ausgeräumt werden kann), verstärkt durch die Haltung der Gewerkschaften und der linken Parteien von Sozialdemokraten bis Kommunisten, läßt sich sagen, daß ein Großteil der Bevölkerung dem militärischen Bereich posi- tiv gegenüberstand:
„Ob der ‘Kyffhäuserbund’, der deutschen Kriegervereine oder der ‘Stahlhelm’-Bund der Frontsoldaten, ob ‘Jungdeutscher Orden’, Studentenverbindungen oder Offiziersverbände - so heterogen diese und ähnliche Gruppen auch organisiert und ausgerichtet sein moch- ten, sie alle einte ein antidemokratisches, antiliberales, weithin auch antisozialistisches Credo militaristischer Prägung. Für sie blieben die Streitkräfte ‘Erziehungsschule der Nation’[...]“15
Natürlich gab es in der Weimarer Zeit auch strikt antimilitaristische Stimmen. Stellvertretend sei hier aus Ernst Friedrichs „Krieg dem Kriege“ von 1924 zitiert:
„Weigert den Dienst! Erzieht die Kinder so, daß sie sich später weigern, Soldaten- und Kriegsdienste zu tun! [...] Das große und erhabne Beispiel konse- quenter Kriegsdienstverweigerer sei unser Vorbild. Sie haben lieber noch den Tod erlit- ten für ihr konsequentes ‘Nein’ als daß sie selbst zum Mörder wurden! ‘Ich will nicht!’“16
Als zweiter Vertreter der pazifistischen Bewegung in der Republik sei Carl von Ossietzky genannt. Ossietzky sprach vom „Primat des Militärischen in der Politik“. Dieses Primat war für ihn nur ein Kernstück eines weiterführenden Militarismus, in seinem Artikel „Volksentscheid“ - es ging hier um die Diskussion um den Bau des Panzerkreuzers A im Jahre 1928 - führt er aus, daß der Krieg „als vornehmstes politisches Mittel“ gelte und die Bejahung des Soldatentums „als die gelungene Höchstzüchtung aller menschlichen Tugenden“.17
1.3. Der Militarismus des Dritten Reichs
Nach dem Übergang von den ersten demokratischen Gehversuchen in Deutschland in die nationalsozialistische Diktatur stellte sich die Situation in Bezug auf das Militär als eine vollkommen andere dar. Was vorher Ausnahme war, nämlich Soldat zu sein, war nun für den deutschen Mann das normale, und, wollen wir den Begriff des Soldaten erweitern, auch für die Frau.
Zwei Jahre nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde das neue Wehrgesetz veröffentlicht, nach dem jeder deutsche Mann wehrpflichtig war: „’Wehrpflichtig sind alle Männer vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind [...]’(Wehrpflichtgesetz, §1, Absatz 1)“18 Zu diesem Wehrdienst gab es keine Alternative. Ebensowenig, wie es eine Alternative zur Hitlerjugend, zum Bund deutscher Mädel, zum Arbeitsdienst o.ä. gab. Die gesamte Bevölkerung des Deutschen Reiches, soweit sie nicht einer „rassischen“ Diskriminierung ausgesetzt war und infolge dessen nicht mehr als Bürger dieses Staates galten, hatte sich in ein System von Befehl und Gehorsam sowie Uniformiertheit einzuordnen. In diesem Sinne war nicht nur die Wehrmacht militärisch, sondern der gesamte Staat. Diesem System zu entkommen war für tärisch, sondern der gesamte Staat. Diesem System zu entkommen war für eine Einzelperson kaum möglich, wenn sie das Land nicht verlassen wollte oder bei Lebensgefahr in den Untergrund verschwinden wollte.
Diese Entwicklung zum Militarismus war der Wehrmacht wie auch ihrem Vorgänger, der Reichswehr, sehr recht, was ein Grund dafür war, daß Hitler sich trotz der Konkurrenz zwischen Militär und SA auf die Unterstützung des Heeres verlassen konnte. Schon die Reichswehr zur Zeit der Weimarer Republik beabsichtigte laut Gröner und Ludendorff eine „Heranziehung des Volkes von Jugend an“19 zur Wehrbereitschaft, dies ging bis zu einer „Militarisierung der Nation“20. Die vielen paramilitärischen Organisationen der NSDAP waren für die Reichswehr somit ein interessantes personelles „Wehrpotential“21.
Aus dieser Situation heraus entwickelte sich eine „Teilidentität der Ziele“ zwischen Wehrmacht und NSDAP, die sich auch im Zweiten Weltkrieg fortsetzte und, so die These Manfred Messerschmidts, ein Grund dafür war, daß der Anschlag der militärischen und monarchisch orientierten Opposition des Kreises um Stauffenberg zum Scheitern verurteilt war.22
Ab 1943 änderte sich diese Situation durch das abzusehende Ende des Krieges. Verweigerung des Dienstes in der Wehrmacht war zwar nach wie vor nicht möglich, aber die Zahl der Desertionen vermehrte sich, ebenso wie kritische Stimmen. Dies war ein Grund für die Partei, härtere Sanktionen zu ergreifen.
„Danach waren mit der Todesstrafe bedroht:
- Zweifel am Führer und am Endsieg,
- Äußerungen gegen die nationalsozialistische Weltanschauung,
- Zweifel an der Berechtigung des den Deutschen aufgezwungenen Lebenskampfes,
- Äußerungen mangelnden Vertrauens in die deutsche Kraft, den Angriffsgeist, der Truppe oder die Schlagkraft der deutschen Waffen,
- Verbreitung von Nachrichten über Kampfmüdigkeit,
- Erörterung der Möglichkeiten bei Verlust des Krieges,
- Behauptungen, daß der Bolschewismus ‘so schlimm’ nicht sei oder daß die Demokratie der westlichen Gegner in Erwägung gezogen werden könnte.
Dennoch schwollen die Zahlen der bekannten ‘Wehrkraftzersetzungsfälle’ an. 30.000 bis 40.000 kamen vor die Feldgerichte.“23
Trotz dieser hohen Zahlen und der ebenfalls hohen Zahl an Deserteuren kann die Wehrmacht bis zum Ende des NS-Regimes als Stütze desselben bezeichnet wer- den. Der deutsche Staat hatte somit eine höchst negative Erfahrung mit dem Mili- tär gemacht.
1.4. Die Anfänge der Bundeswehr in der Bundesrepublik Deutsch- land
Trotzdem gab es bald darauf in der neugegründeten Bundesrepublik Deutschland wieder eine Armee: Die Bundeswehr.
Ein Kriegsziel der Anti-Hitler-Koalition war es, Deutschland zu entwaffnen. Mit der Proklamation Nr. 2 des Alliierten Kontrollrates vom 20.9.1945 wurde den Deutschen jegliche militärische Betätigung verboten. Doch schon zwei Jahre später diskutierten die Alliierten im Zuge des sich abzeichnenden Ost-West-Konflikts eine Integration westdeutscher Streitkräfte. Prominente wie Rudolf Augstein, Eugen Kogon und Konrad Adenauer sprachen sich für eine solche Integration aus. Aber im Petersberg-Abkommen vom 22.11.1949 mußte die Bundesrepublik sich verpflichten, die Entmilitarisierung aufrechtzuerhalten.
Ab dem 10.10. 1950 wurde über eine Wiederbewaffnung nicht mehr über, sondern mit der Bundesrepublik verhandelt.
Bundeskanzler Adenauer wünschte, den Handlungsspielraum der jungen Repu- blik auszuweiten und setzte dabei auf das Konzept der Westintegration und, damit verbunden, auf die Wiederbewaffnung. Obwohl dies angesichts des gerade been- deten Krieges heftige Proteste von Opposition und Bevölkerung auslöste, wurde 1955 die Bundeswehr gegründet, parallel erfolgte die Aufnahme in die NATO und die Beendigung der Besatzung durch die Alliierten. Am 7.6.1955 wurde das Kriegsministerium gegründet, das ab dem 16.10. 1956 von Franz Josef Strauß geleitet wurde.24
Adenauer konnte sich hierbei trotz der Proteste, etwa von Seiten der evangeli- schen Kirche und engagierten Schriftstellern, wie z.B. Arno Schmidt, auf eine weitgehende Zustimmung der Wählerschaft stützen. Außerdem kam dieses Kon- zept den Westmächten aufgrund des sich verschärfenden Ost-West-Konflikts sehr gelegen.25
Ein antimilitaristisches Konzept für die Bundesrepublik Deutschland war somit gescheitert, trotz zahlreicher Argumente, wie etwa der Rolle des Militärs in der Weimarer Republik (als „Staat im Staate“) oder der Wehrmacht oder Konzepten der Neutralität im Ost-West-Konflikt. Deutschland hatte wieder ein Militär.
2. Die neue Bundeswehr
Seit Beginn der 90er hat die Bundeswehr eine Wende vollzogen. Mit dem Wegfall der Mauer und der Übernahme der DDR durch die Bundesrepublik, sowie dem offiziellen Ende des Ost-West-Konfliktes, und damit dem Wegfall des großen Feindbildes, auf das die Verteidigung aufgebaut war, ist die Bundeswehr in eine tiefe Legitimationskrise geraten. Dadurch hat sich vieles in der Bundeswehr grundlegend verändert, sie erfuhr und erfährt den größten Umbau in ihrer 40jährigen Geschichte. Davon betroffen sind alle Bereiche des Militärischen. Die- se Veränderungen aufzuzeigen ist notwendig, weil sich damit die Entscheidungs- grundlage zur totalen Kriegsdienstverweigerung gewandelt hat. Zwar wird auch auf die technischen, organisatorischen und finanziellen Aspekte eingegangen, vorrangig für unsere Betrachtung sind jedoch Fragen nach der Legitimation, den Aufgaben und der politischen Entwicklung der neuen Bundeswehr.
2.1 Struktur
Eine der bekanntesten Neuerungen dürfte wohl die Verkleinerung des Heeres auf ca. 340000 Mann in Friedenszeiten (370000 im Krieg) sein.26 Nach Statusgruppen gegliedert ergibt sich ein Verhältnis von 200000 Berufsoldaten und Soldaten auf Zeit zu 135000 Wehrdienstleistenden. Die wichtigste Umgestaltung innerhalb der neuen Bundeswehr ergibt sich aus der Unterteilung der Streitkräfte in verschiede- ne Streitkräftekategorien. Es gibt nunmehr die Hauptverteidigungskräfte (HVK), die Krisenreaktionskräfte (KRK) sowie die Militärische Grundorganisation (MGO). Theoretisch sollen die einzelnen Kategorien nicht scharf voneinander getrennt werden.27 In der Praxis läßt sich dieses jedoch wohl nicht immer vermei- den. Den Kategorien fallen folgende Aufgaben zu: Die HVK bilden, wie der Na- me schon sagt, das Rückgrat der Landes- und Bündnisverteidigung. Sie sind für die Sicherstellung der Mobilmachung und des Aufwuchses zuständig um das für ihren Zweck angemessene Kräftepotential bereitzustellen. Abgesehen von einem kleinen Teil ist ihr Bereitschaftsgrad geringer als Ende der 80er Jahre, was seinen Grund in der wesentlich verbesserten Sicherheitslage des bundesrepublikanischen Staatsgebietes hat.28 Die zweite Kategorie, die KRK haben nun eine Aufgabe zu erfüllen, die bislang nicht für die deutschen Streitkräfte vorgesehen war. Die Neu- formulierung der militärischen Interessen der BRD seit Generalinspekteur Nau- mann erforderte die Möglichkeit zur Führung, zu Verlegeoperationen und zur logistischen Unterstützung von Truppen über große Entfernungen außerhalb der zentraleuropäischen Region.29 Diese Fähigkeiten für Out-of-area-Einsätze werden die neu geschaffenen KRK (Umfang: 53600 Mann) haben. Mittels hochspeziali- sierter Ausbildung, bester Ausrüstung und neuester Großwaffensysteme werden sie zur Elite der deutschen Armee.30 Durch ihre Effizienz bedeutet die Verkleine- rung der Bundeswehr eben nicht eine Minderung ihrer Schlagkraft. Das Gegenteil ist der Fall. Die dritte Kategorie stellt die MGO dar. Sie hat einen ähnlichen Status wie die HVK. Ihre Aufgaben sind Unterstützung des Betriebes der Streitkräfte, Durchführung von Ausbildung und Versorgung, sowie Zivil-militärische Zusam- menarbeit. Teile der Fernmelde- und Sanitätseinheiten der MGO werden den KRK zugeordnet.31 Um ein Auseinanderdriften und die Entwicklung einer Zwei- Klassen-Armee zu verhindern solle die Streitkräftekategorien miteinander ver- zahnt werden. Je nach Teilstreitkräften gelingt dies unterschiedlich gut. Außerdem wird eine Vereinheitlichung der Ausbildung, der Austausch des Führungsperso- nals und eine einheitliche Ausrüstung der Soldaten angestrebt.32 Eine wirkliche Gleichstellung ist aber angesichts der Tatsache, daß die KRK einen Vorrang bei Investitionen,33 Ausbildung und Ausrüstung haben, nicht möglich und vermutlich auch nicht gewollt. So wird z.B. von Volker Ruhe die KRK als vorrangig betrach- tet.34 Die offensive Ausrichtung der neuen Kampftruppen manifestiert sich auch darin, daß UN-Einsätze nur noch vereinzelt und mit beschränktem Kontingent geplant sind, wogegen sie im Rahmen von NATO- und WEU-Einsätze voll zur Entfaltung kommen sollen.35 Innerhalb der neuen Elitetruppen wird es noch eine Speerspitze geben. Das 1000 Mann starke Kommando Spezialkräfte (KSK) ist in der Bundeswehr das, was die GSG 9 der Polizei ist. Offiziell für Aufgaben wie Befreiung deutscher ziviler Geiseln und Search & Rescue-Aufträge vorgesehen,36 läßt der Umfang jedoch auf ein umfangreicheres Aufgabenspektrum schließen. In der Tat soll das KSK noch vor dem KRK den Einsatz anderer Truppen vorberei- ten indem es tief in Feindgebiet vordringt und Kommunikations- und Verkehrs- netze des Feindes bekämpft. Geiselbefreiungen werden wohl eher den Zweck der Imageaufbesserung haben.37
2.2 Finanzierung
Für die effektive Neuorientierung der deutschen Armee ist es notwendig weitere Etatkürzungen zu verhindern. Von einem Jahresetat von ca. 68 Mrd. Mark war man 1995 bei knapp 48 Mrd. Mark angelangt.38 Um die fortlaufenden Kürzungen zu verhindern drohte Rühe mit Konsequenzen wie Streichung des Eurofighters und des deutsch-französischen Spionagesatelliten Helios 2/ Horus39. Letzteres setzte der Verteidigungsminister auch in die Tat um.40 Der militärisch- industrielle-politische Komplex, vor allem der Rüstungskonzern Daimler-Benz Aerospace, erzeugten zusätzlich Druck um weitere Kürzungen zu verhindern. Der Abwärtstrend ist mittlerweile gestoppt worden. 0,4 Mrd. mehr pro Jahr soll der Verteidigungsetat betragen.41 Problematisch für das Ziel, die Bundeswehr für Out- of-area-Einsätze „fit“ zu machen, war das Absinken des investiven Anteils des Finanzpotentials auf 22 %. Der Rest wurde für Fixkosten, wie Sold u. ä., benötigt, bei welchen auch nur wenig Einsparungsmöglichkeiten vorhanden. Aber allein um eine Armee modern zu halten ist ein Anteil von 30 % notwendig.42 Um den Investitionsanteil auf ein geeignetes Maß zurückzubringen wurde die Armee in Friedenszeiten von 370000 auf 340000 Mann verkleinert und ein umfassendes Rationalisierungsprogramm gestartet.43 Trotz aller Finanznot sollen bis 2015 150 Mrd. DM für die Beschaffung neuer Waffensysteme ausgegeben werden.44 KRK- Einheiten werden bei der Ausrüstung gegenüber den HVK bevorzugt, wenn nicht qualitativ, so doch wenigstens zeitlich. Mit dem Hinweis, daß Rüstungsprodukti- on und -export Arbeitsplätze bringen, läßt sich zumeist auch die SPD zur Zu- stimmung zur Beschaffung neuer Waffensysteme bringen.45 Die veralteten Waf- fen lassen sich gewinnbringend verkaufen. So werden deutsche Krisenreaktions- kräfte des öfteren auf deutsche Waffen bei ihren Feinden stoßen, die aber tech- nisch weit unterlegen sind. hen erfahren hat, wohl einen größeren Erfolg dar als die Bekämpfung des Hochwassers selbst. Für die Naturkatastrophenbekämpfung braucht es jedenfalls keine bewaffnete Armee.
2.3 Neue Aufgaben / Erweiterung der bundesdeutschen Interessen
Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks schien die Bundeswehr überflüssig ge- worden zu sein. Zumindest aber war sie für ihren ehemaligen Zweck, die Landes- verteidigung, viel zu groß und überpräsent. Um diese Legitimitätskrise zu über- stehen, mußten schnell neue Ziele gefunden bzw. welche, für deren Berücksichti- gung bisher nicht die Möglichkeit bestand, populär gemacht werden. Das Auswär- tige Amt war nicht in der Lage zivile Konzepte für die Außenpolitik zu erarbeiten. In der Phase der Orientierungslosigkeit entwickelte der Generalinspekteur Nau- mann die entsprechenden militärischen Konzepte. Sein Einfluß auf die Verteidi- gungspolitik war unter dem Verteidigungsminister Stoltenberg 1990 erheblich ausgeweitet worden, nachdem zwanzig Jahre zuvor Helmut Schmidt die Macht eines Generalinspekteurs bewußt eingeschränkt hatte, um das Primat der Politik gegenüber dem Primat des Militärs durchzusetzen.46 Naumann entwickelte nun 1991 in seinem unverbindlichen Strategie-Papier jene Neudefinition der vitalen Interessen der Bundesrepublik, welche die Grundlage für die Verteidigungspoliti- schen Richtlinien von 1992 von Volker Rühe bildeten.47 Das Weißbuch 1994 der Bundeswehr brachte nahezu die gleichen Inhalte, nur in einer gemäßigten Aus- drucksweise um eine öffentlichkeitswirksame Vermittlung zu ermöglichen.48 Als Interessen der BRD die mit militärischen Mitteln gesichert werden müssen, gelten damit auch die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des Zugangs zu strategischen Rohstoffen49. Im Weißbuch ist lediglich von der Erhaltung einer gerechten marktwirtschaftlichen Weltwirtschaftsordnung die Rede.50 Risiken in der neuen Weltordnung sind nicht mehr groß angelegte Aggressionen, sondern vielmehr regionale Krisen und Konflikte, die die Stabilität der internationalen Ordnung gefährden und sogar zu einer direkten militärischen Bedrohung Deutsch- lands, Europas oder seiner Peripherie werden können.51 Wie weit der Begriff der Peripherie gefaßt wird läßt sich am vitalen Interesse der BRD am Weltmarkt able- sen. Zumindest also müssen sämtliche erdölfördernden Länder mit einbezogen werden. Daß dies der Fall ist hat der Golfkrieg Anfang der 90er eindrucksvoll bewiesen. Aus diesen „neuen“ Bedingungen für die deutsche Verteidigungspolitik ergeben sich natürlich Notwendigkeiten hinsichtlich der Neudefinierung der Auf- gaben der Bundeswehr und der konzeptionellen Weiterentwicklung der Streitkräf- te. Es geht eben nicht mehr nur alleine um die Fähigkeit zu umfassenden Vertei- digung des Staatsgebietes und seiner Einwohner, sondern um „flexible Krisen- und Konfliktbewältigung im erweiterten geographischen Umfeld“52. Die für diese Aufgabe erforderlichen Fähigkeiten hatte die Bundeswehr bislang nicht. Verbes- serungen der Führungsfähigkeit, strategischen Verlegefähigkeit, Luftverteidi- gungsfähigkeit sowie der teilstreitkräfteübergreifenden operativ-taktischen Füh- rungsfähigkeit waren notwendig.53 Der dazu erforderliche Modernisierungsgrad sollte am „technologischen Standard der Kräfte im erweiterten geographischen Umfeld sowie am deutschen Selbstbild als moderner Industriestaat“54 gemessen werden. Die Kategorisierung in HVK und KRK war eine Folge dieser Leitlinie. Ausbildung, Ausrüstung, Flexibilität und Mobilität der wichtigeren Krisenreakti- onskräfte mußten den neuen Anforderungen des Einsatzes Out-of-area gerecht werden.
2.4 Verfassungsänderung ohne Verfassungsmehrheit
Im Folgenden soll gezeigt werden, wie die Überlegungen und Konzepte der mili- tärischen Führung sowie des Verteidigungsministeriums zur rechtmäßigen Grund- lage der neuen Verteidigungspolitik wurden. Wie schon erwähnt wurde, war die Regierung unfähig nach dem Ende des Kalten Krieges ein ziviles Konzept für die neue Weltwirtschaftsordnung zu erarbeiten. Die Taktik der militärischen Vorden- ker bestand nun darin, die eigentlich notwendige Verfassungsänderung für einen Einsatz deutscher Truppen außerhalb des Bündnisgebietes, stufenweise herbeizu- führen. Bis der erste Militäreinsatz Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg durchgeführt wurde, gab es schon über 130 Hilfseinsätze in 53 Ländern.55 In der Bevölkerung fand sich eine breite Mehrheit, die diese Einsätze unterstützte, zumal es sich in der Tat um humanitäre Hilfsaktionen gehandelte. Militärische Handlun- gen der BRD beschränkten sich zu dieser Zeit noch auf Ausstattungs- und Mili- tärhilfe und finanzielle Unterstützung der kriegführenden Verbündeten.56 In der folgenden Zeit wurden die Einsätze immer häufiger und der nichtmilitärische Charakter ging langsam zurück. Diese schleichende Entwicklung ging niemals so offensiv vor sich, daß größere Teile der Bevölkerung das Ziel der Richtung er- kannt hätten. Der erste Out-of-area-Einsatz der Bundeswehr war das Minenräu- men im Persischen Golf im Sommer 1991.57 Im folgenden ist es möglich alle Ein- sätze der Bundeswehr aufzuführen, es soll sich hier aber auf die Einsätze im ehe- maligen Jugoslawien beschränkt werden, da sich an ihnen sehr explizit die Ten- denz zum „richtigen“ Militäreinsatz nachweisen läßt. Zunächst unterstützte die Bundeswehr mit Transall-Maschinen die Luftbrücke nach Sarajevo ab Sommer 1992. Der nächste Schritt war dann die Überwachung des UN-Embargos gegen Serbien und Montenegro mit Schiffen der Bundesmarine. Ab Frühling 1993 flo- gen deutsche Soldaten, nachdem sich Deutschland offiziell dazu hatte auffordern lassen, Awacs-Überwachungsflüge unter dem Vorwand, diese Flüge seien nicht ohne deutsche Beteiligung durchzuführen. Interessanterweise wurden diese Flüge zuvor aber ausschließlich von der Royal Air Force durchgeführt.58 Der nächste Schritt der Entwicklung war dann der Beschluß deutsche Tornado- Kampfflugzeuge zum Schutz von Bodentruppen einzusetzen.59 Entgegen des Beschlusses wurden dann aber deutsche Flugzeuge sogar zur Unterstützung von NATO-Bombardements eingesetzt. Der Regierungsbeschluß, KRK-Einheiten, und damit reguläre Kampftruppen, im Rahmen von IFOR II in ein Krisengebiet zu schicken bildet den vorläufigen Abschluß dieser Entwicklung.60 Dadurch, daß die Regierung in dieser Hinsicht Tatsachen geschaffen hat, wurde die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Prinzip schon vorweggenommen. Am 12. Juli 1994 entschied das BVG, daß Einsätze im Rahmen eines Systems kollektiver Si- cherheit verfassungskonform seien. Dazu zählten nach Ansicht des Gerichtes auch Einsätze im Rahmen von NATO und WEU.61 Nach diesem Beschluß sind Out-of- area-Einsätze der Bundeswehr dann zulässig, wenn der Bundestag mit der einfa- chen Mehrheit zustimmt. Paradoxerweise braucht die Feststellung, daß die BRD sich im Verteidigungsfall befindet und sich militärisch dagegen verteidigen darf, laut Artikel 115a Abs. 1 GG eine Zweidrittelmehrheit des Bundestages und die Zustimmung des Bundesrates, während die Entscheidung Krisenreaktionskräfte in einen Einsatz außerhalb des Bündnisgebietes zu schicken nur die einfache Regie- rungsmehrheit benötigt.
3. Kritik des Zivildienstes
Die Frage des Zivildienstes und seiner Ablehnung spielt im Gerichtsprozeß des totalen Kriegsdienstverweigerers eine große Rolle. Da die Ablehnung des Kriegs- dienstes mit der Waffe heutzutage juristisch und gesellschaftlich kein Problem mehr ist, liegt der Begründungsschwerpunkt auf der Verweigerung des Zivildiens- tes.62 Daher sollen als nächstes die Gründe der totalen Kriegsdienstverweigerer für die Ablehnung des zivilen Ersatzdienstes erläutert werden. Diese Frage dürfte für die gesamte Öffentlichkeit interessant sein, zumal der Zivildienst eine wesent- lich bessere Reputation bekommen hat und bei vielen als sinnvolle und für die Aufrechterhaltung unseres Sozialsystems notwendige, sowie als scheinbar friedli- che oder sogar friedenspolitische Alternative zum Wehrdienst Anerkennung fin- det.
Daß dem nicht so ist, darüber sind sich politische Totalverweigerer weitgehend einig. Es soll im folgenden gezeigt werden, wieso es in Deutschland keine Mög- lichkeit zur Kriegsdienstverweigerung im eigentlichen Sinne gibt, da Ersatzdienst geleistet werden muß, warum dieser keine echte Alternative darstellt, sondern sogar eine Art von Kriegsdienst sein kann oder diesem wenigstens zuspielt, und dadurch kontraproduktiv im Sinne der Kriegsdienstverweigerung, Friedenserhal- tung und der Abschaffung von Wehrpflicht und Zwangsdiensten ist oder einge- schätzt wird.
3.1 Verweigerung des Wehrdienstes nach Art. 4 Abs. 3 GG
Gemäß Art. 4 Abs. 3 des Grundgesetzes darf niemand „gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.“ Dies ist der Artikel auf den sich alle Antragsteller auf Wehrdienstverweigerung berufen. Was sich zunächst gut und demokratisch anhört enthält jedoch zumindest zwei Aspekte derer Kritik es bedarf.
Zunächst geht es um die Bestimmung des Gewissens. Gewissen ist nicht objektiv bestimmbar. Nach der Rechtsprechung der Bundesgerichte allerdings ist unter Gewissen „ein real erfahrbares seelisches Phänomen zu verstehen, dessen Forde- rungen, Mahnungen und Warnungen für den Menschen unmittelbar evidente Ge- bote unbedingten Sollens sind.“63 Der Staat maßt sich hier an, das Gewissen des jeweiligen Antragstellers hinreichend beurteilen zu können, um zu entscheiden ob seinem Antrag stattgegeben werden kann oder nicht. Durch die Subjektivität des Gewissens kann auch eine Veränderung des Entscheidungsverfahrens hier keine Abhilfe schaffen. Dank dieses schwammigen Kriteriums bleibt dem Staat die Möglichkeit zur Manipulation. Theoretisch muß nur so vielen Anträgen stattgege- ben werden, daß die Sollstärke der Bundeswehr gesichert bleibt. In den Anfangs- zeiten der Kriegsdienstverweigerung, als das Anerkennungsverfahren noch die Befragung, der Antragsteller beinhaltete, war die Anerkennungsquote wesentlich niedriger als heutzutage. Mittlerweile ist es im Prinzip jedem ohne großen Auf- wand möglich den Dienst mit der Waffe zu verweigern. Andererseits werden an- gesichts der hohen und ständig weitersteigenden Verweigerungszahlen64 aus den Reihen der konservativen Parteien Stimmen laut, die den Maßstab für die Aner- kennung als Kriegsdienstverweigerer wieder höher anlegen wollen. Desweiteren soll die Entscheidung gegen die Bundeswehr durch Reduzierung der relevanten Verweigerungsmotivation auf Gewissensgründe entpolitisiert werden. Hierdurch wird keine Kritik an der Bundeswehr zugelassen, die Bildung organisierter Zu- sammenarbeit der Zivildienstleistenden zur Vertretung ihrer politischen Interessen erschwert bzw. durch das Verbot politischer Betätigung während des Dienstes kriminalisiert.65 Der Einzelne wird somit politisch isoliert.
Der zweite strittige Punkt ist die ausdrückliche Formulierung, daß nur der Kriegs- dienst mit der Waffe verweigert werden kann. Allgemein nehmen Antragsteller an sie würden den Kriegsdienst verweigern. Aus der Formulierung des Gesetzestex- tes muß jedoch gefolgert werden, daß auch ein Kriegsdienst ohne Waffe exis- tiert66, zu dem man auch gezwungen werden kann.67 Angesichts dessen ist es wohl nicht zutreffend im Zusammenhang von Art. 4 Abs. 3 GG von der Möglich- keit zur Kriegsdienstverweigerung zu sprechen. Daß der Ersatz- oder Zivildienst nichts anderes als dieser Kriegsdienst ohne Waffe ist, soll im folgenden darge- stellt werden.
Allgemein bleibt noch festzustellen, daß das sogenannte Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung das einzige Grundrecht ist, dessen Inanspruchnahme von einer Ersatzleistung abhängig gemacht wird.68
3.2 Zivildienst als ziviler Kriegsdienst
Daß der aus Prestigegründen zum Zivildienst umbenannte Ersatzdienst ein Kriegsdienst ist, manifestiert sich in mehreren Punkten. Direkt als Kriegsdienst erkennbar war Zivildienst zu Zeiten als Zivildienstleistende noch bei Manövern der Bundeswehr für Handlangeraufgaben69 eingebunden wurden. Das ZDL für den Verteidigungsfall in die zivile Verteidigung eingeplant sind läßt sich z.B. im Zivildienstgesetz nachlesen. Gemäß § 79 Abs. 1 ZDG wird der Wehr- dienst im Verteidigungsfall zum unbefristeten Wehrdienst. Hieran läßt sich klar klar erkennen, daß ZDL offensichtlich zur Landesverteidigung benötigt werden bzw. wenigstens eingesetzt werden sollen. Ganz deutlich wird die kriegsunterstützende Funktion von ZDL im Plan der Gesamtverteidigung. Die Aufgaben der zivilen Verteidigung, und somit der ZDL70, als eine der beiden Säulen der Gesamtverteidigung, „zielen im wesentlichen darauf ab,
- die Staats- und Regierungsfunktionen aufrechtzuerhalten;
- die Zivilbevölkerung zu schützen;
- die Zivilbevölkerung und die Streitkräfte zu versorgen;
- die Streitkräfte mit zivilen Gütern und Leistungen unmittelbar zu unterstützen.“71
Die zivile Hälfte des Konzepts zur Gesamtverteidigung soll durch die Planung, Vorbereitung und Durchführung aller entsprechender zivilen Maßnahmen die Herstellung und Aufrechterhaltung der Verteidigungsfähigkeit gewährleisten.72 Die maßgebliche Einplanung und Einbeziehung von ZDL macht deutlich, wie wenig der Zivildienst Friedensdienst ist und wie nah er dem Kriegsdienst mit der Waffe steht.
3.3 Der militärische Charakter des Zivildienstes
Eine weiterer Aspekt des Zivildienstes der zur Ablehnung durch politische Total- verweigerer führt, ist dessen militärischer Charakter. Dieser drückt sich bei- spielsweise in antidemokratischen Strukturen im Dienstverhältnis aus. Da ist zum einen das Befehls-Gehorsams-Prinzip. Dienstlichen Anordnungen, juristisch als Kommando interpretiert, muß unbedingt Folge geleistet werden. Dafür sorgen Disziplinar- und Strafbestimmungen.73 Im allgemeinen Dienstbetrieb wird diese Systematik wohl kaum wahrgenommen werden. In ihrem Wesen ist diese aber militärisch und unter Beachtung der militärischen Tradition in Deutschland und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß es Vorgesetzten gesetzlich erlaubt ist alle Unterstützungsleistungen zu befehlen, die nicht den direkten Waffengebrauch voraussetzen, wird der militärische Charakter klar.74 Statt einer verantwortungs- bewußten Erfüllung der ihm anvertrauten Aufgaben, häufig Pflege und Betreuung von Personen, wird dem ZDL die Eigenverantwortung für sein Handeln entzo- gen.75
Dazu kommen Grundrechtseinschränkungen, die den Bereich der persönlichen Entfaltungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit, der Meinungsfreiheit und des Petitionsrechtes.76
Auffällig sind in dieser Hinsicht Parallelismen zwischen ZDG und Soldatenge- setz, Wehrstrafgesetz und anderen Wehrgesetzen.77 Hier werden die Gleichen Vorschriften auf nicht Vergleichbares angewandt. Exemplarisch soll hier die Dienst- bzw. Fahnenflucht genannt werden. „Kann z. B. die harte Bestrafung der Fahnenflucht bei einer auf der mechanischen Einübung und Rezeption von Befehl und Gehorsam basierenden Armee noch in etwa begründet werden, so verliert die gleiche Strafvorschrift, angewendet auf das Verlassen des Ersatzdienstes vollends ihren Sinn“78
Eine weitere Parallele findet sich in der Wehr- bzw. Zivildienstüberwachung79, die die ständige Verfügbarkeit der ZDL garantiert. Hierin wird auch noch einmal die Bedeutung des Zivildienstes innerhalb der militärischen Kriegsplanung deut- lich.80
Der Grund für diese Ausrichtung des Zivildienstes ist zum einen seine Funktion als Kriegsdienst ohne Waffe, die er als „Wurmfortsatz der Militärpolitik“81 hat, zum anderen soll sie eine Abschreckung der Wehrpflichtigen vor der Kriegsdienstverweigerung sein.
3.4 Erhaltung und Anerkennung der Wehrpflicht durch den Zivil- dienst
Daß der Zivildienst, und seine Anerkennung, eine gewichtige Rolle bei der Erhal- tung der Wehrpflicht spielen ist unter totalen Kriegsdienstverweigerern unbestrit- ten.
Durch den Ersatzdienst soll der Wehrgerechtigkeit genüge getan werden. Würde für Kriegsdienstverweigerer, die gemäß Art. 4 Abs. 3 GG den Kriegsdienst mit der Waffe verweigern, der Wehrdienst ohne jeglichen Ersatz entfallen, würden sich in der Bundeswehr dienende Wehrpflichtige ungerecht behandelt fühlen. Dieses würde logischerweise innerhalb kurzer Zeit den Wegfall sämtlicher Wehr- pflichtiger für die Armee bedeuten. In dieser Angelegenheit den Begriff der Ge- rechtigkeit zu verwenden ist allerdings mehr als bedenklich. Schließlich wird eine ungerechte Sache nicht dadurch gerechter, daß sie allen in gleichem Maße angetan wird.82
Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Wehrpflicht nicht nur durch den Wehrdienst son- dern auch durch den Zivildienst erfüllt. Der Zivildienst ist eine Art der Erfüllung der Wehrpflicht und wird als Normabweichung geduldet. Hier liegt das Hauptar- gument für die Ablehnung des Zivildienstes durch die Totalverweigerer, denn im Bereich des Zivildienstes ist nur eine Erfüllung der Wehrpflicht möglich. Genau das Gegenteil ist aber gewollt, nämlich Bekämpfung. Dabei ist, laut Christian Herz, bei vielen ZDL zu beobachten, daß sie gar nicht um den Zusammenhang von Zivildienst und Erfüllung der Wehrpflicht wissen. Außerdem verstünden sich viele als Zivildienstleistende und nicht als Kriegsdienstverweigerer.83 Wer also den Zivildienst anerkennt, erkennt auch die Wehrpflicht an und ist damit einer Fundamentalkritik am Militarismus nicht mehr fähig, welche, in großen Maßstab betrieben, durchaus gefährlich für das Militär werden könnte.
Außer der Wehrpflicht wird mit dem Zivildienst auch ein Zwangsdienst anerkannt, der zur Aufrechterhaltung der Disziplin dient und, durch die Nachteile z.B. in Bezug auf die Länge des Dienstes, Strafcharakter hat.84 Während die totale Kriegsdienstverweigerung auf die Entmilitarisierung der Gesellschaft zielt, steuert der zivile Ersatzdienst dem entgegen.
Außerdem hat der Zivildienst eine legitimierende Wirkung auf die Wehrpflicht. In Unkenntnis der Zusammenhänge genießt der soziale Dienst der ZDL in weiten
Teilen der Gesellschaft ein hohes Ansehen. Dieses und das fälschlicherweise für eine Tatsache gehaltene Gerücht, der Zivildienst sei für die Erhaltung des Sozialsystems notwendig schaffen der Wehrpflicht eine höhere Legitimationsbasis. Die Schlußfolgerung aus oben genannten Sachverhalten ist einfach zusammenzufassen: ohne die Existenz eines derart ausgerichteten Ersatzdienstes gäbe es die Wehrpflicht vermutlich nicht mehr.
3.5 Friedenspolitischer Anspruch und politische Realität der ZDL
Die Auswahl der Dienstplätze steht in keinem Verhältnis zur Gewissensentschei- dung und zum politischen Selbstverständnis der ZDL. Die Dienste sind, im Ideal- fall, soziale und humane Dienste, leisten aber in keiner Weise einen konstruktiven Beitrag zur Friedenssicherung.85 Dies würde als Kritik am Militarismus und am System der Landesverteidigung gesehen, die natürlich nicht erwünscht ist. Dementsprechend wurden auch so gut wie nie Dienststellen in kritischen Bereichen zugelassen.86 Der Ersatzdienst war und ist immer nur ein Arbeitsdienst, der nützlich für die Herrschenden sein soll und von daher unpolitisch zu sein hat. Die ZDL werden durch die Konzeption des Zivildienstes auf ein „gesellschaftliches Abstellgleis“87 befördert, wo sie, von der Gesellschaft isoliert, von den politischen Konsequenzen ihrer Kriegsdienstverweigerung ferngehalten werden. Als billige Arbeitskräfte füllen sie Lücken im staatlichen Sozialsystem und werden somit zur Aufrechterhaltung von Verhältnissen benutzt, denen sie eigentlich entgegenstehen sollten.88
4. Motive für die totale Kriegsdienstverweigerung
Um die Motive für eine totale Kriegsdienstverweigerung nachzuvollziehen, soll erst die gesetzliche Lage betrachtet werden.
Artikel 4, Absatz 3 des Grundgesetzes besagt: „Niemand darf gegen sein Gewis- sen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. [...]“89 Hesselberger bezeichnet dieses Recht als ein subjektiv-öffentliches, das zwangsläufig aus Art. 4, Abs. 1 des GG, das die Unverletzlichkeit des Gewissens garantiert, hervorgeht. Er betont ausdrücklich, daß es sich um eine Kriegswaffendienstverweigerung han- delt.90 Das Gewissen ist nicht so weit geschützt, daß eine situationsbedingte Ver- weigerung, etwa der Dienst in einem bestimmten Krieg oder einer bestimmten Waffe verweigert werden kann.91 Ebenfalls ist bei der Einberufung zum Ersatz- dienst die Berufung auf die Gewissensfreiheit gesetzlich nicht legitimiert.92
Durch Art. 12a ist die Berufspflicht hiermit eingeschränkt, denn auch Wehrpflichtige, die nicht zu den Streitkräften eingezogen werden, können zu zivilen Dienstleistungen herangezogen werden. Im folgenden zählt Hesselberger die einzelnen Verpflichtungsmöglichkeiten auf:
„a) Verpflichtung in Arbeits- oder Dienstverhältnisse beim zivilen Hilfspersonal der Streitkräfte oder bei Versorgungseinrichtungen der Streitkräfte,
b) Verpflichtung in Arbeits- oder Dienstverhältnisse bei der öffentlichen Verwaltung,
c) Verpflichtung in Arbeitsverhältnisse zur Versorgung der Zivilbevölkerung, [...].“93
Zur allgemeinen Wehrpflicht ist außerdem noch erwähnenswert, daß sie auch nach dem Grundgesetz keineswegs zwingende Notwendigkeit ist, ebenso steht die Option offen, die Verteidigung durch eine Freiwilligenarmee zu gewährleisten. Hesselberger betont aber eindeutig, daß die Wehrpflicht nicht gegen die Menschenwürde oder andere Grundlagen des verfassungsrechtlichen Wertsystems verstieße.94 Daraus ließe sich folgern, daß totale Kriegsdienstverweigerer ihre Verweigerung auf ein anderes Wertesystem aufbauen.
So schreibt Otto Kirchheimer dann auch: „Im Gegensatz zu dem Hegelschen Schluß, daß der Täter im Akt der Gesetzesverletzung die gesellschaftlichen Gesetze implizit an- erkenne, stellt der aus politischer Überzeugung handelnde Täter seine eigene Wertord- nung, aus der seine Handlung erwächst, dem offiziell anerkannten System entgegen.“95 Christian Herz stellt fest, daß es so wenig „den“ Totalverweigerer gibt wie „die“ Begründung für eine Totalverweigerung.96. Er unterscheidet als Motivationen die politische, die anarchistische, die pazifistische und die religiöse.97 Im Vorwort der Ausgabe seines Buches von 1995 schreiben Wolf-Dieter Narr und Klaus Vack, totalverweigern könnte nur „ein überzeugter, [...] ein in sich gefestigter und ande- re immer neu überzeugender Pazifist/Antimilitarist tun. Darum ist die Totalver- weigerung ein politischer Akt.“98 Der Akt der Totalverweigerung ist aber immer auch eine individuelle Entscheidung, aufgrund derer mit persönlichen Konse- quenzen zu rechnen ist und die daher aus individuellen Erwägungen entschieden werden muß.
Der politische und der individuelle Aspekt sind bei einer Totalverweigerung also grundsätzlich vorhanden. Als Teilgebiet des Politischen kommt hier im Sonderfall noch die religiöse Motivation hinzu. Die Schriften Tolstois etwa zeigen exempla- risch, wie politische und religiöse Motivation für einen Antimilitarismus sich ergänzen können.
4.2 Religiöse Gründe für die Totalverweigerung
Neuere Übersetzungen der Bibel enthalten als das 5. Gebot die Aussage „Du sollst nicht morden.“ anstatt der älteren Übersetzung „Du sollst nicht töten.“ Durch diese Unterscheidung von Morden und Töten legitimiert sich auch für Christen der Kriegsdienst, da das Töten im Krieg vom Morden differenziert wird. Nicht alle Christen erkennen diese neue Übersetzung jedoch an, und verurteilen das Töten im Krieg ebenso wie den Mord. Selbst wenn das Töten im Fall der konkreten Selbstverteidigung als Möglichkeit in Betracht gezogen wird, so doch nicht das Töten, um ein Abstraktum wie Staat oder Demokratie zu verteidigen. So kann eine Totalverweigerung zum Beispiel auf christlicher Grundlage entstehen.
Einen Sonderfall stellen die „Zeugen Jehovas“ dar. Da sie aus ihrem Glauben heraus jede politische Tätigkeit und jede Tätigkeit für einen Staat ablehnen, kommt für sie auch der Kriegsdienst nicht in Betracht.
Da der Fall einer durch Angehörigkeit dieser Religion motivierte Totalverweigerung äußerst häufig wurde, gilt für die „Zeugen Jehovas“ eine Sonderregelung: Wenn sie einen freiwilligen Dienst in einer öffentlichen Einrichtung, etwa einem Krankenhaus leisten, werden sie vom Kriegsdienst befreit.
Da in der christlichen Religion der Kriegsdienst jedoch nicht von den jeweiligen Autoritäten im hierarchischen Aufbau der Kirchen verurteilt wird, gibt es eine entsprechende Regelung für Totalverweigerer aus christlicher Motivation nicht. Auch aus der Vergangenheit sind Verweigerungen bestimmter Glaubensgruppen bekannt:
„Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer war im Deutschen Kaiserreich vor 1914 über- haupt äußerst gering, bei den gerichtlich sanktionierten Fällen handelte es sich meist um Angehörige pazifistischer Glaubensgemeinschaften wie der Mennoniten oder Adventis- ten.“99
4.2 Die Totalverweigerung als politischer Akt
Ähnlich wie bei den „Zeugen Jehovas“ kann eine Totalverweigerung auch politisch aus der absoluten Ablehnung des Staates oder der parlamentarischen Demokratie (bzw. der jeweiligen Staatsform) motiviert sein, etwa bei Anarchisten. Warum sollte ein Anarchist einen Staat verteidigen, den er in seiner Grundform ablehnt? Antimilitarismus - und Totalverweigerung als praktizierte Form desselben - gehen bei sozialistisch geprägten Menschen selbstverständlich einher mit einem entsprechenden politischen Engagement in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Jeglicher Totalverweigerung liegt ein Pazifismus oder Antimilitarismus zugrunde, egal ob dieser ideologisch motiviert ist oder nicht.
Ein Totalverweigerer sieht keine natürliche oder notwendige Notwehrpflicht, und infolgedessen keine Notwendigkeit für eine Befehls/Gehorsams-System.100 Auch dieses Wertesystem, das innerhalb des Militärs und der dieses befürwortende Schichten vorherrscht, bekämpft der Totalverweigerer.
Politisch wird der Akt dadurch, daß er nicht geheimgehalten wird. Laut Christian Herz ist es keine Totalverweigerung, sich durch Ausreden vor der Musterung oder dem Einberufungsbefehl zu drücken, sondern nur die nicht verheimlichte Weigerung, dem Musterungs- oder Einberufungsbefehl nachzukommen, im Wissen um die rechtlichen Konsequenzen.101
In diesem Sinne ist die Totalverweigerung ein öffentlicher Akt, da der Totalver- weigerer damit kalkuliert, daß sein Verhalten offenbar wird, ebenso wie dessen Sanktionierung, um somit die Mißstände des Militärs und der Rechtsprechung in die Diskussion zu bringen. Im Normalfall ist die Totalverweigerung ausführlich begründet, und bietet somit auch weiteren Antimilitaristen eine Diskussionsgrund- lage.102
Ein Beispiel für die Öffentlichkeitsschaffung der Totalverweigerungsdiskussion war der offene Brief der Gruppe „Flammende Herzen“103, die nach einem An- schlag auf eine Musterungsstelle sämtliche dort erfaßten Wehrpflichtigen mit die- sem Schreiben dazu aufforderten, sich die Entscheidung Wehr- und Zivildienst bewußt zu überlegen und auch die Möglichkeit der Totalverweigerung - nach ei- ner Schilderung möglicher Gründe und auch möglicher Sanktionen - in Betracht zu ziehen.
4.3 Die Totalverweigerung als individueller Akt
Neben dem politischen ist aber auch der individuelle Aspekt einer Totalverweigerung zu betrachten.
Der Schritt, den Kriegsdienst total zu verweigern, hat in den meisten Fällen schwerwiegende juristische Konsequenzen, die ein Leben lang mit sich zu tragen sind. Juristisch, so Christian Herz sind Totalverweigerer fahnenflüchtig.104 Verweigern sie den Zivildienst, gelten sie zwar juristisch nicht als fahnenflüchtig, die juristischen Folgen sind aber ähnlich. Abgesehen von wenigen Ausnahmen sind die meisten Totalverweigerer zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden.
Allein darum schon muß der Schritt der Totalverweigerung einer gut durchdach- ten individuellen Entscheidung entspringen. Es sind aber auch die jeweiligen Be- gründungen, die den Akt der Totalverweigerung zu einem persönlichen werden lassen. Oftmals sind es z. B. Erfahrungen des Krieges in der Familie oder die in- dividuelle Sozialisation des Verweigerers, die ihn zu einer solchen Entscheidung motivieren.
Die Entscheidung, ob Kriegsdienst mit oder ohne Waffe oder Totalverweigerung, kann dem Betroffenen niemand abnehmen. Politische und juristische Pro- und Contra-Argumente können zwar von außen an jemanden herangetragen werden, die endgültige Entscheidung aber trägt die betroffene Person.
Schluß
Die Geschichte des Militärs in Deutschland, wie wir sie hier nachgezeichnet haben, macht deutlich, daß das Militär in Hort autoritären und undemokratischen Gedankenguts ist. Gerade deutsche Armeen sozialisierten ihre Angehörigen in diese Richtung. Diese Geschichte ist noch nicht vorbei, wie die jüngsten Rückfälle in den Rechtsextremismus zeigen.
Nach vierzig Jahren der Unterbrechung sind deutsche Truppen wieder auf interna- tionalen Kriegsschauplätzen anzutreffen. Daß es sich hierbei nicht nur um huma- nitäre Hilfsaktionen handelt wird nicht mehr geleugnet. Vitale Interessen der Bundesrepublik gilt es in der ganzen Welt wahrzunehmen. Damit steht die Bun- deswehr in guter Tradition aller ihrer Vorgängerorganisationen. Insofern ist der Wunsch demokratisch denkender Menschen, sich der Armee vollständig zu ent- ziehen, nur allzu verständlich. Daß Zivildienst dem nicht gerecht wird wurde von uns zur Genüge dargelegt.
Leider steht Totalverweigerung in der BRD noch nicht auf so breiten Füßen wie mensch es sich angesichts der Entwicklungen wünschen sollte. Als politisches Mittel ist sie noch nicht anerkannt genug, um von der Öffentlichkeit ernsthaft dis- kutiert zu werden. Vielmehr ist sie eine individuelle Angelegenheit, was gerade für Totalverweigerer zu einem großen Problem wird. Eine politische Überzeu- gung wird ihnen nicht zuerkannt. Im Gegenteil: „Drückeberger, Egoisten“ sind nur allzu häufig Bezeichnungen für sie. Die Ablehnung des Zivildienstes „bewei- se“ es ja.
Das Beispiel Spaniens zeigt deutlich, daß Totalverweigerung - dort unter dem Namen Insumision - ein politisches Mittel sein kann, um die Wehrpflicht zu be- kämpfen. Die Zahlen der Totalverweigerer schossen dort so in die Höhe, daß sich der Staat gezwungen sah, die Restriktionen gegen Totalverweigerer einzuschrän- ken und letztendlich, die Wehrpflicht in naher Zukunft abzuschaffen. In der BRD allerdings hat die Totalverweigerung keine Massenbasis, wie es in Spanien der Fall ist.
Literaturverzeichnis
- Altvater, Elmar, Antifa KOK, Antifa A+O u.a. (Hrsg.): radikal. Dokumentation kriminalisierter Texte. Berlin 1997.
- Bausenwein, Christoph: Dienen oder Sitzen. Ein Weißbuch zur Totalverweige- rung. Nürnberg 1984.
- Becker, H., O. Leist: Militarismus in der Bundesrepublik. Ursachen und For- men. Köln 1981.
- Bröckling, Ulrich: Zwischen „Krieg dem Krieg!“ und „Widerstrebt dem Übel nicht mit Gewalt!“ Anarchistischer Antimilitarismus im Deutschen Kaiserreich vor 1914. In: Schwarzer Faden. Vierteljahresschrift für Lust und Freiheit. Grafenau, Nr. 1/97 (Nr. 60).
- Bundesminister der Verteidigung (Hrsg.): Ressortkonzept zur Anpassung der Streitkräftestrukturen, der Territorialen Wehrverwaltung und der Stationierung vom 15. März 1995. Bonn 1995.
- Bundesministerium der Verteidigung im Auftrag der Bundesregierung (Hrsg.): Weißbuch 1994. Weißbuch zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage und Zukunft der Bundeswehr. Bonn 1994.
- Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 12. Juli 1994 zu Out-of-area-Einsätzen der Bundeswehr.
- Deutscher Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit: Fragen an die deutsche Geschichte. Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart. Bonn 1993.
- die tageszeitung. Mittwoch, 24. 09.1997.
- Erdmann, Karl Dietrich: Die Weimarer Republik. (=Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte Bd. 19). 10. Auflage, München 1980.
- Focus Nr. 45 1997.
- Friedrich, Ernst: Krieg dem Kriege. 11. Auflage, Frankfurt a. M. 1981.
- Görtemaker, Manfred: Deutschland im 19. Jahrhundert. Entwicklungslinien. 4. ergänzte Auflage. Bonn 1994.
- Grässlin, Jürgen: Lizenz zum Töten? Wie die Bundeswehr zur internationalen Eingreiftruppe gemacht wird. München 1997.
- Haug, Hans-Jürgen, Hubert Maessen: Kriegsdienstverweigerer: Gegen die Mi- litarisierung der Gesellschaft. Frankfurt a. M. 1971.
- Herz, Christian: Totalverweigerung. Eine Streitschrift für die totale Kriegs- dienstverweigerung. 5., überarbeitete Auflage, Sensbachtal 1995.
- Hesselberger, Dieter: Das Grundgesetz. Kommentar für die politische Bildung. 10., überarbeitete Auflage, Bonn 1996.
- Jacobsen, Hans-Adolf: Militär, Staat und Gesellschaft in der Weimarer Repu- blik. In: Bracher, Karl Dietrich, Manfred Funke und Hans-Adolf Jacobsen(Hrsg.): Die Weimarer Republik 1918 - 1933. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. 2. Auflage, Bonn 1987.
- König, Josef: Kritische Anmerkungen zur zukünftigen Wehrstruktur. In: Klein, Paul, Rolf P. Zimmermann (Hrsg.): Die künftige Wehrstruktur der Bundes- wehr. Notwendige Anpassung oder Zwei-Klassen-Armee? Baden-Baden 1997.
- Krause, Ulf von: Grundzüge der zukünftigen Streitkräftestruktur der Bundes- wehr. In: Klein, Paul, Rolf P. Zimmermann (Hrsg.): Die künftige Wehrstruktur der Bundeswehr. Notwendige Anpassung oder Zwei-Klassen-Armee? Baden- Baden 1997.
- Messerschmidt, Manfred: Die Wehrmacht im NS-Staat. In: Bracher, Karl Diet- rich, Manfred Funke und Hans-Adolf Jacobsen(Hrsg.): Deutschland 1933 - 1945. Neue Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft. Bonn 1992.
- Morsey, Rudolf: Bundeswehr. Aufbau und Entwicklung. In: Görres- Gesellschaft (Hrsg.): Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. In 5 Bän- den. Bd. 1. 7., völlig neu bearbeitete Auflage, Freiburg 1986.
- Naumann, Klaus: Militärpolitische und Militärstrategische Grundlagen und konzeptionelle Grundrichtung einer Neugestaltung der Bundeswehr. Vorlage an den Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundestages zur Sitzung am 20. Januar 1991.
- Ossietzky, Carl von: Lesebuch. Der Zeit den Spiegel vorhalten. Reinbek 1994.
- Rocker, Rudolf: Aus den Memoiren eines deutschen Anarchisten. Frankfurt a. M. 1974.
- Rühe, Volker: Verteidigungspolitische Richtlinien. Bonn 1992.
- Seng, Kalle: Weder Bund noch Zivildienst: totale Kriegsdienstverweigerung. In: Pokatzky, Klaus (Hrsg.): Zivildienst - Friedensarbeit im Inneren. Reinbek 1983.
- Soldatengesetz. Stand: 1. Januar 1996. 26., neubearbeitete Auflage, München 1996.
- TKDV-Initiative Braunschweig (Hrsg.): Wehrpflicht? Ohne uns! Reader zur totalen Kriegsdienstverweigerung. 5. Auflage, Braunschweig 1996.
- Wehrpflichtgesetz. Stand: 1. Januar 1996. 26., neubearbeitete Auflage, Mün- chen 1996.
- Wehrstrafgesetz. Stand: 1. Januar 1996. 26., neubearbeitete Auflage, München 1996.
- Zivildienstgesetz. Stand: 1. Januar 1996. 26., neubearbeitete Auflage, München 1996.
[...]
1 Vgl. die tageszeitung. Mittwoch, 24. 09.1997.
2 Vgl. Herz, Christian: Totalverweigerung. Eine Streitschrift für die totale Kriegsdienstverweigerung. 5., überarbeitete Auflage, Sensbachtal 1995. (Künftig zitiert: Herz.) S.49.
3 Antimilitarismus und Pazifismus sind natürlich nicht die einzigen Begründungen für eine totale Verweigerung. Ebenso sind religiöse (Zeugen Jehovas) oder politische Gründe (z. B. AnarchistInnen) möglich. Auch darauf wird im weiteren Verlauf der Arbeit eingegangen werden.
4 Vgl. Görtemaker, Manfred: Deutschland im 19. Jahrhundert. Entwicklungslinien. 4., ergänzte Auflage. Bonn 1994. (Künftig zitiert: Görtemaker.).
5 Vgl. Deutscher Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit: Fragen an die deutsche Geschichte. Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart. Bonn 1993. (Künftig zitiert: Deutsche Geschichte.) S.227.
6 Vgl. Görtemaker. S.375.
7 Vgl. Deutsche Geschichte. S. 234.
8 Vgl. Bröckling, Ulrich: Zwischen „Krieg dem Krieg!“ und „Widerstrebt dem Übel nicht mit Gewalt!“ Anarchistischer Antimilitarismus im Deutschen Kaiserreich vor 1914. S.56. In: Schwar- zer Faden. Vierteljahresschrift für Lust und Freiheit. Grafenau, Nr. 1/97 (Nr. 60). (Künftig zitiert: Bröckling.) S.52 - 60. - Sehr empfehlenswert zu diesem Thema sind auch die umfangreichen Lite- raturangaben, darunter einige interessante Primärquellen - die Bröckling zum Thema gibt (S.61 - 63).
9 Vgl. ebd. S.60.
10 Vgl.: Jacobsen, Hans-Adolf: Militär, Staat und Gesellschaft in der Weimarer Republik. In: Bra- cher, Karl Dietrich, Manfred Funke und Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.): Die Weimarer Republik 1918 - 1933. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. 2. Auflage, Bonn 1987. (Künftig zitiert: Jacobsen.) S.364.
11 Erdmann, Karl Dietrich: Die Weimarer Republik. (=Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte Bd. 19) 10. Auflage, München 1980. S.45.
12 Vgl. ebd. S.192.
13 Vgl. Jacobsen. S. 290 - 294.
14 Vgl. Ebd. S. 364.
15 Ebd. S. 364/365.
16 Friedrich, Ernst: Krieg dem Kriege. 11. Auflage, Frankfurt a. M. 1981. S. 12 - 14. Die Hervorhebung entspricht der Hervorhebung in dieser Ausgabe.
17 Vgl. Ossietzky, Carl von: Lesebuch. Der Zeit den Spiegel vorhalten. Reinbek 1994. S. 75.
18 Seng, Kalle: Weder Bund noch Zivildienst: totale Kriegsdienstverweigerung. In: Pokatzky, Klaus (Hrsg.): Zivildienst - Friedensarbeit im Inneren. Reinbek 1983.
19 Messerschmidt, Manfred: Die Wehrmacht im NS-Staat. S. 377. In: Bracher, Karl Dietrich, Manfred Funke und Hans-Adolf Jacobsen(Hrsg.): Deutschland 1933 - 1945. Neue Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft. Bonn 1992. S.377 - 403.
20 Ebd. S.378.
21 Ebd. S.377.
22 Vgl. ebd. S.398.
23 Ebd. S. 399.
24 Vgl. Morsey, Rudolf: Bundeswehr. Aufbau und Entwicklung. In: Görres-Gesellschaft(Hrsg.): Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. In 5 Bänden. Bd. 1. 7., völlig neu bearbeitete Auflage, Freiburg 1986. S. 1024 - 1026.
25 Vgl. Deutsche Geschichte. S. 375 - 383.
26 Vgl. Krause, Ulf von: Grundzüge der zukünftigen Streitkräftestruktur der Bundeswehr. In Klein, Paul, Rolf P. Zimmermann (Hrsg.): Die künftige Wehrstruktur der Bundeswehr. Notwendige Anpassung oder Zwei-Klassen-Armee? Baden-Baden 1997. (Künftig zitiert: Krause.) S. 15.
27 Vgl. Grässlin, Jürgen: Lizenz zum Töten? Wie die Bundeswehr zur internationalen Eingreiftruppe gemacht wird. München 1997. (Künftig zitiert: Grässlin.) S. 14 - 15.
28 Vgl. Krause. S. 16.
29 Vgl. ebd. S. 13.
30 Vgl. Grässlin. S. 189.
31 Vgl. Bundesministerium der Verteidigung im Auftrag der Bundesregierung (Hrsg.): Weißbuch 1994. Weißbuch zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage und Zukunft der Bundeswehr. Bonn 1994. (Künftig zitiert: Weißbuch.) Punkt 530.
32 Vgl. Krause. S. 25.
33 Vgl. König, Josef: Kritische Anmerkungen zur künftigen Wehrstruktur. In: Klein, Paul, Rolf P. Zimmermann (Hrsg.): Die künftige Wehrstruktur der Bundeswehr. Notwendige Anpassung oder Zwei-Klassen-Armee? Baden-Baden 1997. S. 55.
34 Vgl. Weißbuch. Punkt 572.
35 Vgl. Grässlin. S. 192.
36 Vgl. Bundesminister der Verteidigung (Hrsg.): Ressortkonzept zur Anpassung der Streitkräfte- strukturen, der Territorialen Wehrverwaltung und der Stationierung vom 15. März 1995. Bonn 1995. S. 9.
37 Ein eindrucksvolles Beispiel für diese Strategie war der Einsatz der Bundeswehr im Oderbruch 1997. Erstens ist es keine besondere Leistung gewesen, die die Bundeswehr hier vollbracht hat, mit diesen Personalressourcen und der entsprechenden Ausrüstung, und zweitens war die Bun- deswehr nicht wirklich zuständig. Derartige Aufgaben fallen wohl eher in den Bereich des Techni- schen Hilfswerkes. Im Nachhinein stellt Aufwertung, die die Bundeswehr im öffentlichen Anse-
38 Vgl. Grässlin. S. 375.
39 Der Eurofighter als ein wirtschaftlich wichtiges Projekt, gerade für Bayern, und der Satellit als Lieblingsprojekt des Kanzlers.
40 Vgl. Grässlin. S. 246.
41 Vgl. ebd. S. 245.
42 Vgl. Krause. S. 23.
43 Vgl. ebd. S. 23.
44 Vgl. Grässlin. S. 264.
45 Vgl. ebd. S. 308.
46 Vgl. ebd. S. 49.
47 Vgl. ebd. S. 55.
48 Vgl. ebd. S. 61.
49 Vgl. Naumann, Klaus: Militärpolitische und Militärstrategische Grundlagen und konzeptionelle Grundrichtung einer Neugestaltung der Bundeswehr. Vorlage an den Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundestages zur Sitzung am 20. Januar 1991. (Künftig zitiert: Naumann-Papier). und Rühe, Volker: Verteidigungspolitische Richtlinien. Bonn 1992. (Künftig zitiert: VPR.) Punkt 8.
50 Vgl. Weißbuch. Punkt 308.
51 Vgl. Naumann-Papier. und VPR. Punkt 18.
52 VPR. Punkt 37.
53 Vgl. Krause. S. 14.
54 VPR. Punkt 43.
55 Vgl. Grässlin. S. 72.
56 Zum Beispiel Golfkrieg: 17 Mrd. DM
57 Vgl. Grässlin. S. 378.
58 Vgl. ebd. S. 379.
59 Vgl. ebd. S. 124.
60 Vgl. ebd. S. 156.
61 Vgl. Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 12. Juli 1994 zu Out-of-area-Einsätzen der Bundes- wehr.
62 Vgl. Herz. S.24.
63 Haug, Hans-Jürgen, Hubert Maessen: Kriegsdienstverweigerer: Gegen die Militarisierung der Gesellschaft. Frankfurt a. M. 1971. (Künftig zitiert: Haug.) S.85.
64
142000 Zivildienstleistenden ( 1995: 135000) stehen nur noch 135000 Wehrdienstleistende
gegenüber. Vgl. Focus Nr. 45 1997. S. 86-92.
65 Vgl. . §29 Zivildienstgesetz (ZDG).
66 Dabei ist die Grenze zwischen den beiden Arten des Kriegsdienstes nicht klar gezogen. Je nach Standpunkt kann Dienst ohne Waffe somit den Ausschluß jeglicher Benutzung von Waffen bedeuten oder aber es ist der Ausschluß jeglichen Tuns, „das unmittelbar darauf gerichtet ist, mit den jeweils zur Verwendung kommenden Waffen Menschen im Kriege zu töten“ (BVerfG 12,57; zitiert nach: Herz. S. 31.). Danach ist z.B. Raketenabwehr mittels unbemannter Raketen nicht eindeutig dem Dienst mit Waffe zuzurechnen.
67 Umkehrschluß: Niemand kann... Kriegsdienst mit der Waffe <-> Jeder kann Kriegsdienst ohne Waffe
68 Vgl. Haug. S. 97.
69 Man erinnere sich an NATO-Planspiele für den Ernstfall, sogenannten Wintex-Cimex-Manöver.
70 Zur Einbindung der ZDL in die zivile Verteidigung siehe Art. 12a Abs. 3 GG. Ebenfalls bemerkenswert sind Bestrebungen ZDL in paramilitärische Organisationen einzubinden, z.B. Technisches Hilfswerk. Vgl. Becker, H., O. Leist: Militarismus in der Bundesrepublik. Ursachen und Formen. Köln 1981. (Künftig zitiert: Becker) S. 107.
71 Weißbuch.
72 Vgl. TKDV-Initiative Braunschweig (Hrsg.): Wehrpflicht? Ohne uns! Reader zur totalen Kriegsdienstverweigerung. 5. Auflage, Braunschweig 1996. (Künftig zitiert: Ohne uns!) S. 4.
73 Vgl. § 54 Abs. 1 ZDG.
74 Vgl. Herz. S. 35.
75 Vgl. ebd.
76 Vgl. §§ 25c, 29, 30 Abs. 1, 31, 41 Abs. 3, 53 Abs. 1 ZDG.
77 Vgl. z.B. §§52 und 53 ZDG §16 Wehrstrafgesetz (WStG); §29 ZDG §15 Soldatengesetz
(SG); §30 ZDG §11 SG.
78 Haug. S. 97.
79 Vgl. §23 ZDG und §24 Wehrpflichtgesetz (WPflG).
80 Vgl. Becker. S. 107.
81 Vgl. ebd. S. 106.
82 Vgl. Ohne uns! S. 8.
83 Vgl. Herz. S. 33.
84 Vgl. ebd. S. 38.
85 Vgl. Haug. S. 98.
86 Vgl. Herz. S. 37.
87 Haug. S. 99.
88 Vgl. Becker. S. 106.
89 Hesselberger, Dieter: Das Grundgesetz. Kommentar für die politische Bildung. 10., überarbeitete Auflage, Bonn 1996. S. 84.
90 Vgl. ebd. S. 87.
91 In diesem Zusammenhang ist es beachtenswert, daß während und nach des sog. Golfkrieges die Zahl der Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstleistende) rapide stieg.
92 Vgl. ebd. S. 88 - 89.
93 Ebd. S. 140.
94 Vgl. ebd. S. 138.
95 In: Bausenwein, Christoph: Dienen oder Sitzen. Ein Weißbuch zur Totalverweigerung. Nürnberg 1984. S. 287.
96 Vgl. Herz. S. 24.
97 Vgl. ebd.
98 Ebd. S. 12.
99 Bröckling. S. 52 - 60.
100 Vgl. ebd. S. 16.
101 Vgl. Herz. S. 22.
102 Vgl. ebd. S. 59 - 71.
103 Vgl. Altvater, Elmar, Antifa KOK, Antifa A+O u.a. (Hrsg.): radikal. Dokumentation kriminalisierter Texte. Berlin 1997. S. 60 - 65.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei enthält einen Text, der sich mit der Rolle des deutschen Militärs im 20. Jahrhundert, der Bundeswehr, dem Zivildienst und der totalen Kriegsdienstverweigerung auseinandersetzt. Es werden die Motive für die totale Kriegsdienstverweigerung beleuchtet und der Zivildienst kritisch hinterfragt.
Welche Rolle spielte das deutsche Militär im 20. Jahrhundert laut dem Text?
Der Text beschreibt die Rolle des Militärs im Kaiserreich, während des Ersten Weltkriegs, in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Im Kaiserreich wurde das Militär hoch angesehen und die Bevölkerung wurde durch Propaganda beeinflusst. In der Weimarer Republik war das Heer ein Sammelbecken für Adelige und reaktionäres Gedankengut war verbreitet. Im Dritten Reich wurde das Militär zum zentralen Element des Staates und die Wehrpflicht wurde eingeführt. Die Anfänge der Bundeswehr in der Bundesrepublik Deutschland werden auch skizziert.
Was sind die Hauptmerkmale der "neuen" Bundeswehr?
Die neue Bundeswehr ist durch eine Verkleinerung des Heeres, eine Unterteilung in Hauptverteidigungskräfte (HVK), Krisenreaktionskräfte (KRK) und Militärische Grundorganisation (MGO) gekennzeichnet. Die KRK sind für Einsätze außerhalb des Bündnisgebietes (Out-of-area-Einsätze) vorgesehen. Die Finanzierung der Bundeswehr und die damit verbundenen Probleme werden ebenfalls thematisiert.
Wie wird der Zivildienst im Text kritisiert?
Der Text argumentiert, dass der Zivildienst kein echter Ersatz für den Wehrdienst ist, sondern eine Art "ziviler Kriegsdienst". Es wird kritisiert, dass der Zivildienst den militärischen Charakter aufweist, die Wehrpflicht aufrechterhält und die politische Realität der Zivildienstleistenden (ZDL) ignoriert. Die Verweigerung des Zivildienstes nach Art. 4 Abs. 3 GG wird ebenfalls erörtert.
Welche Motive für die totale Kriegsdienstverweigerung werden genannt?
Die Motive für die totale Kriegsdienstverweigerung werden in religiöse, politische und individuelle Gründe unterteilt. Religiöse Gründe können sich auf die Ablehnung des Tötens im Krieg berufen. Politische Gründe können in der Ablehnung des Staates oder der parlamentarischen Demokratie liegen. Der individuelle Aspekt berücksichtigt die persönlichen Konsequenzen und Erfahrungen, die zu der Entscheidung führen.
Was ist die rechtliche Grundlage für die Kriegsdienstverweigerung in Deutschland?
Die rechtliche Grundlage für die Kriegsdienstverweigerung ist Artikel 4, Absatz 3 des Grundgesetzes, der besagt, dass niemand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden darf. Der Text diskutiert aber, dass diese Verweigerung an einen Ersatzdienst (Zivildienst) gekoppelt ist und daher keine vollständige Kriegsdienstverweigerung darstellt.
Was sind Krisenreaktionskräfte (KRK)?
Krisenreaktionskräfte (KRK) sind Spezialeinheiten innerhalb der Bundeswehr, die für Out-of-area-Einsätze, also Einsätze außerhalb des Bündnisgebietes, konzipiert sind. Sie verfügen über hochspezialisierte Ausbildung, beste Ausrüstung und modernste Großwaffensysteme.
Was sagt der Text über Verfassungsänderung bezüglich Auslandseinsätze?
Der Text argumentiert, dass die Bundesregierung die Verfassung für Auslandseinsätze schrittweise ausgelegt hat, ohne eine Verfassungsmehrheit zu erreichen. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Einsätze im Rahmen eines Systems kollektiver Sicherheit verfassungskonform sind.
Was ist der Schlussfolgerung des Textes?
Der Text schließt damit, dass das Militär in Deutschland eine Geschichte des autoritären und undemokratischen Gedankenguts hat. Da deutsche Truppen wieder auf internationalen Kriegsschauplätzen anzutreffen sind, ist der Wunsch nach totaler Kriegsdienstverweigerung verständlich, jedoch wird der Zivildienst diesem Anspruch nicht gerecht. Die Totalverweigerung ist in Deutschland noch nicht ausreichend anerkannt und wird oft als individuelle Angelegenheit abgetan.
- Quote paper
- Torsten Bewernitz (Author), 1998, Totale Kriegsdienstverweigerung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104830