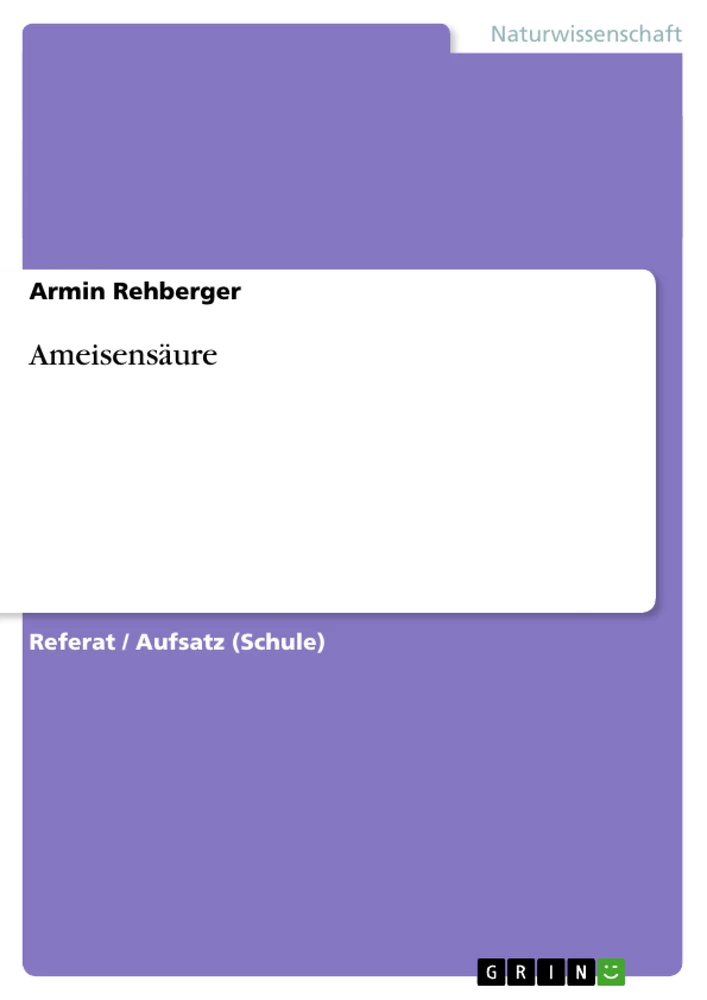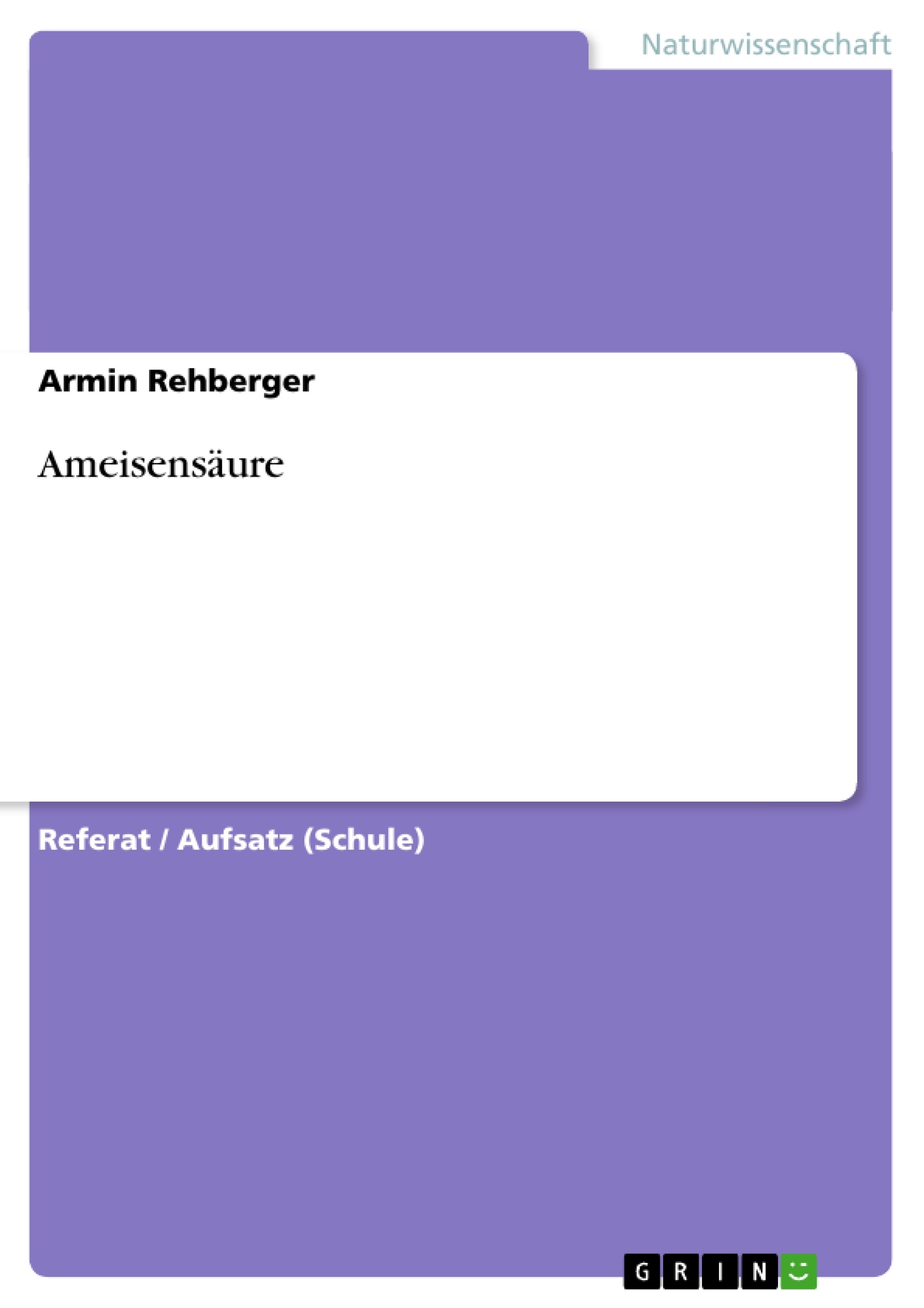Stell dir vor, ein einziger Tropfen einer unsichtbaren Flüssigkeit könnte ganze Ökosysteme beeinflussen, industrielle Prozesse revolutionieren und sogar in deinem eigenen Körper entstehen. Die Rede ist von Ameisensäure, einer Substanz, die weit mehr ist als nur ein Bestandteil von Ameisengift. Dieses Buch enthüllt die überraschende Vielseitigkeit und die oft übersehenen Eigenschaften dieser einfachsten Carbonsäure. Von ihrer historischen Entdeckung durch Destillation von Ameisen bis hin zu ihrer modernen, großtechnischen Herstellung, werden alle Aspekte beleuchtet: die chemischen Besonderheiten, die sie von anderen Carbonsäuren abheben, ihre Rolle in der Natur – von Brennnesseln bis zu Tannennadeln – und die potenziellen Gefahren bei unsachgemäßer Handhabung. Erfahren Sie, wie Ameisensäure als Konservierungsmittel in Lebensmitteln, als Desinfektionsmittel in der Weinproduktion und als wichtiger Bestandteil in der Gummi- und Textilindustrie eingesetzt wird. Doch das ist noch nicht alles: Tauchen Sie ein in die medizinischen Aspekte, von der Behandlung rheumatischer Beschwerden bis hin zu den Auswirkungen einer Methanolvergiftung, bei der Ameisensäure eine entscheidende Rolle spielt. Dieses Buch ist ein umfassender und dennoch zugänglicher Leitfaden für alle, die mehr über diese faszinierende chemische Verbindung erfahren möchten, sei es aus wissenschaftlichem Interesse, beruflicher Notwendigkeit oder einfach nur aus purer Neugier. Entdecken Sie die verborgenen Kräfte der Ameisensäure und verstehen Sie, warum diese unscheinbare Substanz einen so bedeutenden Platz in unserer Welt einnimmt. Von der Gewinnung über die Herstellung bis zur vielfältigen Verwendung – dieses Werk bietet einen fundierten Einblick in die Welt der Ameisensäure, angereichert mit praxisnahen Informationen zu Sicherheit, Erster Hilfe und den vielfältigen Anwendungsbereichen in Industrie, Landwirtschaft und Medizin. Ein unverzichtbarer Ratgeber für Chemiker, Biologen, Mediziner, aber auch für interessierte Laien, die die Geheimnisse dieser bemerkenswerten Säure entschlüsseln wollen.
Ameisensäure
Ein Referat von Armin Rehberger über Ameisensäure allgemein, ihre Sonderstellung unter den Carbonsäuren, sowie Wissenswertes über diese Gruppe
14.Mai 2001
Definition/ Entdeckung:
Englisch: formic acid, französisch: acide formique, italienisch: acido formico, spanisch: acido fórmico
Ameisensäure (H - COOH) wird auch Methansäure genannt und zählt zu den Carbonsäuren, von denen sie die einfachste ist. Entdeckt wurde sie 1670, als Fischer sie aus der Roten Waldameise isolierte und 1749 von Markgraf durch Destillation von Ameisen ziemlich rein hergestellt. Großtechnisch hergestellt wird H - COOH seit 1896.
Vorkommen:
Ameisensäure kommt in den Giftsekreten der Ameisen und Laufkäfern vor, außerdem noch in Brennesseln und in Tannennadeln.
Eigenschaften:
RSE - Sätze: R 35, S23-26-45, E 1-10 MG: 46,02g /mol
Ameisensäure ist eine klare, farblose, flüchtige, stechend riechende, stark ätzende Flüssigkeit mit antiseptischer Wirkung. Der Schmelzpunkt liegt bei 8° C, der Siedepunkt bei 101° C. Die Dichte in wasserfreiem Zustand beträgt 1,22g/cm3, als 25%ige Lösung in Wasser circa 1,06. Die Explosionsgrenzen in Luft: 18 - 51 Vol.-%. Ameisensäure lässt sich unbegrenzt Alkohol, Wasser, Ether und Glyzerin mischen. Ameisensäuredämpfe brennen mit blauer Flamme. Oberhalb von 100 - 200° C zerfällt H - COOH in CO und H2O oder in CO2 und H2. Chemisch treten vor allem die Aldehydeigenschaften der Ameisensäure (Methansäure) auf. Die Salze der Ameisensäure heißen -methanoate (früher: -formiate).
Ameisensäure ist die stärkste Carbonsäure und zugleich der einfachste Vertreter unter ihnen, in deren Gruppe sie eine Sonderstellung einnimmt, da sie nicht nur als Säure, sondern auch als Aldehyd reagieren kann. Hierbei wirkt Ameisensäure (Methansäure) reduzierend, was zum Nachweis benutzt werden kann; z.B. Reduktion einer ammoniakalischen Silbernitratlösung zu metallischem Silber, Entfärbung einer Kaliumpermanganatlösung zu Chrom(III)-Salz. Bei der Oxidation von Ameisensäure entstehen Kohlendioxid und Wasser, durch Einwirkung von Hitze oder mit Pt - Kalalysatoren bei Raumtemperaturen wird Ameisensäure zu CO2 und H2 zersetzt, mit konzentriertem H2SO4 entsteht CO. Mit Alkoholen können Ester erzeugt werden (z.B. Ameisensäure + Ethanol ➙ Ameisensäureethylester + Wasser). Für diese Reaktion wird Wärme und ein Katalysator (H2SO4) benötigt.
Wirkungen:
Für den Menschen führt die Ameisensäure zu schmerzhaften Verätzungen, ist ansonsten aber ungiftig. Ameisensäuredämpfe reizen stark Augen und Atemwege. Kontakt mit der Flüssigkeit führt auch in verdünntem Zustand zu Verätzungen und Blasenbildung an Augen und Haut. Der MAK - Wert beträgt 9 mg/ m3 Luft oder 5ppm (Der MAK - Wert ist die Maximale Arbeitsplatz - Konzentration. Dabei wird angegeben wie viel mg des Stoffes innerhalb von 40 Stunden wöchentlich oder 5 mal 8 Stunden täglich pro m3 Luft enthalten sein darf. Wird dieser Wert überschritten, so ist das Arbeiten in diesem Raum gesundheitsschädigend und der Raum muss entlüftet und desinfiziert werden. Dabei wird der MAK - Wert bisweilen auch in ppm (= parts per million = ml/m3 ) gemessen wobei angegeben wird wie viele Teile des Stoffes in einer Million Teilen Luft maximal enthalten sein dürfen.); Abluft darf circa 50 mg/ m3 Ameisensäure enthalten.
Bei der Metabolisierung von Methanol im menschlichen Organismus entstehen Ameisensäure und Formaldehyd.
Akute Toxität:
Verätzungen sind möglich ab einer Konzentration über 10%.
Mensch inhal: niedrigste toxische Dosis 7,3 mg/m3 /8h
Ratte oral: Mittlere tödliche Dosis (50%) 1100mg/kg
Ratte inhal: Mittlere tödliche Dosis (50%) 15g/m3 /15min
Kategorie nach GefStoffV: über 25%iger Konzentration Gefahrenklasse C (ätzend)
Kategorie der MAK-Werte-Liste: I (lokal reizende Stoffe)
Klinische Beobachtungen nach Kontakt mit Ameisensäure:
Haut: Reizung, Verätzung I. - III. Grades, bei chronischer Exposition evt. KontaktDermatitis.
Atemtrakt: Schleimhautirritationen, Husten, Dyspnoe, Bronchospamus, Lungenödem, chemische Pneumonitis, Veränderung der Lungenfunktion sind messbar. Bei Exposition von 15ppm wurde einfache Übelkeit beobachtet. Es kann zur Sensibilisierung mit asthmaähnlichen Beschwerden kommen.
Augen: Konjunktivale Reizung, Augentränen, Corneatrübung.
Magen, Darm: Salivation, Übelkeit, Erbrechen (blutig), Diarrhoe, retrosternale Schmerzen, Verätzungen I. - III. Grades, Nekrosebildung, Glottisödem mit Ateminsuffizienz, Perforation, Hämolyse, metabolische Azidose, Nephropathie, ischämische Läsionen in Leber und Herz, Schock, Tod. Bei chronischer Exposition kann als Zeichen einer möglichen Nierenschädigung Albumin oder Blut im Urin beobachtet werden.
Anderes: Kreislaufkollabs, ZNS-Depression, Magen- und Ösophagusstrikturen.
Therapie:
Haut: Nicht sofort mit Wasser abspülen, sondern zuerst mit saugfähigem Material abtupfen, danach erst spülen. Therapie: Wie Verbrennung.
Atemtrakt: Symptomatische Therapie, gegebenenfalls Dexamethason.
Auge: Sofortige Spülung mit handwarmem Leitungswasser mindestens über 5 Minuten, beim Augenarzt Lokalanästhesie und erneute Spülung.
Magen, Darm: Bei eindeutigen Verätzungen kein Erbrechen, keine Kohle, keine Neutralisation. Eine endoskopische Untersuchung ist innerhalb von Stunden nach Ingestion möglich, wenn keine Hinweise auf eine Perforation bestehen, dann die Magenflüssigkeit mit einem Endoskop absaugen. Cave Perforation durch Untersuchung, nur vom Erfahrenen durchführen lassen. Wasser, um den Ösophagus freizuspülen, aber ohne den Magen zu überfüllen. Symptomatische Behandlung des Schocks. Ulcogant 4 mal 1g in 60 ml Wasser/ d. Ständige Überwachung Ausgleich der metabolischen Azidose. Prophylaktische Heparinisierung (= low dose) mit 200- 500 E/h (Quick, PTT, TZ dürfen nicht reagieren). Diuresesteigerung bis auf 6l/d. Der Nutzen systemischer Kortisonapplikation zur Verhinderung von Strikturen wird kontrovers diskutiert. Hämodialyse bei ausgeprägter Hämolyse oder wenn die metabolische Azidose schwer auszugleichen ist.
Personen, die mit Ameisensäure arbeiten, sollten regelmäßig hinsichtlich ihrer Lungenfunktion untersucht werden!
Labor/ Diagnose:
Der Dampf der Ameisensäure kann mit Hilfe des Dräger-Prüfröhrchens nachgewiesen werden. Dies geschieht beispielsweise zur Bestimmung von Ameisensäure im Urin, um die berufliche Exposition zu quantifizieren.
Gewinnung:
Ameisensäure wird vor allem als Nebenprodukt (rund 18%) bei der Herstellung von Essigsäure aus Leichtbenzin oder Butan gewonnen. Auch bei der Anwendung des BASF - Verfahrens kann aus CO und Methanol Ameisensäure erzeugt werden: der gebildete Ameisensäuremethylester wird durch Ammoniak in Formamid umgewandelt und hieraus wird mit Schwefelsäure Ameisensäure freigesetzt. Dieses Verfahren wurde von BASF entwickelt und bis 1982 auch technisch angewandt, dann aber durch eine Direkthydrolyse ersetzt. Transportiert und versandt wird Ameisensäure in Polyethylen - Behältern. Weltweit werden pro Jahr etwa 100.000t Ameisensäure produziert, ungefähr die Hälfte davon in der Bundesrepublik Deutschland.
Herstellung:
In der Technik wird Ameisensäure aus Natriumhydroxid und Kohlenstoffmonoxid bei 120°C und sehr hohen Drücken (0,8 MPa) gewonnen.
1. Schritt: NaOH + CO ➙ HCOONa
2. Schritt: HCOONa + H2SO4 + Na2SO4
Das entstehende Zwischenprodukt HCOONa (Natriumformiat) wird mit Schwefelsäure zersetzt, wobei Ameisensäure entsteht.
Verwendung:
Ameisensäure wird sehr vielseitig verwendet, heute aber vorwiegend zur Unterstützung der Milchsäure - Gärung in Grünfutteranlagen; zum Koagulieren von Kautschuk und Latex bei der Gummigewinnung, als erlaubter Lebensmittelzusatzstoff (E 236) zur Konservierung von Fruchtsäften (als 0,25%iger Zusatz), auch in Form der Salze (Formiate; Natriumformiate 237 und Calciumformiat E 238) und zur Gerberei. Desweiteren dient Ameisensäure als Lösungsmittel für Acetyllulose, Nylon, Perlon und Plexiglas. Ameisensäure wird außerdem zum Desinfizieren von Wein- und Bierfässern, zum Entkalken von Boilereinsätzen und zum Ansäuern von Silofutter verwendet. Die Salze (Formiate) werden in der Textil- und Lederindustrie zum Imprägnieren, Beizen, Mattieren und Entkalken von Leder und anderen Werkstoffen benutzt. In der Medizin dient der sogenannte Ameisenspiritus (1TL Ameisensäure, 14TL Ethanol, 5TL Wasser) als Antirheumatikum.
Eigenschaften von Carbonsäuren im Allgemeinen:
Carbonsäuren sind die Oxidationsprodukte der Aldehyde und können untereinander und mit anderen geeigneten Verbindungen Wasserstoffbrücken bilden. Daher sind die ersten Glieder der Reihe der aliphatischen Carbonsäuren uneingeschränkt in Wasser lösbar. Carbonsäuren haben außergewöhnlich hohe Siedepunkte und liegen sowohl im festen als auch im gasförmigen Aggregatszustand als Dimere vor.
Carbonsäuren
... ist die Bezeichnung für eine große Gruppe von organischen Säuren, die eine oder mehrere Carboxy-Gruppen enthalten; also gibt es Mono-, Di-, Tricarbonsäuren, Polycarbonsäuren usw. Die Carboxy-Gruppen können mit (gesättigten oder ungesättigten) Alkyl- oder Cycloalkyl-Resten oder mit aromatischen Resten verbunden sein; die ersteren bezeichnet man auch als Fettsäuren. Beispiele: Capronsäure (Trivialname), Pentancarbonsäure, Hexansäure (bevorzugter systematischer Name) sind Synonyma für die Säure H3C-(CH2)4-COOH. Bekannte Carbonsäuren sind Ameisen-, Essig-, Butter-, Stearinsäure (gesättigte Fettsäuren), Acrylsäure, Crotonsäure (Butensäure), Ölsäure (ungesättigte Fettsäuren), Oxal-, Malon-, Bernstein-, Adipinsäure (gesättigte Dicarbonsäuren), Benzoe- u. Phthalsäure (aromatische Mono- u. Dicarbonsäure).
Die niederen aliphatischen Carbonsäuren (bis ca. C10) sind bei Raumtemperatur nahezu alle flüssig, die höheren ebenso wie die aromatischen fest. Alle Carbonsäuren haben sehr hohe Siedepunkte, was auf die Neigung zur Assoziation zurückzuführen ist. Bis etwa C8 sind die Carbonsäuren wasserlöslich. Im allgemeinen sind die Carbonsäuren schwächere Säuren als die gängigen anorganischen Säuren, obwohl z.B. halogenierte Carbonsäuren weitgehend dissoziiert sind. Mit Basen bilden die Carbonsäuren feste Salze und mit Alkoholen Ester:
- findet die Veresterung innerhalb desselben Moleküls (Hydroxy-Carbonsäure) statt, so entstehen die Lactone. Die Einwirkung wasserentziehender Mittel auf Carbonsäuren führt zur Bildung von Säureanhydriden:
- mit Ammoniak bilden die Carbonsäuren Amide, mit Aminen die entsprechenden N-Alkylamide und mit Amino-Gruppen innerhalb desselben Moleküls (Amino-Carbonsäure) Lactame. Thermisch erweisen sich viele Carbonsäure als labil; sie verlieren beim Erhitzen, gegebenenfalls bei Verwendung von Katalysatoren, Kohlendioxid:
R-COOH (R) R-H + CO2 (Decarboxylierung).
Mit Reduktionsmitteln reagieren viele Carbonsäuren unter Bildung der Alkohole:
- mit Halogenierungsmittel wie SOCl2, PCl3 od. PCl5 unter Säurehalogenid- Bildung (R-CO-X). Wegen der Reaktionsfreudigkeit der Carboxy-Gruppe ist es oft nötig, Schutzgruppen (z.B. die 9-Anthrylmethyl-Gruppe) einzuführen, wenn an anderer Stelle des C.-Mol. Reaktionen durchgeführt werden sollen.
Vorkommen:
In der Natur kommen veresterte Carbonsäuren in Ölen, Fetten und Wachsen vor (als Glyceride bzw. Fettsäurealkylester), ferner in natürlichen Aromen und Harzen (aliphatischen und aromatischen C-Ester). In freier Form treten die niederen aliphatischen Carbonsäuren und einige aromatischen Carbonsäuren als Bestandteile von Pflanzensäften, Schweiß und anderen Tiersekreten in Erscheinung. Die bemerkenswerte Bevorzugung der aliphatischen Carbonsäuren mit geradzahliger C- Zahl in der Natur ergibt sich aus dem Aufbaumechanismus über Acetyl-CoA. Umgekehrt unterliegen geradzahlige Carbonsäuren leichter dem biologischen Abbau als ungeradzahlige und verzweigte.
Nachweis:
Der Nachweis von Carbonsäuren erfolgt durch die Herstellung von kristallischen Derivaten wie Aniliden, Aminen, Phenacylestern usw., durch Überführung in Hydroxamsäuren, die mit FeCl3 eine charakteristische Färbung geben.
Herstellung:
Carbonsäuren werden durch Oxidation von Alkoholen oder Aldehyden, durch Hydrolyse der Nitrile, durch Oxidation, z.B. mit Luft in Gegenwart von Katalysatoren, von Alkylbenzolen zu aromatischen Carbonsäuren und durch Hydrierung derselben zu alicycl. Carbonsäuren umgewandelt. Während in diesen Verfahren, die auch technische Verwendung finden, die Carbonsäuren die gleiche Anzahl C-Atome enthalten wie das Ausgangsmaterial, gibt es eine große Anzahl von meist in Einzelstichwörtern behandelten sogenannten Aufbaureaktionen, mit deren Hilfe sich Carbonsäuen mit höherer C-Zahl aus Rohstoffen mit niedrigerer synthetisieren lassen; Beispiele: Malonester-Synth., Arndt-Eistert-Reaktion, Reformatsky-Synth., Carboxylierung von Grignard-Verb., Kochsche Carbonsäure-Synth., Carbonylierung, Oxo-Synth. usw. Zur technischen Herstellung einzelner Carbonsäuren sind meist Spezialverfahren entwickelt worden, wozu auch die oxidative Spaltung höhermol. Olefine bzw. ungesättigter Fettsäuren zu rechnen ist und die katalysierte Luft oder Sauerstoff-Oxidation von Petrochemikalien. Ein großer Prozentsatz technischer Carbonsäuren wird auch auf dem Gärungswege gewonnen.
Englisch : carboxylic acids
Französisch : acides carboxyliques Italienisch: acidi carbonici
Spanisch: ácidos carboxílicos
Quellenangaben:
- Römpp Chemie Georg Thieme Verlag 1995
- Schüler-Duden: Die Chemie 2. Auflage
- Chemie - Fakten und Gesetze Buch und Zeit - Verlag
- Basiswissen Chemie Springer - Verlag
Häufig gestellte Fragen
Was ist Ameisensäure?
Ameisensäure (H-COOH), auch Methansäure genannt, ist die einfachste Carbonsäure. Sie wurde 1670 entdeckt und kommt in der Natur in Ameisen, Brennesseln und Tannennadeln vor.
Wo kommt Ameisensäure vor?
Sie findet sich in den Giftsekreten von Ameisen und Laufkäfern, in Brennesseln und Tannennadeln.
Welche Eigenschaften hat Ameisensäure?
Ameisensäure ist eine klare, farblose, flüchtige, stechend riechende, stark ätzende Flüssigkeit mit antiseptischer Wirkung. Sie hat einen Schmelzpunkt von 8°C und einen Siedepunkt von 101°C. Sie ist mit Wasser, Alkohol und Ether mischbar und zeigt sowohl Säure- als auch Aldehyd-Eigenschaften.
Wie wirkt Ameisensäure auf den Menschen?
Sie kann zu schmerzhaften Verätzungen führen und reizt Augen und Atemwege. In höheren Konzentrationen (über 10%) verursacht sie Verätzungen.
Wie wird Ameisensäure gewonnen und hergestellt?
Ameisensäure wird hauptsächlich als Nebenprodukt bei der Herstellung von Essigsäure gewonnen. Technisch wird sie aus Natriumhydroxid und Kohlenstoffmonoxid unter hohem Druck hergestellt. Ein Zwischenprodukt ist Natriumformiat, welches dann mit Schwefelsäure zersetzt wird.
Wozu wird Ameisensäure verwendet?
Die Anwendung ist vielfältig, darunter in der Landwirtschaft zur Silierung von Grünfutter, zur Koagulation von Kautschuk, als Lebensmittelzusatzstoff (E 236), in der Gerberei, als Lösungsmittel und zum Desinfizieren. Auch die Salze (Formiate) werden in verschiedenen Industrien verwendet.
Was sind Carbonsäuren im Allgemeinen?
Carbonsäuren sind organische Säuren mit einer oder mehreren Carboxygruppen (-COOH). Sie bilden Wasserstoffbrückenbindungen und haben hohe Siedepunkte. Die niederen Carbonsäuren sind wasserlöslich.
Wie weist man Carbonsäuren nach?
Der Nachweis erfolgt durch Herstellung kristalliner Derivate, Überführung in Hydroxamsäuren oder durch andere chemische Reaktionen.
Wie erfolgt die Therapie bei Kontakt mit Ameisensäure?
Haut: Abtupfen mit saugfähigem Material, dann spülen. Therapie wie bei Verbrennungen.
Atemtrakt: Symptomatische Therapie, evtl. Dexamethason.
Auge: Sofortiges Spülen mit Wasser.
Magen/Darm: Kein Erbrechen, keine Kohle, keine Neutralisation. Endoskopische Untersuchung möglich, aber vorsichtig. Symptomatische Behandlung des Schocks.
Welche Gefahren bestehen bei der Arbeit mit Ameisensäure?
Dämpfe reizen Augen und Atemwege. Direkter Kontakt verursacht Verätzungen. Der MAK-Wert liegt bei 9 mg/m³ Luft. Es sind regelmäßige Lungenfunktionstests für Personen, die mit Ameisensäure arbeiten, empfehlenswert.
Welche klinischen Beobachtungen gibt es nach Kontakt mit Ameisensäure?
Haut: Reizung, Verätzung.
Atemtrakt: Schleimhautirritationen, Husten, Dyspnoe, Lungenödem.
Augen: Konjunktivale Reizung, Augentränen.
Magen, Darm: Salivation, Übelkeit, Erbrechen, Verätzungen, Nekrosebildung, metabolische Azidose.
- Quote paper
- Armin Rehberger (Author), 2001, Ameisensäure, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104752