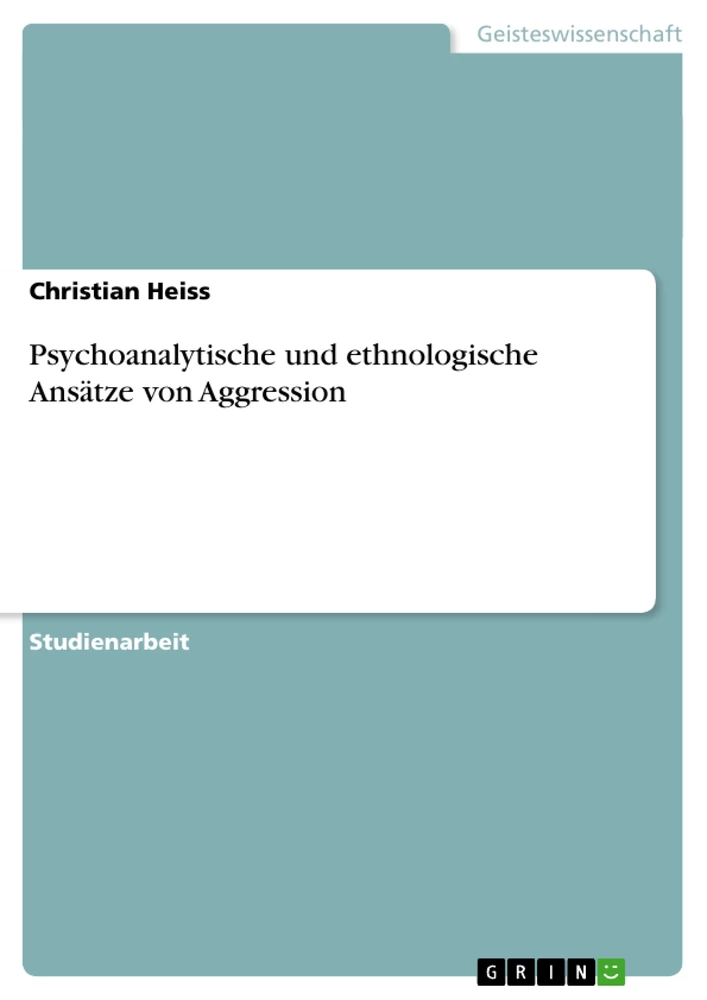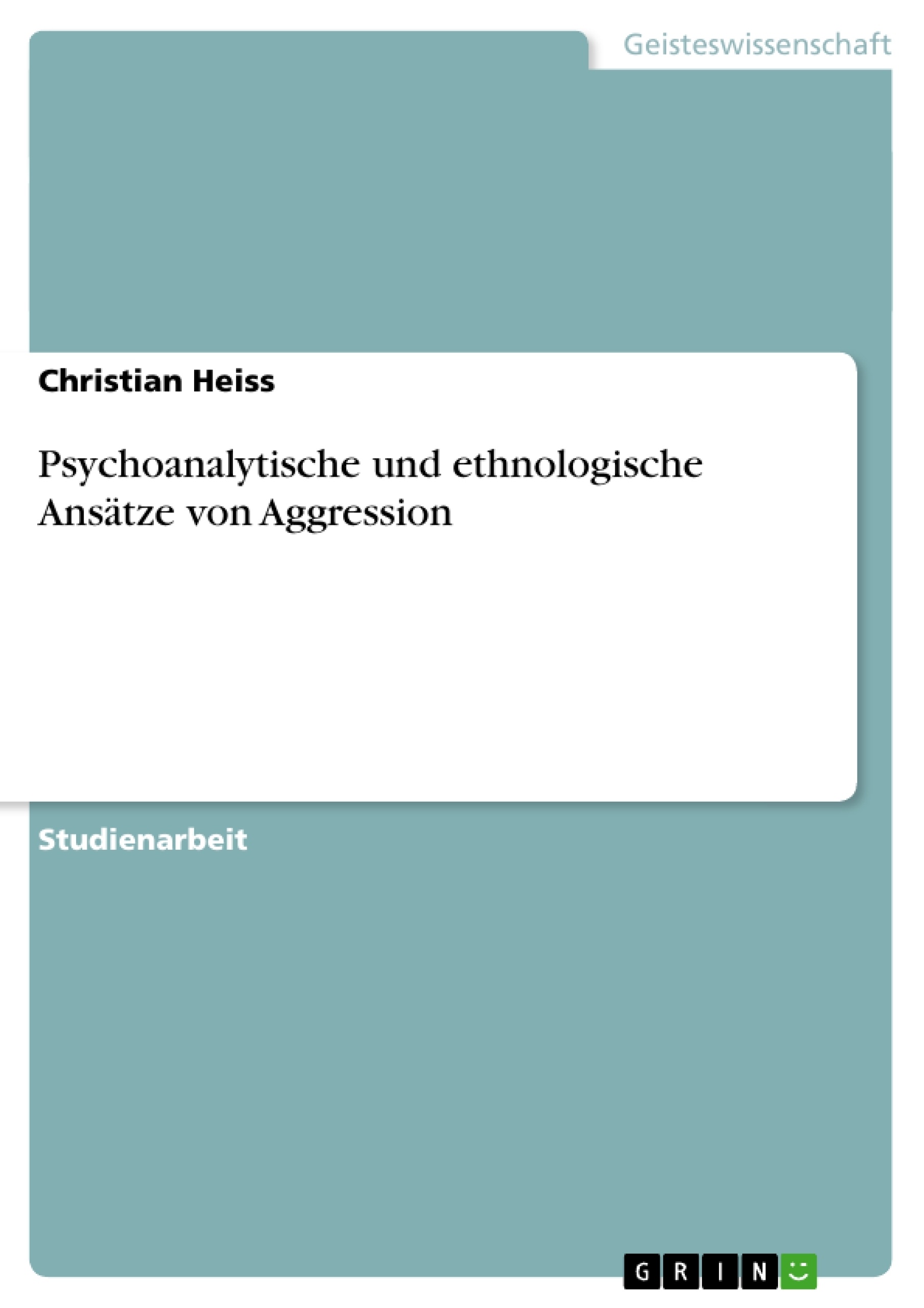Was treibt uns zur Aggression? Eine Frage, die die Menschheit seit Anbeginn beschäftigt, und die in diesem Buch einer tiefgreifenden psychoanalytischen und ethnologischen Analyse unterzogen wird. Entdecken Sie die komplexen Schichten der menschlichen Psyche, von Sigmund Freuds revolutionären Theorien über das Es, Ich und Über-Ich bis hin zu Konrad Lorenz' Beobachtungen des tierischen Verhaltens und dessen Übertragung auf den Menschen. Ergründen Sie die Wurzeln aggressiven Verhaltens, seine Triebschicksale und die Mechanismen, die es steuern – oder eben nicht. Das Buch beleuchtet Freuds dynamisches Konzept der Psychoanalyse, die Unterscheidung zwischen Sexualtrieb, Selbsterhaltungstrieb, Destruktionstrieb und Aggressionstrieb, und wie diese unser Handeln beeinflussen. Es werden die Triebschicksale wie Verkehrung ins Gegenteil, Wendung gegen die eigene Person, Verdrängung und Sublimierung erläutert und wie diese zur Entstehung von Kultur beitragen. Kritisch werden Freuds Aggressionskonzepte I und II beleuchtet, die auf dem Lustprinzip und dem Zusammenspiel von Eros und Thanatos basieren. Weiterhin werden die Konzepte von Konrad Lorenz vorgestellt, der Aggression als angeborenen Trieb mit arterhaltenden Funktionen sieht, und wie diese sich in Selektionsvorteilen, Rangordnungsbildung und räumlicher Intoleranz äußern. Die Bedeutung angeborener Hemm-Mechanismen und die Auswirkungen der Waffenentwicklung auf die menschliche Aggressionsbereitschaft werden ebenso untersucht wie die Rolle von Feindbildern und situationsabhängigem Verhalten. Eine umfassende Bewertung der psychoanalytischen und ethnologischen Ansätze zeigt die Stärken und Schwächen beider Theorien auf und plädiert für ein differenziertes Verständnis der menschlichen Aggression, das sowohl biologische als auch soziale Faktoren berücksichtigt. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die die dunklen Seiten der menschlichen Natur besser verstehen wollen. Es werden die wichtigsten Werke von Freud, Lorenz, Selg, Mees, Berg, Heckhausen, Kleiter, Nolting, Verres und Sobez berücksichtigt. Aggressionspsychologie, Psychoanalyse, Sigmund Freud, Konrad Lorenz, Triebtheorie, Ethnologie, menschliches Verhalten, Verhaltensforschung, Psychologie, Aggression, Destruktion, Triebe, Es, Ich, Über-Ich, Konflikte, Katharsis, Frustration, Gesellschaft, Normen, Werte, Zivilisation, Krieg, Gewalt, angeborene Muster, Lernen, Erziehung, soziales Verhalten, Neurose, Persönlichkeit, Charakter, Motivation, Film, Angst, Kognition und Forschung.
Wenn man Aggression psychoanalytisch erklären möchte, kommt Sigmund Freud, als Gründer der Psychoanalyse, einen zentralen Charakter zu, wenngleich auch Freuds Konzeption nicht mit
Ausgehend von dieser Überlegung möchten wir die Lehre Freuds im ersten Teil unserer Darstellung der psychoanalytischen Erklärungsmodelle von Aggression darstellen, da es zum Verständnis psychoanalytischer Ansätze von Aggression von Bedeutung ist, die „Psychoanalyse“ als übergeordnete Lehre Sigmund Freuds verstanden zu haben.
Zuerst wird der „seelische Apparat“ als ein struktureller Aspekt der Freudschen Konzeption näher erläutert.
Das Bild, das Sigmund Freud der Persönlichkeit des Menschen zu spricht, ist das Bild eines Schlachtfeldes1, auf welchem unbewusste Triebe mit gesellschaftlichen Normen kämpfen. Die Psychoanalyse beruht auf einem dynamischen Konzept, das im zweiten Teil detaillierter besprochen wird.
Abschließend zum psychoanalytischen Erklärungsmodell von Aggression, wollen wir im zweiten Teil unserer Darstellung das erste und zweite Aggressionsmodell Sigmund Freuds vorstellen und eine kritische Bewertung der „Psychoanalyse vornehmen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Persönlichkeitsunterschiede erklärt Freud, indem er sie auf unterschiedliche Art und Weise zurückführte, mit der Menschen mit ihren grundlegenden Trieben umgehen. Das Seelenleben des Menschen lies sich nach seiner Auffassung in drei Instanzen untergliedern:
1.) Ich
2.) Es
3.) Über Ich
Alle drei Instanzen zusammengenommen ergeben den „ Seelischen Apparat“2.
„ Wir nehmen an, dass das Seelenleben die Funktion eines Apparates hat [...]“3
- Das Es
Das Es wird als Sitz der primären Triebe betrachtet. Zum Es gehört demzufolge alles, was ererbt oder konstitutionell festgelegt wurde. Das Es arbeitet irrational, impulsgetrieben und drängt auf unmittelbare Befriedigung der primären Triebe. Es zieht nicht in Betracht, ob das, was begehrt wird, auch im Bereich des Möglichen liegt oder sozial erwünscht ist. Das Es besitzt keine Moral und unterliegt dem ungesteuerten Streben nach Befriedigung, besonders nach sexueller, körperlicher und emotionaler Lust.
„Das Es repräsentiert den energetischen Anteil einer Person. Seine Inhalte sind psychischer Ausdruck der Triebe [..] das einzige Streben dieser Triebe ist nach Befriedigung.“4
- Das Ich
Das Ich verkörpert den realitätsorientierten Aspekt der Persönlichkeit. Zum Ich gehören somit alle Wahrnehmungsvorgänge, sowie die willkürliche Motorik.
Die wichtigste Aufgabe des Ichs ist die Vermittlung zwischen Es und überich. Wenn Es und überich in Konflikt geraten, arrangiert das Ich einen Kompromiß, der beide zum Teil zufriedenstellt. Es wird deutlich, dass das Ich bestrebt ist Handlungen auszuwählen, die die Triebe des Es befriedigen, ohne unerwünschte Konsequenzen nach sich zu ziehen.
Im Gegensatz zum Es, das vom Lustprinzip gesteuert wird, beherrscht das Realitätsprinzip das Ich. Demzufolge werden vernünftige Entscheidungen über lustbetonte Wünsche gestellt.
„Alle Aufgaben des Ichs lassen sich unter zwei Stichworten zusammenfassen[...] Realitätsprüfung und Triebregulierung.“5
- Das Über Ich
Das Über Ich ist der Sitz der Werte und der in der Gesellschaft geltenden Normen und Werte.
Das Über Ich entspricht in etwa dem Gewissen. Es ist die innere Stimme des Menschen, das „ Du sollst“ oder „ Du sollst nicht“. Folglich liegt das Über Ich, als Repräsentant des Gewissens oft in Konflikt mit dem Es, dem Repräsentant der inneren Bedürfnisse.
Zusammenfassend kann das Über Ich als eine Art Ich Ideal angesehen werden, da es dem Bild eines Menschen entspricht, das dieser anstreben sollte.
„Diese neue psychische Instanz [...] beobachtet das Ich, gibt ihm Befehle, richtet es und droht ihm Strafen an[...] Wir heißen diese Instanz das Über Ich, empfinden sie in ihren richterlichen Funktionen, als unser Gewissen.“6
- Beziehungen zwischen Ich, Es und Über Ich
Die Beziehung zwischen Ich, Es und Über Ich verdeutlicht Freud mit dem Bild der Zwerg Ich, stehe zwischen den Riesen Es und Über Ich.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei der Beschreibung des Ichs haben wir darauf hingewiesen, dass das Ich in ständigem Kontakt mit der Umwelt steht und eine seiner wichtigsten Aufgaben als Realitätsprüfung beschrieben werden kann.
Es erscheint logisch, dass das Ich in diesem Zusammenhang die Gegenwart repräsentiert.
Im Gegensatz dazu repräsentiert das Es die organische Vergangenheit, da sein Inhalt konstitutionell festgelegt oder ererbt ist.
Das Über Ich symbolisiert in diesem Zusammenhang die kulturelle Vergangenheit des Menschen. Als Ich Ideal ist es für die Triebabfuhr durch Konzentration auf neue Objekte und Ziele verantwortlich. Wir werden auf diesen Aspekt im weiteren Verlauf noch näher eingehen, wenn wir die verschiedenen Triebschicksale besprechen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Konzept der Psychoanalyse ist ein dynamischen Konzept. Das Es, als Ort der unbefriedigten Triebe und Bedürfnisse, strebt unentwegt nach Befriedigung.
Ihm Gegenüber steht das Über Ich, das auch als Ich Ideal angesehen werden kann, das eine Gewissensfunktion übernimmt und moralischen Regeln und Werten folgt.
Verhalten kommt nach Freud in Gang, wenn ein Bedürfnis, ein Trieb entsteht. Zunächst unterscheidet Freud vier Triebe:
- Sexualtrieb
Der Sexualtrieb umfasst jede Art von körperlichem Lustgewinn. Für Freud hatte der Sexualtrieb zentralen Charakter, da er in ihm die entscheidende menschliche Triebkraft sah.
- Selbsterhaltungstrieb
Den Selbsterhaltungstrieb, setzt Freud gleichrangig neben den Sexualtrieb. Daher ist seine Trieblehre „dualistisch“.7
- Destruktionstrieb
Umfasst die Zerstörung von Objekten und ist der Gegenspieler des Sexualtriebes. Demzufolge wird sein oberstes Ziel dadurch definiert die Lust zu begrenzen.
- Aggressionstrieb
Der Aggressionstrieb übernimmt nach Freud zwei Funktionen. Erstens, die Art - und Fremdvernichtung und zweitens, die arterhaltende Funktion. Wir werden diesen auf den ersten Blick unvereinbaren Gegensatz im weiteren Verlauf unserer Ausarbeitung auflösen, wenn wir auf die positive Funktionen von Aggression nach Konrad Lorenz zu sprechen kommen.
Zuletzt unterscheidet Freud ausschließlich zwei Grundtriebe:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„Nach langem zögern haben wir uns dazu entschlossen nur zwei Grundtriebe anzunehmen; Thantalos (Todestrieb) und Eros (Lebenstrieb).“8
Jeder Trieb hat nach Freud das Ziel, möglichst schnell befriedigt zu werden. Wenn ein Trieb sein Ziel nicht direkt erreichen kann, kann er es auf Umwegen anstreben. Freud spricht in diesem Zusammenhang von Triebschicksalen .
Erstes Triebschicksal: Verkehrung ins Gegenteil
Das erste Triebschicksal betrifft das Ziel des Triebes, die Art der Befriedigung. Es kommt zu einem Übergang von Aktivität in Passivität. Beispiel: „ Aus Sadismus wird Masochismus, aus einem Täter wird ein Opfer, aus aktivem Quälen wird passives Erleiden (gequält werden),“9
Zweites Triebschicksal: Wendung gegen die eigene Person
Zentral ist ein Wechsel des Objekts, auf das sich ein Trieb bezieht. Um bei unserem zuvor gewählten Beispiel zu bleiben, würde es sich in diesem Fall um den Übergang vom Sadisten zum Masochisten handeln; jemand, der Lust darin empfindet eine andere Person zu quälen, wandelt sich in jemanden, der selbst gequält werden will.
Drittes Triebschicksal: Verdrängung
Verdrängung bezeichnet eine Operation, wodurch Bilder, Erinnerungen etc. vom Ich ins Es verschoben werden.
Viertes Triebschicksal: Sublimierung
Sublimierung ist nach Freud ein Vorgang, bei dem Energie von sexuellen Zielen umgeleitet wird. Als Sublimierungen hat Freud hauptsächlich die künstlerische Arbeit beschrieben. Er geht in seiner Annahme des weiteren davon aus, dass das Triebschicksal der Sublimierung im wesentlichen die Entstehung der menschlichen Kultur beeinflusst. Beispiele: „Der Trieb aus der frühen Kindheit Kot zu schmieren, wird umgewandelt in die Anregung ein Gemälde zu erschaffen[...]“10
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Freuds Aggressionskonzept I basiert auf einem einfachen Prinzip. Freud postuliert, daß jedem Menschen ein Lustverlangen innewohnt, das aus dem Es entspringt. Dieses Lustverlangen verlangt nach Lustbefriedigung welche wiederum in der Realität meist nicht gefunden werden kann und deshalb in Frustration umschlägt. Diese Frustration aus der verhinderten Lustbefriedigung endet in Aggression, die Frustration kann abgebaut werden.
Das Es ist die biologische Quelle, die Ich und Über-ich mit Energie speist. Der alles beherrschende Sexualtrieb ist alleiniger Kraft- und Energiespender, deshalb wird Freud’s Trieblehre auch als “monistisch” bezeichnet. Es handelt sich um einen erweiterten Sexualtrieb, der sich nicht nur auf seine phallische Komponente beschränkt, sondern auch anale und orale Teilgebiete mit einbezieht.
Das Ich steht in ständigem Konflikt mit dem Über-ich, das auch als Ideal-ich oder Strafgewissen bezeichnet werden könnte und dem oben beschriebenen Es. Das ich muss sich stets gegen die Ansprüche wehren, die Es und Über-ich an es stellen. Die im Ich enthaltenen Ich- oder Selbsterhaltungstriebe erfüllen diese Aufgabe. Doch auch die Realität stellt Anforderungen an das Ich. Das durch die Libido erzeugte Lustverlagen wird in der Realität (=>Wahrnehmung) oft nicht befriedigt (Realitätsprinzip => Triebaufschub und Triebschicksale) und kann vom Ich nur durch Aggression (Motorik) verarbeitet werden. Die Aggression richtet sich an die Außenwelt, kann sadistisch oder masochistisch, aber auch oral, anal, phallisch oder ödipal sein.
(Quelle: Ekkehard F. Kleiter “Film und Aggression - Aggressionspsychologie”. Beltz 1997. Kap. 14, S. 547-551)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Freud’s Aggressionskonzept II beruht nur auf dem Es, welches den Lebenstrieb Eros inklusive Libido, Sexual- und Selbsterhaltungstrieb sowie den Todestrieb Thantalos inklusive Destrudo, dem Destruktions und Aggressionstrieb beinhaltet. Diese stehen im Idealfall im Gleichgewicht, dem sogenannten Nirwana (Nirwanaprinzip). Der Lebenstrieb strebt nach ständiger Erneuerung des Lebens, wohingegen der Todestrieb verlangt: “Ziel des Lebens ist der Tod”.
Verlagert sich das Gleichgewicht im Es zu Gunsten des Thantalos, sucht sich der Aggressionstrieb ein Objekt, das seine Befriedigung möglich macht. Dieses Objekt kann auch gesellschaftlich toleriert sein, wie z. B. Fußball oder Boxen, ist dies aber oft nicht. Die Objektwahl ermöglicht Aggression und zwar auf 2 verschiedenen Wegen. Es besteht die Möglichkeit der Außen-Aggression, dem Sadismus, aber auch der Autoaggression, dem Masochismus, der sogar in Suicid enden kann. Ist jedoch die Aggression ausgelebt, findet ein Spannungsabbau, eine Katharsis statt, die eine “Reinigung von der Triebspannung” ermöglicht. Alles wird wieder friedlich und das Gleichgewicht zwischen Eros und Thantalos ist wieder hergestellt.
Freud’s Aggressionskonzepte werden auch als Mythologien bezeichnet, in denen die Triebe als Mythen agieren. Die Triebe haben 4 Aspekte:
1) Quelle: erregbare (erogene) Zonen: Mund, After und Genitalien
2) Drang: Kraft des Triebs (das drängende Moment
3) Ziel: Befriedigung durch Aufhebung des Reizzustandes an der Triebquelle.
4) Objekt: das, an welchem oder durch welches der Trieb sein Ziel erreichen kann.
(Quelle: Ekkehard F. Kleiter “Film und Aggression - Aggressionspsychologie”. Beltz 1997. Kap. 14, S. 551-553)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Freud entwickelte seine psychoanalytischen Triebtheorien über einen längeren Zeitraum. Von 1902-1911 arbeitete Freud mit Adler in Wien zusammen. Freud und Adler untersuchten die menschliche Aggressivität aus psychoanalytischer Sicht. 1905 postulierte Freud, daß die Aggression eine Komponente der Sexualität sei. Auch noch 1915 war Aggression nur eine Komponente eines anderen Triebs und zwar des Ich-Triebs. Erst durch die Erlebnisse und Eindrücke des 1. Weltkriegs korrigierte Freud seine Meinung. 1920 bezeichnete Freud die Aggression zum ersten Mal als selbständigen Trieb und zwar als den Todestrieb (Thantalos, Destrudo), den Gegenspieler des Eros. Ab diesem Zeitpunkt hatte der Todes- und Destruktionstrieb große Bedeutung in Freud’s dualistischer Trieblehre. 1930 bezeichnete Freud den Aggressionstrieb als zentralen Vertreter des Destruktionstriebes, wie er auch heute noch in Freud’s Trieblehre dargestellt wird.
Nachdem Sigmund Freud von Albert Einstein zum Gedankenaustausch bezüglich des bevorstehenden 2. Weltkrieges aufgefordert wurde, schrieb er in Wien 1932 einen langen Brief an Einstein, aus dem auch die oben genannten Zitate stammen. Freud entwickelt einige sehr interessante Gedanken, die Hauptaussage ist aber, daß Freud den Krieg für unvermeidbar hält, da seine Wurzeln angeboren sind und daß Freud auch der Meinung ist, daß die Unterdrückung von Aggression krank macht. Man kann lediglich versuchen, sie so abzulenken, daß sie nicht im Krieg endet. Als Idealzustand empfindet Freud “eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Triebleben der Diktatur der Vernunft unterworfen haben”
(Quelle: Herbert Selg, Ulrich Mees und Detlef Berg “Psychologie der Aggressivität”. Hogrefe 1997. Kap. 2.1, S. 18-20)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eine Bewertung der Persönlichkeitstheorie Sigmund Freuds ist zweigeteilt: Einerseits hat die Theorie das Denken der Psychologie weitreichend beeinflusst, andererseits müssen wir aus heutiger Sicht der kognitiven Psychologie allerdings annehmen, dass die Psychoanalyse Sigmund Freuds reichlich spekulativ und als überholt angesehen werden kann.
Es muss allerdings deutlich die Einschränkung vorgenommen werden, dass Kognitionen im Laufe der historischen Entwicklung der Psychologie zunehmend thematisiert wurden und das kognitive Paradigma z.B. auch in der Angstforschung vorherrschend ist, die kognitive Psychologie allerdings nicht die Psychologie per se darstellt.
Innerhalb der kritischen Auseinandersetzung mit dem Freudschen Triebkonzept, beschränken wir uns auf Hauptkritikpunkte:
- Die selektive Datenbasis
Freud hat sein System aus klinischen Fallmaterial entwickelt. Grundlage seiner Interpretationen waren Aussagen, Rekonstruktionen und Interpretationen seiner Klienten.
„Diese Datenbasis ist selektiv, [...] Freud sammelte seine Informationen bei Neurotikern. Seine Schlussfolgerungen, sein Persönlichkeitsmodell formulierte er hingegen in Aussagen, die generell gültig sein sollten [...]11
Darüber hinaus stammte Freuds Klientel im Unterschied zu Adler aus einer gehobenen Schicht.
- Interpretations- und Dokumentationsproblem
Viele Begriffe innerhalb der Psychoanalyse sind vage formuliert und daher nur schwer zu operationalisieren. Folglich ist die Theorie kaum mit den Methoden der empirischen Wissenschaften zu überprüfen. Hinzu kommt das Dokumentationsproblem, denn Freud machte seine Notizen regelmäßig erst Abends nach den Sitzungen mit seinen Klienten. Dies spricht eindeutig gegen eine objektive bzw. zuverlässige Informationsspeicherung.
- Vernachlässigung von Kindern und Frauen
Obwohl Freuds theoretisches System in wesentlichen Teilen eine Entwicklungstheorie ist, hat er niemals mit Kindern gearbeitet. Hinzu kommt, dass in seiner Theorie die Welt mit den Augen von Männern gesehen wird. Männliches Erleben und Handeln wird als Norm gesetzt, ohne die Hypothese zu prüfen, dass Frauen anders sein können.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der biologisch-ethnologische Ansatz von Konrad Lorenz (1963) beruht auf der Beobachtung von Tieren, vor allem von niedrigen und höheren Säugern und nichtmenschlichen Primaten.
Der Nobelpreisträger Konrad Lorenz ist der Meinung, daß Aggression angeboren ist und auch nicht durch Erziehung und Lernen zu entfernen ist. Es besteht aber die Möglichkeit, der Kanalisierung in unschädliche Bahnen, wie z. B. Sport.
Die Aggression des Menschen ist ein Evolutionsprodukt der Stammesgeschichte und wird durch angeborene Auslösemechanismen hervorgerufen, diese sind artspezifisch, was bedeutet, daß es keinen generellen Auslösereiz gibt.
Laut Lorenz gibt es einen Selektionsaspekt, der das Fortbestehen, des eigenen Genmaterials in genetisch verwandten Artgenossen ermöglicht. Lorenz nennt dies “Sippenselektion”. Hieraus entsteht ein selektiver Vorteil. Ein weiterer Bestandteil ist die Beuteaggression, die ebenfalls nur dazu da ist, das eigene Überleben und das Fortbestehen des Genmaterials zu sichern.
Lorenz ist der Meinung, daß persönliche Bekanntschaft aggressionshemmend wirkt. Begrüßungsrituale sind Beweise, daß durch Bekanntschaft und “Besänftigung” Aggression vermieden wird. Es fällt den Lebewesen schwer, Bekannten etwas anzutun. Laut Lorenz wird diese Aggressionshemmung aufgehoben, wenn man den Gegenüber als fremd und feindlich empfindet. Auf den Menschen übertragen meint er, daß die Erfindung der Waffe die Tötungshemmung beim Menschen aufhebt, der Mensch tötet leichter, wenn er mit seinem Gegner keinen persönlichen Kontakt hat.
(Quelle: Heinz Heckhausen “Motivation und Handeln”. Springer Verlag 1988. Kap. 10, S. 308)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„Das sogenannte Böse.“ Schon der Titel seines Buches (1963), lässt erahnen , dass Lorenz der Aggression durchaus positive Aspekte zu spricht. Als Ethnologe begründete er seine These, der arterhaltenden Funktion der Aggression zunächst mit der Beobachtung, dass aggressives Verhalten regelmäßig gezeigt wird.
Seine Schlussfolgerung: Aggression, als wiederkehrendes Verhalten, entwickelt sich nicht grundlos, sondern mit bestimmten Funktionen. Ableitbar sind somit die positiven Funktionen der Aggression:
1) Selektionsvorteile
Durch Rivalenkämpfe innerhalb der Paarungs- und Fortpflanzungsperiode, werden die Stärksten und Gewandtesten Männchen ausgelesen. Es erscheint einsichtig, dass dies der Nachkommenschaft direkt zu Gute kommt, denn starke Männchen besitzen günstigere Vererbungsmerkmale und sind besser in der Lage die Nachkommenschaft zu verteidigen.
2) Ausbildung einer Rangordnung
Bei höheren Wirbeltieren lassen sich auch Kämpfe innerhalb einer Gruppe beobachten. Sie führen zur Ausbildung einer Rangordnung, wobei die ranghohe Position nicht nur Annehmlichkeiten, sondern auch Verpflichtungen mit sich bringt. Auch hier leuchtet ein, dass gesunde, starke Individuen diese Aufgabe am besten erfüllen.
„Nur die stärksten Männchen gelangen zur Paarung, daher werden nur optimale Anlagen vererbt.“12
3) Räumliche Intoleranz
Tiere beanspruchen ein bestimmtes Territorium. Auf eine Verletzung der Grenzen des Territoriums, folgt aggressives Verhalten des Tieres. Diese räumliche Intoleranz führt dazu, dass die Tiere sich über ein größeres Gebiet verteilen und dabei selbst weniger günstigere Randgebiete erschließen.
„Der Aggressionstrieb garantiert eine optimale Ausnutzung der ökologischen Nische.“13
Die Lorenz arterhaltenden Funktion der Aggression verdeutlicht Lorenz zudem mit der Feststellung, dass mit Hilfe angeborener Hemm Mechanismen eine Tötung des Gegners vermieden wird. Hunde beispielsweise besitzen instinktiv Mittel zur Aggressionsbeschwichtigung, indem sie Demutsverhalten zeigen. Aggressives Verhalten zielt daher nicht auf Vernichtung des Gegners.
Auch beim Menschen sind angeborene Hemm - Mechanismen zu beobachten. Es besteht eine Hemmung jemanden anzugreifen. Der einem nichts zu Leide getan hat. In diesem Fall provoziert der Aggressive durch leicht aggressive Akte (Bsp: Hänseln, veralbern etc.) einen Vorfall, der dann eine massive Gegenaggression rechtfertigt.
Sollten allerdings die angesprochenen Hemm - Mechanismen beim Menschen tatsächlich wirksam sein, wie lässt sich ausgehend von diesem Ansatz dann eine kriegerische Handlung oder generell eine Tötung erklären?
Nach Lorenz läutet die Erfindung der Waffe eine Zäsur ein, da die Tötungshemmung beim Menschen sich im Lauf der Stammesgeschichte entwickelte und auf körperliche Fähigkeiten abgestimmt ist.
Darüber hinaus ist der Mensch ein kopfgesteuertes Wesen und er besitzt dank seines hochentwickelten Gehirns die besondere Fähigkeit in seinem Hirn irreale Wirklichkeiten aufzubauen. Er kann sich zum Beispiel einreden, dass die Mitglieder einer feindlichen Gruppe gar keine Menschen sind und redet er sich das oft genug ein, dann glaubt er auch daran.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus ethnologischer Sicht ist die Annahme eines angeborenen Feindschemas sinnvoll: Graphisch ließe sich das Feindschema wie folgt darstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Beobachtungen an taubblinden Kindern, lassen den Schluss zu, dass dieses Feindschema beim Menschen angeboren ist, da sie diese Reaktion bekannt = freund, d.h. Zustimmung und fremd = feind, d.h. Ablehnung zeigten, ohne dass es dazu schlechte Erfahrungen mit Fremden voraus gegangen sein mussten.
Als weiteres Indiz der These des angeborenen Feindschemas kann angefügt werden, dass Menschen, die in einer Gesellschaft zusammenleben unentwegt andere durch freundliche Rituale wie grüßen oder loben beschwichtigen. Versäumen wir zum Beispiel zu grüßen, so werden wir leicht Zielscheibe von Aggressionen.
Darüber hinaus konnten kulturübergreifende Studien zeigen ,dass die Äußerung von Aggression beim Menschen vergleichbar ist. Fäuste ballen, senkrechte Stirnfalten oder submissive Verhaltensweisen, sind typische Äußerungen, die auf Aggression schließen lassen.
Vergleichende Studien des aggressiven Verhaltens beim Menschen und Affen zeigten, dass Aggression auch situationsabhängig sein kann. Demnach tritt Aggression in folgenden Situationen bevorzugt auf:
- Konkurrenz um Nahrung
- Verteidigung eines Jungen
- Kampf um Vormachtstellung
- Weitergabe erlittener Aggression an Rangniedere
- Eindringen eines Fremden
- Paarbildung
- Wechsel im Ranggefüge
Abschließend wollen wir in einer kritischen Würdigung ethnologischer Ansätze von Aggression die Frage klären, ob der Analogieschluss vom tierischen zum menschlichen Aggressionsverhalten überhaupt zulässig ist?
Selg und Nolting weisen darauf hin, dass die ethnologischen Ansätze in ihrer Erklärung aggressiven Verhaltens jegliche empirische Fundierung vermissen lassen.
„Die sorgfältige empirische Fundierung [...] wurde bei Beschäftigung mit der menschlichen Aggression durch voreilige Schlüsse und anekdotenhafte Erzählungen ersetzt.“14
Nach Selg kann komplexes menschliches Verhalten nicht mittels einer stark verkürzten und vereinfachten Darstellung ausschließlich anhand eines Triebes erklärt werden. Das Vorgehen der ethnologischen Theorien zur Erklärung menschlicher Aggression „Trieblisten“15 zu erstellen, setzt er gleich mit dem Vorgehen der Allzweck - Psychologie, die ohne empirische Begründung leicht verständliche Erklärungsmodelle für alle möglichen Zusammenhänge und Probleme liefert.
Triebtheorien sind aber auch deshalb so populär, weil sie jedermann eine handliche Allzweck - Psychologie liefern. Man sieht Kinder spielen und spricht von einem Spieltrieb[...] Die Erstellung solcher Treiblisten, für deren Abschluss jedes Kriterium fehlt, als müßiges Spiel, nicht aber als wissenschaftliche Arbeit verstanden werden.“16
Entgegen der Meinung von Triebtheoretikern, ist aggressives Verhalten nach Selg ausschließlich eine „intensive Handlung“17, die ein Mensch zeigt, um sich durchzusetzen.
Verres und Sobez kritisieren ebenfalls den Triebtheoretischen Ansatz zur Erklärung menschlicher Aggression. Sie sind vielmehr der Auffassung, dass eine Gleichsetzung des tierischen Aggressionsverhaltens in Bezug auf den Menschen unzulässig ist, da der Mensch seine Motivation zur Aggression im Gegensatz zum Tier nicht aus einem Trieb, sondern aus sozialen Erfahrungen erhält. Ihre These stützt sich hierbei auf die bessere und schnellere Lernfähigkeit des Menschen.
Darüber hinaus bemängelt Nolting, dass Treibtheoretiker für aggressives Handeln des Menschen keinen biologischen Nachweis anfügen, auf diesen sich ihre Theorie stützt.
„Anders als bei vielen biologischen Bedürfnissen hat man im Gehirn des normalen Menschen auch keine Zentren und Vorgänge gefunden, die [...] eine spontan wirkende Aggressionsquelle sein könnten.“18
Nolting unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen „ angeborenen Grundlagen“19 wie Lernfähigkeiten oder motorische Elemente und spontaner Triebquelle20 .
Vergleichende Studien zum Aggressionsverhalten des Menschen zeigen, dass es „ keineswegs eine einheitliche aggressive Natur des Menschen21 gibt. Folglich ist es nach Nolting wesentlich interessanter den Schwerpunkt auf „die riesigen Unterschiede zwischen den Kulturen und Individuen“22 zur Erklärung der Aggression zu legen.
Auch die Annahme, dass mit der Ausführung aggressiver Verhaltensweisen ein Triebstau abgebaut werden kann und es somit zu einer Entspannung kommt, ist umstritten.
Als Beispiel führt Selg an, dass es für diese These sprechen sollte, dass Berufsboxer im Alltag außerordentlich friedfertig sein sollten. Tatsächlich ist allerdings der Umkehrschluss korrekt: Sehr viele Berufsboxer sind im Alltag in kriminelle Delikte verwickelt.
Verres und Sobez weisen in diesem Zusammenhang auf eine „ signifikante Zunahme der Aggressionsbereitschaft von Zuschauern nach verschiedenen Kampfspielen“23 hin.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass sowohl psychoanalytische, als auch ethnologische Ansätze zur Erklärung menschlicher Aggression kritisch hinterfragt werden müssen. Beide theoretischen Ansätze haben in ihrer Argumentation Stärken und Schwächen und es wird deutlich, dass das komplexe Konstrukt Aggression beim Menschen nicht ausschließlich aufgrund von ethnologischen oder psychoanalytischen Erklärungsmodellen erfasst werden kann.
Literaturverzeichnis
- Fisseni, H.J. (1997) Persönlichkeitspsychologie: auf der Suche nach einer Wissenschaft; ein Theorieüberblick Göttingen: Hogrefe
- Freud, S. (1946) Abriß der Psychoanalyse. Gesammelte Werke, XVII London: Imago
- Heckhausen H. (1988) “Motivation und Handeln”. Hamburg: Springer
- Kleiter, E.F. (1997) “Film und Aggression - Aggressionspsychologie”. Beltz
- Selg, H., Mees U., Berg D. (1997) “Psychologie der Aggressivität”. Göttingen: Hogrefe
- Lorenz, K. (1963) Das sogenannte Böse. „Zur Naturgeschichte der Aggression“
- Nolting, H.P. (1978) Lernfall Aggression. Wie sie entsteht - wie sie zu vermeiden ist Reinbeck: Rowohlt
- Verres,R., Sobez I (1980) Ärger, Aggression und soziale Kompetenz: Zur konstruktiven Veränderung aggresiven Verhaltens Stuttgart: Klett - Cotta
[...]
1 Fisseni, H.J. (1997) Persönlichkeitspsychologie: auf der Suche nach einer Wissenschaft; ein Theorieüberblick S.32. Göttingen: Hogrefe
2 Freud, S. (1946) Abriß der Psychoanalyse. Gesammelte Werke, XVII, S.63-138. London: Imago
3 Freud, S. (1946) Abriß der Psychoanalyse. Gesammelte Werke, XVII, S.63-138. London: Imago
4 Fisseni, H.J. (1997) Persönlichkeitspsychologie: auf der Suche nach einer Wissenschaft; ein Theorieüberblick S.32. Göttingen: Hofgrefe
5 Fisseni, H.J. (1997) Persönlichkeitspsychologie: auf der Suche nach einer Wissenschaft; ein Theorieüberblick S.34 Göttingen: Hogrefe
6 Freud, S. (1946) Abriß der Psychoanalyse. Gesammelte Werke, XVII, S.136 -138. London: Imago 4
7 Fisseni, H.J. (1997) Persönlichkeitspsychologie: auf der Suche nach einer Wissenschaft; ein Theorieüberblick S.38 Göttingen: Hogrefe
8 Freud, S. (1946) Abriß der Psychoanalyse. Gesammelte Werke, XVII, S.70 - 71 London: Imago
9 Fisseni, H.J. (1997) Persönlichkeitspsychologie: auf der Suche nach einer Wissenschaft; ein Theorieüberblick S.39 Göttingen: Hogrefe
10 Fisseni, H.J. (1997) Persönlichkeitspsychologie: auf der Suche nach einer Wissenschaft; ein Theorieüberblick S.39 Göttingen: Hogrefe
11 Fisseni, H.J. (1997) Persönlichkeitspsychologie: auf der Suche nach einer Wissenschaft; ein Theorieüberblick S.53 Göttingen: Hogrefe
12 Lorenz, K. (1963) Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression S.57
13 Lorenz, K. (1963) Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression S.66
14 Nolting, H.P. (1978) Lernfall Aggression. Wie sie entsteht - wie sie zu vermeiden ist Reinbeck: Rowohlt
15 Selg, H., Mees U., Berg D. (1997) “Psychologie der Aggressivität”. Göttingen: Hogrefe
16 Selg, H., Mees U., Berg D. (1997) “Psychologie der Aggressivität”. Göttingen: Hogrefe
17 Selg, H., Mees U., Berg D. (1997) “Psychologie der Aggressivität”. Göttingen: Hogrefe
18 Nolting, H.P. (1978) Lernfall Aggression. Wie sie entsteht - wie sie zu vermeiden ist Reinbeck: Rowohlt
19 Nolting, H.P. (1978) Lernfall Aggression. Wie sie entsteht - wie sie zu vermeiden ist Reinbeck: Rowohlt
20 Nolting, H.P. (1978) Lernfall Aggression. Wie sie entsteht - wie sie zu vermeiden ist Reinbeck: Rowohlt
21 Nolting, H.P. (1978) Lernfall Aggression. Wie sie entsteht - wie sie zu vermeiden ist Reinbeck: Rowohlt
22 Nolting, H.P. (1978) Lernfall Aggression. Wie sie entsteht - wie sie zu vermeiden ist Reinbeck: Rowohlt
Häufig gestellte Fragen
Was ist der "seelische Apparat" nach Freud?
Der "seelische Apparat" ist Freuds strukturelles Modell der Psyche, bestehend aus drei Instanzen: dem Es, dem Ich und dem Über-Ich. Alle drei Instanzen zusammengenommen ergeben den "Seelischen Apparat".
Was sind die drei Instanzen des "seelischen Apparats"?
Die drei Instanzen sind:
- Das Es: Sitz der primären Triebe, irrational und impulsgetrieben, strebt nach unmittelbarer Befriedigung.
- Das Ich: Realitätsorientierter Aspekt der Persönlichkeit, vermittelt zwischen Es und Über-Ich, gesteuert vom Realitätsprinzip.
- Das Über-Ich: Sitz der Werte und Normen der Gesellschaft, entspricht dem Gewissen, oft im Konflikt mit dem Es.
Welche Triebe unterscheidet Freud?
Zuerst unterscheidet Freud vier Triebe: Sexualtrieb, Selbsterhaltungstrieb, Destruktionstrieb und Aggressionstrieb. Zuletzt unterscheidet Freud ausschließlich zwei Grundtriebe: Thantalos (Todestrieb) und Eros (Lebenstrieb).
Was sind Triebschicksale nach Freud?
Triebschicksale sind die Umwege, die ein Trieb einschlagen kann, wenn er sein Ziel nicht direkt erreichen kann. Freud unterscheidet vier Triebschicksale: Verkehrung ins Gegenteil, Wendung gegen die eigene Person, Verdrängung und Sublimierung.
Was ist Freuds erstes Aggressionskonzept?
Freuds Aggressionskonzept I basiert darauf, dass jedem Menschen ein Lustverlangen innewohnt, das aus dem Es entspringt. Wenn dieses Lustverlangen nicht befriedigt werden kann, entsteht Frustration, die in Aggression umschlägt. Das Ich muss sich stets gegen die Ansprüche wehren, die Es und Über-ich an es stellen. Die im Ich enthaltenen Ich- oder Selbsterhaltungstriebe erfüllen diese Aufgabe. Doch auch die Realität stellt Anforderungen an das Ich. Das durch die Libido erzeugte Lustverlagen wird in der Realität oft nicht befriedigt und kann vom Ich nur durch Aggression (Motorik) verarbeitet werden.
Was ist Freuds zweites Aggressionskonzept?
Freuds Aggressionskonzept II beruht nur auf dem Es, welches den Lebenstrieb Eros inklusive Libido, Sexual- und Selbsterhaltungstrieb sowie den Todestrieb Thantalos inklusive Destrudo, dem Destruktions und Aggressionstrieb beinhaltet. Diese stehen im Idealfall im Gleichgewicht, dem sogenannten Nirwana (Nirwanaprinzip). Der Lebenstrieb strebt nach ständiger Erneuerung des Lebens, wohingegen der Todestrieb verlangt: “Ziel des Lebens ist der Tod”.
Welche Kritik gibt es an Freuds Persönlichkeitstheorie?
Hauptkritikpunkte sind:
- Selektive Datenbasis: Freud entwickelte sein System aus klinischem Fallmaterial (Neurotiker).
- Interpretations- und Dokumentationsproblem: Viele Begriffe sind vage formuliert und schwer zu operationalisieren, Dokumentation erfolgte oft erst abends nach den Sitzungen.
- Vernachlässigung von Kindern und Frauen: Freud hat nie mit Kindern gearbeitet und seine Theorie sieht die Welt aus männlicher Perspektive.
Was ist Konrad Lorenz' Sicht auf Aggression?
Konrad Lorenz vertritt einen biologisch-ethnologischen Ansatz und sieht Aggression als angeboren und durch angeborene Auslösemechanismen hervorgerufen. Er geht von einer arterhaltenden Funktion der Aggression aus.
Welche positiven Funktionen der Aggression sieht Konrad Lorenz?
Lorenz sieht folgende positive Funktionen:
- Selektionsvorteile: Stärkste Männchen setzen sich bei der Paarung durch.
- Ausbildung einer Rangordnung: Kämpfe innerhalb der Gruppe führen zu einer Rangordnung.
- Räumliche Intoleranz: Tiere beanspruchen Territorium, wodurch sie sich über ein größeres Gebiet verteilen.
Wie erklärt Lorenz kriegerische Handlungen beim Menschen?
Lorenz erklärt kriegerische Handlungen mit der Erfindung der Waffe, die die Tötungshemmung beim Menschen aufhebt, da diese sich im Laufe der Stammesgeschichte entwickelte und auf körperliche Fähigkeiten abgestimmt ist.
Welche Kritik gibt es an ethnologischen Ansätzen von Aggression?
Kritikpunkte sind:
- Mangelnde empirische Fundierung: Voreilige Schlüsse und anekdotenhafte Erzählungen.
- Vereinfachte Darstellung: Komplexes menschliches Verhalten wird auf einen Trieb reduziert.
- Unzulässige Gleichsetzung: Tierisches Aggressionsverhalten wird unkritisch auf den Menschen übertragen.
- Arbeit zitieren
- Christian Heiss (Autor:in), 2000, Psychoanalytische und ethnologische Ansätze von Aggression, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104601