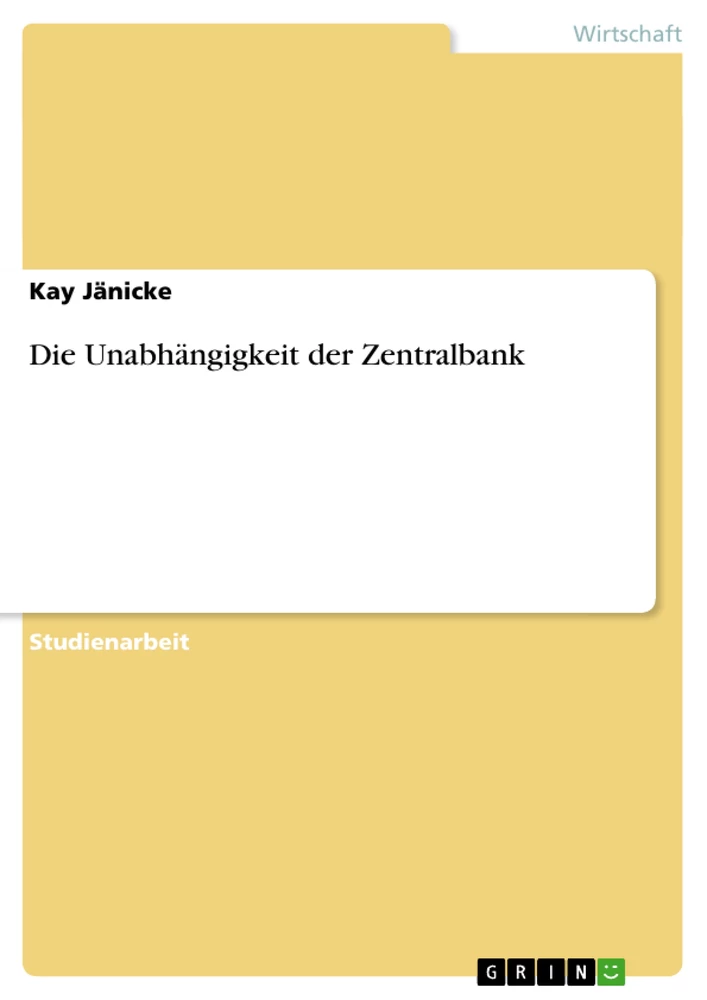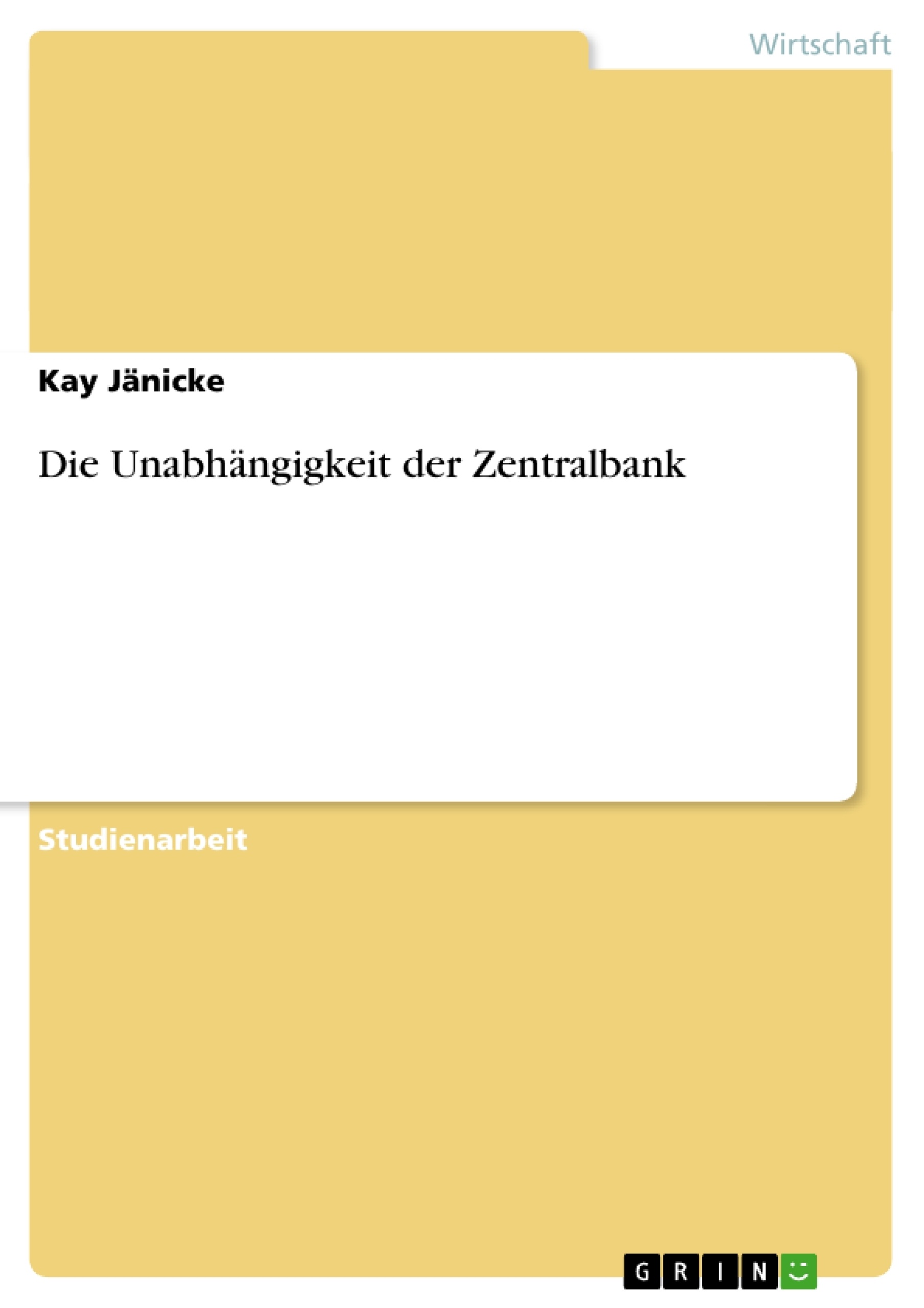Was wäre, wenn die Stabilität unserer Währung mehr von politischen Fäden als von ökonomischen Prinzipien abhinge? Diese brisante Frage steht im Zentrum einer tiefgreifenden Analyse der Notenbankunabhängigkeit, ein Thema, das in Zeiten globaler Finanzkrisen und politischer Unsicherheiten von grösster Relevanz ist. Die vorliegende Untersuchung beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen der Autonomie von Zentralbanken und der Inflationsrate, indem sie historische Ereignisse, theoretische Modelle und empirische Befunde miteinander verknüpft. Beginnend mit den traumatischen Erfahrungen der Hyperinflation des 20. Jahrhunderts, zeichnet die Arbeit die Entwicklung unabhängiger Notenbanksysteme nach, insbesondere die der Deutschen Bundesbank, deren Erfolgsmodell massgeblich die Europäische Zentralbank (EZB) prägte. Dabei werden die verschiedenen Dimensionen der Unabhängigkeit – politische, funktionelle, personelle und finanzielle – detailliert analysiert und ihre Auswirkungen auf die Geldpolitik untersucht. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich der EZB mit der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), um die unterschiedlichen Grade der Unabhängigkeit und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Preisstabilität zu verdeutlichen. Kritische Aspekte wie die Kreditvergabe an öffentliche Haushalte, Interventionen am Devisenmarkt und administrative Zinsfestlegungen werden ebenso erörtert wie die Bedeutung einer langfristigen und stabilitätsorientierten Geldpolitik. Abschliessend werden empirische Studien präsentiert, die den Zusammenhang zwischen Notenbankunabhängigkeit und Inflationsrate untersuchen, und es wird die Frage beantwortet, ob Unabhängigkeit eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für eine erfolgreiche Antiinflationspolitik darstellt. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die die Mechanismen der Geldpolitik verstehen und die Rolle unabhängiger Zentralbanken in einer zunehmend volatilen Welt kritisch hinterfragen wollen. Es bietet wertvolle Einblicke für Ökonomen, Politiker, Journalisten und interessierte Bürger, die sich ein fundiertes Urteil über die Zukunft unserer Währungen bilden möchten. Tauchen Sie ein in die Welt der Geldpolitik, der Zentralbanken, der Finanzmärkte, der Inflation und der Währungsstabilität.
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Abkürzungen
1. Einleitung
2. Aufgaben und Ziele einer Notenbank
3. Geschichte
4. Die Unabhängigkeit einer Notenbank
4.1 Politische Unabhängigkeit einer Notenbank
4.1.1 Funktionelle Unabhängigkeit
4.1.2 Personelle Unabhängigkeit
4.1.3 Finanzielle Unabhängigkeit
4.2 Ökonomische Unabhängigkeit einer Notenbank
4.2.1 Kreditvergabe an öffentliche Haushalte
4.2.2 Interventionen am Devisenmarkt durch die Regierung
4.2.3 administrative Znsfestlegung
5. Vergleich der EZB und der RBNZ bezüglich der Unabhängigkeit und der daraus entstehenden Konsequenzen
6. Empirischer Befund
7. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Der zweite Weltkrieg in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts hatte zum Teil verheerende Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung Europas. Insbesondere in Deutschland war auf politischer und gesellschaftlicher, vor allem jedoch auf wirtschaftlicher Ebene ein vollständiger Neuaufbau erforderlich.
Auf der Basis einer stabilen Geldpolitik bediente man sich dazu der Erfahrungen aus der Vorkriegszeit und schon bald begann ein wirtschaftlicher Aufschwung, der bis heute seines gleichen sucht.
Die Basis für diesen Aufschwung war die Schaffung eines neuen, einstufigen Zentralbanksystems am 26. Juli 1957 mit dem Gesetz über die Deutsche Bundesbank.1
Um der Verantwortung als „Hüterin der Deutschen Mark“ gerecht zu werden, mußte die neu geschaffene Notenbank mit umfassenden Rechten ausgestattet werden. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war die der neuen Notenbank Deutschlands gewährte Unabhängigkeit. Nur mit dieser Maßnahme war eine vollständige Umsetzung ihrer Ziele möglich .2
Die durchschlagenden Erfolge in geldpolitischer und wirtschaftlicher Hinsicht führten zu internationaler Anerkennung dieses Institutes. Aus diesem Grund wurden die wesentlichen Elemente des Bundesbankgesetzes heute im EGV bezüglich der Europäischen Zentralbank übernommen.3
Insbesondere die Unabhängigkeit der Bundesbank ist in dieser Hinsicht heute noch von entscheidender Bedeutung
Um die Bedeutung dieser Unabhängigkeit einer Zentralbank objektiv einschätzen zu können, bedarf es zunächst einer Analyse ihrer Aufgaben und Ziele.
Eine Grobdarstellung der geschichtlichen Ereignisse im Laufe des letzten Jahrhunderts begründet die Intention, eine unabhängige Notenbank zu installieren.
Daran anschließend sind die unterschiedlichen Aspekte der Unabhängigkeit zu differenzieren und wie sie im einzelnen bewirkt werden. Weiterhin werden alternative Notenbankkonzepte vorgestellt, um den anschließend erläuterten empirisch begründeten Zusammenhang zwischen der Unabhängigkeit der Institute und der Inflationsrate der jeweiligen Währung zu verdeutlichen.
2. Aufgaben und Ziele einer Notenbank
Die Hauptaufgaben einer Notenbank bestehen in der Emission von Banknoten und der Wahrung der Stabilität des Finanzsektors.
Sie soll den reibungslosen Ablauf des Zahlungsverkehrs fördern, die Währungsreserven des Landes verwalten und hat zugleich Beratungsfunktion für die politischen Organe. Weiterhin ist die Zentralbank zuständig für die Bankenaufsicht.
Das primäre Ziel einer Notenbank ist die Gewährleistung der Preisstabilität innerhalb der Volkswirtschaft und, dem untergeordnet, die Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik.4
Aufgrund der Zuständigkeit für die Sicherung des Geldwertes nennt man sie auch die Hüterin der Währung.
3. Geschichte
Unter den Folgen einer instabilen Währung mußte die Bevölkerung Deutschlands in diesem Jahrhundert schon mehrfach leiden.5 Verheerende Folgen hatte die inflationäre Entwicklung nach den zwei Weltkriegen vor allem für den ärmeren Teil der Bevölkerung und für diejenigen, die ihre Barmittel nicht rechtzeitig in Sachwerte umwandeln konnten. Diese Hyperinflationen und die damit verbundene Entwertung der Reichsmark sensibilisierte die in Deutschland lebenden Menschen gegenüber ihrer Währung.6
Sie veränderten das wirtschaftliche Denken und Handeln der Deutschen und die Geldwertstabilität gewann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erheblich an Bedeutung. Man erkannte, daß das Geld in seinen Funktionen als Wertaufbewahrung- und Tauschmittel, als Grundlage für Investitionen und Wirtschaftswachstum und als Verrechnungsbasis für für die notwendigen Kapitalströme im internationalen Handel nur wirksam ist, wenn sein Wert stabil ist.
Es wurde eine unabhängige Notenbank mit der Hauptaufgabe der Sicherung der Geldwertstabilität gebraucht, welche später mit der Bundesbank entstand. Nach der Währungsreform 1948 und der Schaffung eines neuen Zentralbanksystems im damaligen Westdeutschland wurde das Bundesbankgesetz erarbeitet und 1957 in Kraft gesetzt. Weil man um die Bedeutung der Unabhängigkeit der Zentralbank wußte wurde sie im neuen Bundesbankgesetz fixiert.
Im folgenden wird die Entwicklung der aus der ostdeutschen Währungsreform hervorgegangenen Staatsbank der DDR nicht berücksichtigt. Das hängt vor allem damit zusammen, daß in diesem Teil Deutschlands während der Zeit des kalten Krieges eine sich von der Marktwirtschaft unterscheidende Wirtschaftsform herrschte. Die Preise für alle Waren und Dienstleistungen wurden in der sogenannten Planwirtschaft vorgegeben und somit ist ein realer Vergleich mit der Funktionsweise der Bundesbank in Westdeutschland in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll.
4. Die Unabhängigkeit einer Notenbank
Um die Unabhängigkeit einer Notenbank objektiv zu untersuchen, ist es notwendig, verschiedene Kriterien der Zentralbankunabhängigkeit getrennt voneinander zu betrachten. Hierbei entwickelte man in der Vergangenheit verschiedene Ansätze, wobei unter anderem zwischen Goal independence und Instrument independence differenziert wurde. Als Goal independence wird die Möglichkeit der Zentralbank, ihre Ziele frei zu wählen, bezeichnet. Instrument independence ist gegeben, wenn die Notenbank die Kontrolle über alle geldpolitischen Instrumentarien hat und über deren Anwendung frei entscheiden kann. Diese Instrument independence ist für die Wahrung der Geldwertstabilität unbedingt notwendig. Der Begriff Goal independence als solcher ist eher kritisch zu betrachten, da eine Abkehr vom Ziel der Preisstabilität damit nicht ausgeschlossen wäre.7
Da die Preisstabilität im Rahmen dieser Arbeit eine wichtige Rolle spielt, soll von einer weiteren Alternative der Abgrenzung ausgegangen werden, wobei zwischen politischer und ökonomischer Unabhängigkeit differenziert wird. Die politische Unabhängigkeit der Notenbank beschreibt die unabhängig von politischen Vorgaben erfolgende Auswahl von Entscheidungen zur Wahrung der Geldwertstabilität während die ökonomische Unabhängigkeit der Zentralbank die Möglichkeit geben soll, die von ihr als richtig angesehene Geldpolitik auch tatsächlich betreiben zu können.8
4.1 Politische Unabhängigkeit einer Notenbank
Die Handlungsweise einer Zentralbank wird dann als politisch unabhängig betrachtet, wenn sie in der Lage ist, das Ziel der Preisstabilität unbeeinträchtigt von politischen Weisungen zu verfolgen.9
Im Rahmen der politischen Unabhängigkeit sollte eine Zentralbank in funktioneller, personeller und finanzieller Hinsicht von der Regierung unabhängig sein.
4.1.1 Funktionelle Unabhängigkeit
Der Begriff der funktionellen Unabhängigkeit beinhaltet das alleinige Recht der Notenbank zur Ausgabe von Noten und zur Ausgestaltung der für die Wahrung der Preisstabilität notwendigen Geldpolitik.
Es sollte im Rahmen des Notenbankgesetzes eine ausdrückliche Festlegung der Notenbank auf das Ziel der Preisstabilität und ihrer Unabhängigkeit in geldpolitischen Entscheidungen vorgenommen werden. Vom Primärziel der Geldwertstabilität sollte sie nicht durch eine Verpflichtung zu anderen gesellschaftlichen Bedürfnissen wie Wachstum und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit abgelenkt werden.10
Weiterhin wird die institutionelle Unabhängigkeit der Notenbank durch das Verbot direkter oder indirekter Kredite an die Regierung gestärkt.
Wird der Zentralbank auch die Wechselkurskompetenz eindeutig zugeordnet, hat die Notenbank die notwendige vollständige Kontrolle über alle geldpolitischen Instrumente. Somit wäre sie auch frei von außenwirtschaftlichen Einflüssen, da sie allein über Wechselkursvereinbarungen und -anpassungen und somit über Devisenmarktinterventionen entscheiden kann.
Es ist von fundamentaler Bedeutung, daß die sich die Notenbank in ihrer Vorgehensweise durch das Gesetz unterstützt sieht. Sie sollte innerhalb eines gewissen Handlungsspielraumes berechtigt sein, die ihr zur Verfügung stehenden Instrumentarien zur Steuerung des Geldmarktes frei zu wählen.11
4.1.2 Personelle Unabhängigkeit
Ist ein externer Einfluß auf die Ernennung oder Abberufung der Entscheidungsträger einer Notenbank genauso ausgeschlossen wie Weisungen oder bindende Vorgaben ihnen gegenüber, wird diese Notenbank als personell unabhängig bezeichnet.12
Es ist dafür Sorge zu tragen, daß die Arbeit der Zentralbank und die Auswahl ihrer Exekutivmitglieder frei von politischen Interessen sind. Es ist also nicht entscheidend, ob die entsprechenden Personen politischen Einfluß haben, sondern ob sie genügend Fachkompetenz besitzen, um ihrer Aufgabe als Entscheidungsträger der Notenbank gerecht zu werden.
Die Bestimmung der Exekutivmitglieder einer Notenbank durch die jeweilige Regierung führte zu einer kurzfristigen Betrachtungsweise bei der Ausrichtung der Geldpolitik, da Politiker ihre Entscheidungen im allgemeinen nicht unbeeinflußt von der begrenzten Legislaturperiode und dem Wunsch nach Wiederwahl treffen.
Im Rahmen der Notenbankverfassung sollte deshalb sowohl eine Zustimmungskompetenz der Regierung, als auch ein Stimmrecht eines Regierungsvertreters im Entscheidungsgremium der Notenbank ausgeschlossen sein.13
Eine Amtsenthebung der Mitglieder des Entscheidungsgremiums aufgrund der Verfehlung politischer Vorgaben durch die Regierung würde ebenfalls negativen Einfluß auf die politische Unabhängigkeit der Zentralbank haben. Weiterhin sollte es keiner Person aus diesem Kreis erlaubt sein, parallel zu ihrer oder seiner Tätigkeit für die Notenbank leitende Tätigkeiten in der Privatwirtschaft, dem öffentlichen Dienst oder gar in der Politik auszuüben.14 Um eine langfristig orientierte, stabile Geldpolitik durchführen zu können, sind die Exekutivmitglieder mit einer möglichst langen Amtszeit auszustatten.15
4.1.3 Finanzielle Unabhängigkeit
Wesentlich für die finanzielle Unabhängigkeit der Zentralbank ist die Verfügbarkeit über ein eigenes, großzügig bemessenes Budget zur Durchführung ihres Tagesgeschäftes. Das sollte im Wesentlichen die Verwendung des so genannten Zentralbankgewinnes für notwendige geldpolitischen Maßnahmen einschließen. Dieses Budget sollte nicht von der Regierung vorgegeben werden oder zur Verfügung eines ihrer Ministerien stehen, da das die Arbeit der Zentralbank erheblich einschränken und von der Kassenlage der Regierung abhängig machen würde.
Die Bezüge der Notenbanker sollten möglichst vorgegeben sein. Es wäre außerdem von Vorteil, wenn die Höhe der Gehälter einen eventuellen Wechsel in die Privatwirtschaft unattraktiv erscheinen lassen würde. Der Fluktuation innerhalb der Notenbank könnte auf diesem Wege entgegengewirkt werden. Diese Maßnahme würde somit auch einen notwendigen Beitrag zu einer langfristig stabilen Geldpolitik leisten.16
4.2 Ökonomische Unabhängigkeit einer Notenbank
Eine Notenbank ist dann ökonomisch unabhängig, wenn ihre Geldpolitik nicht durch Transaktionen gestört wird, die außerhalb der Kontrolle der Notenbankleitung liegen.17
Die Unabhängigkeit der Zentralbank wird im wesentlichen durch drei geldpolitische Instrumentarien determiniert, hinsichtlich derer klare Vorschriften existieren sollten.
Dabei handelt es sich um Notenbankkredite an öffentliche Haushalte, Interventionen am Devisenmarkt und um administrative Zinsfestlegungen durch die Regierung.
4.2.1 Kreditvergabe an öffentliche Haushalte
Eine wichtige Komponente in den gesetzlichen Regelungen zur Arbeit einer Notenbank sollte das Verbot der Kreditvergabe an öffentliche Haushalte sein. Ohne eine solche gesetzliche Vorschrift bestünde die Gefahr einer inflationären Staatsfinanzierung.18
4.2.2 Interventionen am Devisenmarkt
Um das langfristige Ziel der Geldwertstabilität nicht zu gefährden, bedarf es außerdem einer Einschränkung der Interventionen am Devisenmarkt durch die Zentralbank.
Speziell in Systemen fester Wechselkurse, wie zum Beispiel dem EWS, bestand die Gefahr geldpolitischer Spannungen durch von der Regierung festgelegte Paritätswerte. Die Notenbank wäre gegebenenfalls sogar gesetzlich zu Stützungskäufen zugunsten der jeweiligen Währung verpflichtet.19 Eine sinnvolle Maßnahme hinsichtlich dieses Problems wäre die Festlegung von Interventionspunkten in der Notenbankverfassung, um die Parität langfristig zu fixieren.
Im folgenden wird angenommen, daß eine stärkere Verwicklung der Zentralbank eines Landes in Aufgabengebiete außerhalb ihrer Kerntätigkeiten, also hin zu eher an politischen Interessen orientierten Zielen, ihre Unabhängigkeit zumindest schwächt.20
4.2.3 administrative Zinsfestlegung durch die Regierung
Ein hoher Grad an Unabhängigkeit wird ebenfalls erreicht, wenn eine Zentralbank bei der Wahl ihrer geldpolitischen Instrumente nicht durch von der Regierung fixierte operative Zinssätze eingeschränkt wird.
5. Vergleich der EZB und der RBNZ bezüglich der Unabhängigkeit und der daraus entstehenden Konsequenzen
Im Folgenden soll anhand von empirischen Befunden und Beispielen gezeigt werden, daß nur eine weitestgehend unabhängige Notenbank in der Lage ist, die Währungsstabilität langfristig zu sichern. Ein guter Kontrast zwischen den unterschiedlichen Graden der Unabhängigkeit der Zentralbank entsteht vor allem beim Vergleich der EZB und der RBNZ. Der Neuseeländischen Zentralbank liegt ein völlig anderes Konzept zugrunde als der nach dem Vorbild der Bundesbank entstandenen Europäischen Zentralbank.
Sowohl im Maastrichter Vertrag als auch im RBNZ Act, den Notenbankgesetzen der EZB in Europa beziehungsweise der RBNZ in Neuseeland, wird sich auf die Wahrung der Geldwertstabilität als Hauptziel der jeweiligen Notenbank festgelegt.
Jedoch ist die RBNZ im Gegensatz zur EZB nicht unabhängig von politischen Weisungen. Durch die „Override provision“ des Finanzministers ist die neuseeländische Regierung jederzeit berechtigt, das Ziel der Geldwertstabilität neu zu definieren oder zeitweise zu suspendieren.21
Die EZB erfüllt mit einer verhältnismaßig langen Amtszeit seiner Direktoriumsmitglieder von 8 Jahren ein weiteres Kriterium für die Unabhängigkeit, während der Gouverneur der RBNZ für höchstens 5 Jahre verpflichtet wird. Außerdem besteht im Konfliktfall sogar die Möglichkeit einer Entlassung des Notenbankgouverneurs. Der Rat der Europäischen Zentralbank dagegen ist vor willkürlicher, vorzeitiger Amtsenthebung geschützt.22 Aus den oben genannten Fakten läßt sich für die EZB ein hohes Maß an politischer Unabhängigkeit ableiten. Die politische Unabhängigkeit der RBNZ dagegen erfährt vor allem durch die „override provision“ starke Einschränkungen.23
Die ökonomische Unabhängigkeit einer Notenbank wird durch ein definitives Verbot jeder Form der direkten Finanzierung öffentlicher Defizite gestärkt. Der Artikel 104 EGV ist somit ein wichtiger Beitrag zur Glaubwürdigkeit der EZB.24 Außerdem ist die EZB allein verantwortlich für Interventionen am Devisenmarkt, wie zum Beispiel Leitzinserhöhungen und Stützungskäufe und wird darin per Gesetz gestützt.25
6. Empirischer Befund
Für die Hypothese, daß eine politische und ökonomische Abhängigkeit der Zentralbank einer Volkswirtschaft negative Auswirkungen auf die Inflationsrate hat, existieren eine Reihe empirischer Belege.
In der von Alesina und Summers entwickelten, hier aufgeführten Graphik wird dieser Zusammenhang auf der Basis von Werten der Jahre 1955 bis 1988
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
dargestellt.
Für die Darstellung der Zentralbankunabhängigkeit verwendeten sie einen Index.26
Es ist nicht möglich, sie zu messen oder rechnerisch zu ermitteln. Die Länder mit einem offensichtlich hohem Index der Zentralbankunabhängigkeit, wie zum Beispiel Deutschland oder die Schweiz haben, über diesen Zeitraum betrachtet, eine wesentlich geringere Inflationsrate als Länder wie zum Beispiel Spanien, Italien und Neuseeland. Diese wiederum werden von den Autoren mit einem niedrigen Unabhängigkeitsindex versehen, was den bereits erwähnten Zusammenhang darstellen soll.
7. Zusammenfassung
Abschließend ist festzustellen, daß keine signifikante Korrelation zwischen der Unabhängigkeit einer Zentralbank und der Inflationsrate nachweisbar ist. Jedoch ist, wie die oben aufgeführte Graphik zeigt, eine eindeutige, empirisch nachgewiesene Tendenz dieses Zusammenhanges erkennbar. Somit gilt die Notenbankunabhängigkeit als notwendige, jedoch nicht als hinreichende Bedingung für eine erfolgreiche Antiinflationspolitik.
Literaturverzeichnis
Bofinger, Peter; Reischle Julian; Schächter, Andrea: Geldpolitik-Ziele, Institutionen, Strategien und Instrumente, München 1996
Jarchow, Hans-Joachim: Theorie und Politik des Geldes, Band 2 - Geldpolitik, 7. Auflage, Göttingen, 1995
Waigel, Christian: Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank, 1. Auflage, Baden Baden, 1999
Homepage der Europäischen Zentralbank: www.ecb.int/aboutus, Frankfurt am Main, 2000
[...]
1 vgl. Jarchow 1992, S.37, Abs.2
2 vgl. Jarchow 1992, S.44, Abs.2
3 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S. 188, Abs.2
4 vgl. Jarchow 1992, S. 244
5 vgl. Waigel 1999, S.21
6 vgl. Waigel 1999, S.21, Abs.3
7 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.183ff.
8 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.197, Abs.2
9 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.184, Abs.1
10 vgl. Waigel 1999, S.46, Abs.3
11 vgl. Waigel 1999, S.46
12 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.192
13 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.192, Abs.1
14 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.195, Abs.3
15 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.192
16 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.195
17 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.197, Abs.2
18 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.198, Abs.2
19 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.199, Abs.1
20 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.199, Abs.3
21 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.189
22 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.192
23 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.190
24 vgl. Bofinger/Reischle/Schächter 1996, S.198
25 vgl. Homepage der Europäischen Zentralbank: www.ecb.int/aboutus
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument behandelt die Unabhängigkeit von Notenbanken, insbesondere der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Es analysiert die Aufgaben, Ziele und Geschichte von Notenbanken, die verschiedenen Aspekte ihrer Unabhängigkeit (politische und ökonomische), und die Konsequenzen dieser Unabhängigkeit auf die Inflationsrate.
Welche Aufgaben und Ziele hat eine Notenbank laut diesem Dokument?
Die Hauptaufgaben einer Notenbank sind die Emission von Banknoten, die Wahrung der Stabilität des Finanzsektors, die Förderung des reibungslosen Zahlungsverkehrs, die Verwaltung der Währungsreserven und die Beratung der politischen Organe. Das primäre Ziel ist die Gewährleistung der Preisstabilität, gefolgt von der Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik.
Was bedeutet die Unabhängigkeit einer Notenbank in diesem Kontext?
Die Unabhängigkeit einer Notenbank wird in politische und ökonomische Unabhängigkeit unterteilt. Politische Unabhängigkeit bedeutet, dass die Notenbank in ihren Entscheidungen zur Wahrung der Geldwertstabilität nicht von politischen Weisungen beeinflusst wird. Ökonomische Unabhängigkeit bedeutet, dass die Notenbank in der Lage ist, die von ihr als richtig angesehene Geldpolitik tatsächlich umzusetzen.
Welche Aspekte umfasst die politische Unabhängigkeit einer Notenbank?
Die politische Unabhängigkeit umfasst funktionelle, personelle und finanzielle Unabhängigkeit. Funktionelle Unabhängigkeit bezieht sich auf das Recht der Notenbank zur Ausgabe von Noten und zur Gestaltung der Geldpolitik. Personelle Unabhängigkeit bedeutet, dass die Ernennung und Abberufung der Entscheidungsträger frei von politischen Einflüssen ist. Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet, dass die Notenbank über ein eigenes, ausreichendes Budget verfügt.
Welche Aspekte umfasst die ökonomische Unabhängigkeit einer Notenbank?
Die ökonomische Unabhängigkeit wird durch das Verbot der Kreditvergabe an öffentliche Haushalte, die Einschränkung der Interventionen am Devisenmarkt und die freie administrative Zinsfestlegung durch die Regierung determiniert.
Wie werden die EZB und die RBNZ bezüglich ihrer Unabhängigkeit verglichen?
Die EZB wird als politisch unabhängiger eingestuft als die RBNZ. Während beide die Geldwertstabilität als Hauptziel haben, kann die neuseeländische Regierung durch die "Override provision" das Ziel der Geldwertstabilität neu definieren oder suspendieren. Die EZB genießt eine längere Amtszeit ihrer Direktoren und ist vor willkürlicher Amtsenthebung geschützt. Die EZB hat auch ein definitives Verbot der direkten Finanzierung öffentlicher Defizite.
Gibt es empirische Belege für den Zusammenhang zwischen Notenbankunabhängigkeit und Inflationsrate?
Es existieren empirische Belege, die darauf hindeuten, dass eine politische und ökonomische Abhängigkeit der Zentralbank negative Auswirkungen auf die Inflationsrate hat. Eine von Alesina und Summers entwickelte Graphik zeigt, dass Länder mit einem hohen Index der Zentralbankunabhängigkeit tendenziell geringere Inflationsraten aufweisen.
Was ist das Fazit des Dokuments bezüglich der Notenbankunabhängigkeit?
Das Dokument kommt zu dem Schluss, dass die Notenbankunabhängigkeit als notwendige, aber nicht als hinreichende Bedingung für eine erfolgreiche Antiinflationspolitik gilt. Es besteht eine erkennbare Tendenz, dass unabhängige Notenbanken bessere Ergebnisse bei der Inflationsbekämpfung erzielen.
- Quote paper
- Kay Jänicke (Author), 2000, Die Unabhängigkeit der Zentralbank, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104599