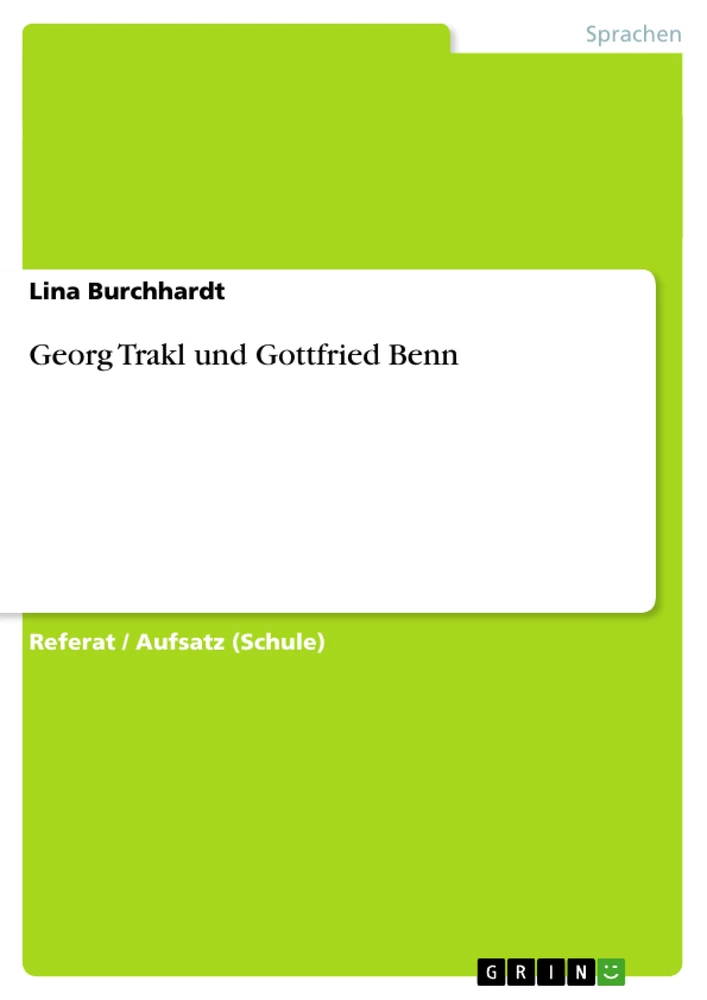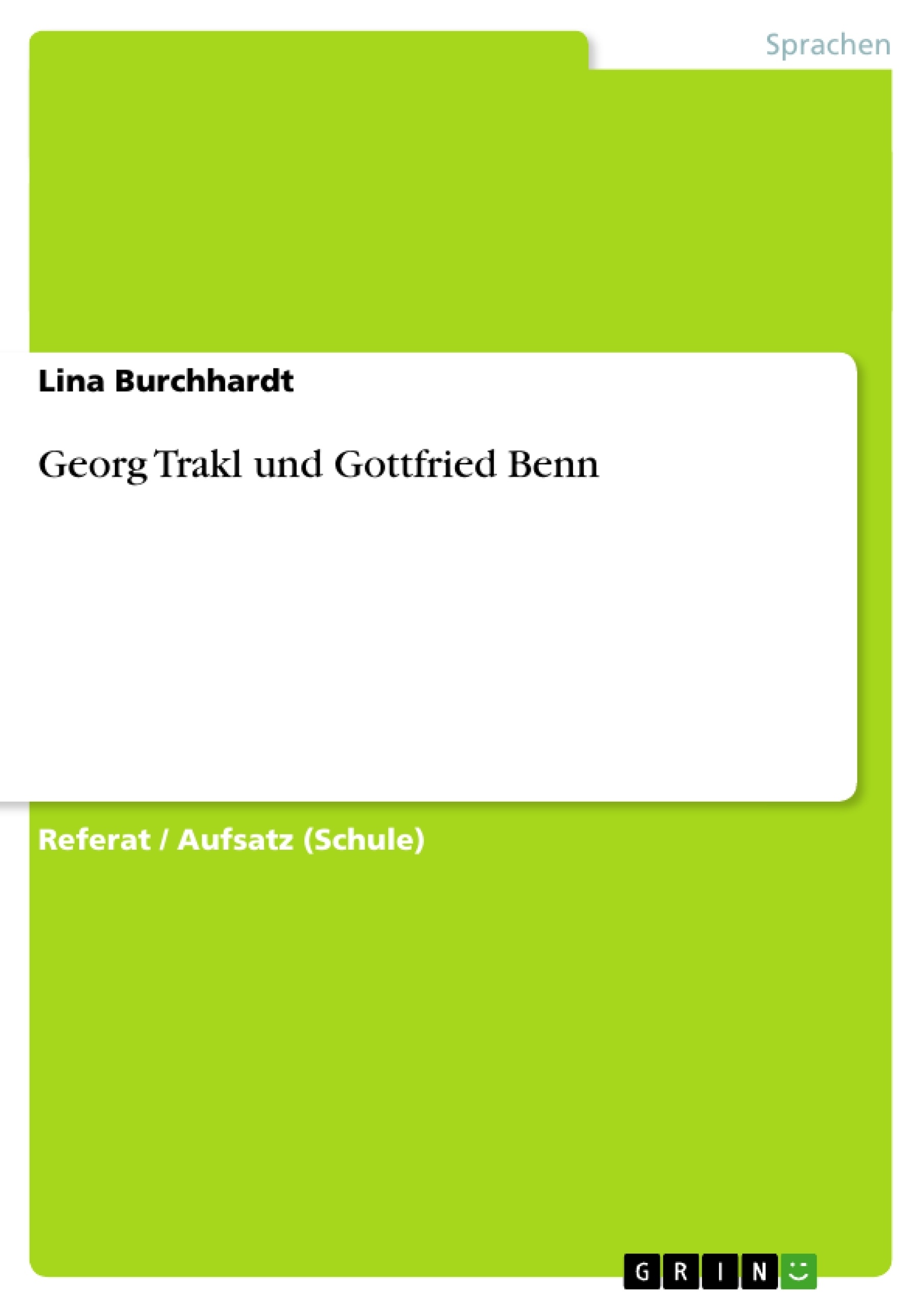1. Biographie: Georg Trakl
1.1 In Salzburg (1887-1908)
Georg Trakl wird am 3. Februar 1887 als fünftes Kind des Eisenhändlers Tobias Trakl und dessen zweiter Frau Maria Trakl, geb. Halik, in Salzburg geboren. Die Familie Trakl ist protestantisch, in einem überwiegend katholischen Österreich.
Als Georg Trakl drei Jahre alt ist, stellen seine Eltern eine katholische Gouvernante ein. Deren Hauptaufgabe ist es, sich um die Erziehung der Kinder zu kümmern und sie in der französischen Sprache zu unterrichten.
Die Mutter selbst, Maria Trakl, ist psychisch krank und wendet sich deshalb immer mehr von den Kindern ab. Sie widmet sich anderen Dingen wie Antiquitäten, später greift sie zu Opium.
Durch die unterschiedlichen Erziehungsmethoden und die internen Familienprobleme, gerät Georg Trakl in einen Glaubenskonflikt.
Ab 1897 besucht Trakl das königlich kaiserliche Staatsgymnasium.
Im Laufe seiner Schulzeit zieht er sich immer mehr zurück. Er fängt an Drogen zu nehmen, letztendlich konsumiert er Kokain.
Auch entdeckt er in dieser Zeit seine Vorliebe u.a. zu Nietzsche und Baudelaire. Durch sie beeinflusst, verfasst er erste Gedichte und Kurzgeschichten.
Nachdem er schon die vierte und die siebte Klasse wiederholen muss, verlässt er 1905 ohne Reifeprüfung die Schule.
Im gleichen Jahr beginnt Georg Trakl, auf das Drängen seines Vaters, eine Ausbildung zum Apotheker.
1.2 In Wien (1908-1911)
1908 zieht Georg nach Wien, um, nach abgeschlossener Ausbildung, Pharmazie zu studieren. Er macht seinen Magister 1910 und tritt anschließend als freiwilliger Sanitäter den Militärdienst an.
In diesem Jahr stirbt sein Vater.
Zugleich bewegt er sich in den Kreisen des Akademischen Verbands für Literatur und Musik; in deren Zeitschrift "Der Ruf" er später einige seiner Gedichte veröffentlicht.
Mit Beendigung seines Militärdienstes 1911, wird er Santitätsreservist und kehrt nach Hause zurück.
Folgend steckt er in finanziellen Schwierigkeiten, da einige Bewerbungen auf Festanstellung bei verschiedenen Ministerien fehlschlagen. Er konsumiert weiterhin Drogen.
1.3 In Innsbruck (1912-1914)
In Innsbruck beginnt Georg Trakl 1912 einen sechsmonatlichen Probedienst in der Apotheke eines Garnisonshospitals. Diesen bricht er nach einem Monat ab und wird in die Reserve zurückversetzt.
In dieser Zeit wohnt er bei dem Herausgeber der Zeitschrift „Der Brenner“, in welcher viele Gedichte von Trakl veröffentlicht werden.
Er wechselt häufig seine Anstellung, da er, durch seine seelische Verfassung und den dauerhaften Drogenkonsum, nicht in der Lage ist, kontinuierlich zu arbeiten. Von seinen Geschwistern erhält er finanzielle Unterstützung, welches seine depressive Stimmung verstärkt.
1.4 Während des Ersten Weltkrieges (1914)
Mit Beginn des ersten Weltkrieges (1914-1918) wird Georg Trakl als Reservist in Galizien stationiert.
Er wird erstmals bei der „Schlacht von Grodek“ eingesetzt. Aufgrund der dort erlebten Kriegsgrauen, z.B. Verwundetenversorgung ohne Medikamente und ärztliche Hilfe, Selbstmorde anderer Soldaten, versucht er sich das Leben zu nehmen. Daraufhin wird er zur Beobachtung seines geistigen Zustandes in das Garnisonsspital in Krakau eingewiesen.
Er schreibt dort zwei weitere Gedichte, „Klage“ und „Grodek“.
Am 3. November 1914 stirbt er 27jährig an einer Herzlähmung, ausgelöst durch eine Überdosis Kokain.
1.5 Werke
1913: „Gedichte“- Lyrikzyklus, darunter: „Verfall“, „Rondel“ und „Die Ratten“
1914/15: Veröffentlichungen im „Brenner“, Gedichte: z.B. „Grodek“, „Das Gewitter“; Prosa: „Offenbarung und Untergang“
1915: „Sebastian im Traum“- Lyrikzyklus mit zwei Prosastücken, Lyrik: u.a. „Sebastian im Traum“, „Kaspar Hauser Lied“; Prosa: „Traum und Umnachtung“ und „Verwandlung des Bösen“
Sonstige Veröffentlichungen zu Lebzeiten: Lyrik, z.B. „Traumwandler“; Prosa: u.a. „Verlassenheit“; Rezensionen: z.B. über „Gustav Streicher“
Nachlass: Aphorismen, lyrische Fragmente, Dramenfragmente etc.
2. Biographie: Gottfried Benn
2.1 Als Kind, Schüler und Student (1886-1914)
Gottfried Benn wird am 2. Mai 1886 als zweites Kind des evangelischen Pfarrers Gustav Benn und seiner Frau Caroline Jequier in Mansfeld geboren. Er wächst in Sellin/Neumark mit sechs Geschwistern auf.
Er erhält Unterricht in dem Pfarrhaus, seine Herkunft prägt Benns spätere Werke.
Von 1896 bis 1903 besucht Benn das Friedrichs Gymnasium in Frankfurt an der Oder, welches er mit dem Abitur verlässt.
Nach dem Ende der Schulzeit beginnt er auf Wunsch des Vaters 1903 mit dem Studium der Theologie und Philosophie, zunächst in Marburg, dann in Berlin. 1904 bricht er das Studium ab.
Ein Jahr später wechselt er zur Medizin und studiert bis 1910 an der militärärztlichen Kaiser- Wilhelm Akademie Berlin.
Von 1910 bis 1912 arbeitet er in der Charité und promoviert dort.
Seine Mutter stirbt; er verlässt aus gesundheitlichen Gründen das Heer und tritt eine Assistentenstelle in der Pathologie des Westend- Krankenhauses in Berlin an. Aus dieser Zeit stammen seine ersten Gedichte („Morgue“), die seinen Ruf als expressionistischen Lyriker begründen.
2.2 Während des Ersten Weltkrieges (1914-1917)
Als zweiter Schiffsarzt macht er 1914 eine Reise nach New York. Nach der Rückkehr absolviert er eine Ausbildung an der Universitäts- Hautklinik in München, welche durch eine kurze Vertretung in einem Lungensanatorium in Bischofsgrün unterbrochen wird.
Mit Kriegsbeginn heiratet Gottfried Benn die Schauspielerin Edith Osterlohe. Zu dieser Zeit ist er Truppenarzt, später Oberarzt in einer Prostituierten- Klinik in Belgien.
1915 wird seine Tochter Nele geboren.
Er wird aus der Armee entlassen und macht eine Ausbildung zum Facharzt für Hautund Geschlechtskrankheiten.
2.3 In Berlin (1918-1934)
Gottfried Benn lässt sich 1917 als Arzt der genannten Fachrichtung in Berlin nieder. In Folge der Inflation 1918, hat er Schwierigkeiten, die Praxis zu halten.
Seine Frau Edith stirbt nach einer Gallensteinoperation 1922.
Er lernt die Sängerin Ellen Overgaard kennen, welche seine Tochter mit nach Dänemark nimmt.
Als Dichter pflegt Benn Freundschaften mit den bedeutendsten Künstlern der Weimarer Jahre. Für Paul Hindemith verfaßt er den Text für das Oratorium „Das Unaufhörliche“, das 1931 uraufgeführt wird.
Benn veröffentlicht in der „Neuen Rundschau“, sein Bekanntheitsgrad wächst. 1932 wird er Mitglied der Preußischen Akademie der Künste.
Durch seine expressionistische Haltung stößt er zwischen 1933 und 34 auf immer mehr Widerspruch aus verschiedenen Richtungen, er ist unbeliebt und isoliert. Zudem steckt er in finanziellen Schwierigkeiten und muss in einer städtischen Beratungsstelle Vertretungen übernehmen.
2.4 Vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg (1935-1956)
1935 gibt er seine Praxis auf und geht, als Oberstabsarzt in Hannover, zum Militär zurück.
Zwei Jahre später wird er zurück nach Berlin versetzt und ist dort im Versorgungswesen tätig.
Hertha von Wedemeyer wird 1938 seine zweite Frau.
Im gleichen Jahr wird ihm vom nationalsozialistischen Regime das Schreibverbot erteilt.
Gottfried Benn verbringt die Jahre 1943 bis 1945 als Oberstarzt in Landsberg an der Warthe.
Dann kehrt er nach Berlin zurück; seine Frau begeht Selbstmord. 1946 geht er seine dritte Ehe mit Dr. Ilse Kaul ein.
Er nimmt seine Praxis wieder auf.
Das Schreibverbot gilt als aufgehoben, Benn erfährt aber zunächst Veröffentlichungsschwierigkeiten.
Ab 1949 geht es ihm finanziell immer besser.
Zwei Jahre später, 1951, wird ihm der Georg Büchner Preis verliehen. 1953 gibt er seine Praxis in Berlin auf.
Im Alter von siebzig Jahren stirbt Gottfried Benn 1956 in Berlin.
2.5 Werke
1912: „Morgue“, Lyrikzyklus: z.B. „Kleine Aster“, „Schöne Jugend“, „Kreislauf“; Gedichte: u.a. „Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke“, „Nachtcafé“
1913 bis 1919: „Söhne“, Lyrikzyklus: z.B. „Der junge Hebbel“, „Ein Trupp hergelaufener Söhne schrie“ und „Mutter“; Gedichte: u.a. „Hier ist kein Trost“, „Der Arzt“, „Reise“
1920 bis 1932: Gedichte: z.B. „Der späte Mensch“, „Chaos“ und „Orphische Zellen“; Essays: u.a. „Urgesicht“ und „Goethe und die Naturwissenschaft“
1932 bis 1949: Gedichte: z.B. „Wo keine Träne fällt“, „Auf deine Lieder senk‘ ich Schlummer“ und „Der Traum“; Essays: u.a. „Der neue Staat und die Intellektuellen“, „Kunst und Macht“
1949 bis 1956: „Aprèslude“, Lyrikzyklus; Gedichte: z.B. „Nur zwei Dinge“, „Nike“ und „Kann keine Trauer sein“, Hörspiel: „Die Stimme hinter dem Vorhang“
3. Literaturliste
Basil, Otto: „Georg Trakl. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumentation“, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 15. Auflage, 1992.
Hrsg. F. A. Brockhaus: „Der Jugend Brockhaus“, Wiesbaden, 1985.
Buchheim, Lothar- Günther: „Knaurs Lexikon Moderner Kunst“, München, Th. Knaur Nachf. Verlag, 1955.
Holthusen, Hans Egon: „Gottfried Benn. Leben Werk Widerspruch“, Stuttgart, KlettCotta, 1986.
Ridley, Hugh: „Gottfried Benn. Ein Schriftsteller zwischen Erneuerung und Reaktion“, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1990.
Rübe, Werner: „Provoziertes Leben. Gottfried Benn“, Stuttgart, Klett- Cotta, 1993.
Saas, Christa: „Georg Trakl“, Stuttgart, Metzler, 1974.
Schünemann, Peter: „Georg Trakl“, München, Beck, 1988.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Dieser Text präsentiert Biografien von Georg Trakl und Gottfried Benn, zwei bedeutenden deutschsprachigen Dichtern. Er beinhaltet Informationen über ihr Leben, ihre Werke und die historischen Kontexte, in denen sie wirkten.
Wer war Georg Trakl?
Georg Trakl war ein österreichischer Dichter des Expressionismus, geboren 1887 in Salzburg und gestorben 1914 in Krakau. Der Text beschreibt seine Kindheit, Ausbildung, seinen Drogenkonsum und seinen frühen Tod während des Ersten Weltkriegs. Auch einige seiner Werke werden genannt.
Was waren wichtige Stationen in Georg Trakls Leben?
Wichtige Stationen in Trakls Leben waren seine Zeit in Salzburg (1887-1908), Wien (1908-1911) und Innsbruck (1912-1914). Er nahm am Ersten Weltkrieg teil und starb in Krakau.
Was sind einige von Georg Trakls Werken?
Zu Trakls Werken gehören der Lyrikzyklus "Gedichte" (1913), Veröffentlichungen im "Brenner" (1914/15) und der Lyrikzyklus "Sebastian im Traum" (1915).
Wer war Gottfried Benn?
Gottfried Benn war ein deutscher Arzt, Dichter und Essayist, geboren 1886 in Mansfeld und gestorben 1956 in Berlin. Der Text beschreibt seine Kindheit, sein Studium, seine Arbeit als Arzt und seine Rolle während der beiden Weltkriege.
Was waren wichtige Stationen in Gottfried Benns Leben?
Wichtige Stationen in Benns Leben waren seine Kindheit und Jugend in der Neumark, sein Studium in Marburg und Berlin, seine Arbeit als Arzt in der Charité und seine Erfahrungen während der beiden Weltkriege.
Was sind einige von Gottfried Benns Werken?
Zu Benns Werken gehören der Lyrikzyklus "Morgue" (1912), der Lyrikzyklus "Söhne" (1913-1919) und der Lyrikzyklus "Aprèslude" (1949-1956). Er schrieb auch zahlreiche Gedichte und Essays.
Gibt es eine Literaturliste?
Ja, der Text enthält eine Literaturliste mit Werken über Georg Trakl und Gottfried Benn.
Welche Themen werden in den Biografien behandelt?
Die Biografien behandeln Themen wie Kindheit, Ausbildung, Kriegserfahrungen, psychische Gesundheit, künstlerische Entwicklung und gesellschaftliche Relevanz der beiden Dichter.
Was ist die Bedeutung des "Brenner" im Zusammenhang mit Georg Trakl?
"Der Brenner" war eine Zeitschrift, in der viele Gedichte von Trakl veröffentlicht wurden. Der Herausgeber der Zeitschrift gewährte Trakl auch Unterkunft.
In welchen Fachrichtungen war Gottfried Benn als Arzt tätig?
Gottfried Benn war als Arzt in der Pathologie, als Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und als Militärarzt tätig.
Welche Preise hat Gottfried Benn erhalten?
Gottfried Benn wurde 1951 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.
- Quote paper
- Lina Burchhardt (Author), 2001, Georg Trakl und Gottfried Benn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104579