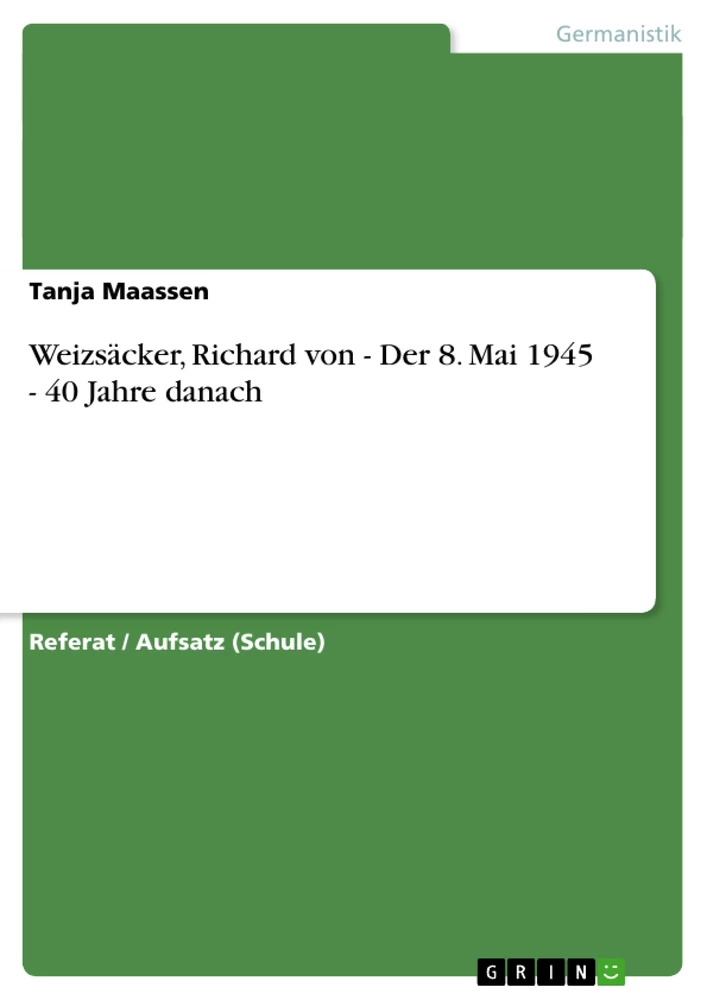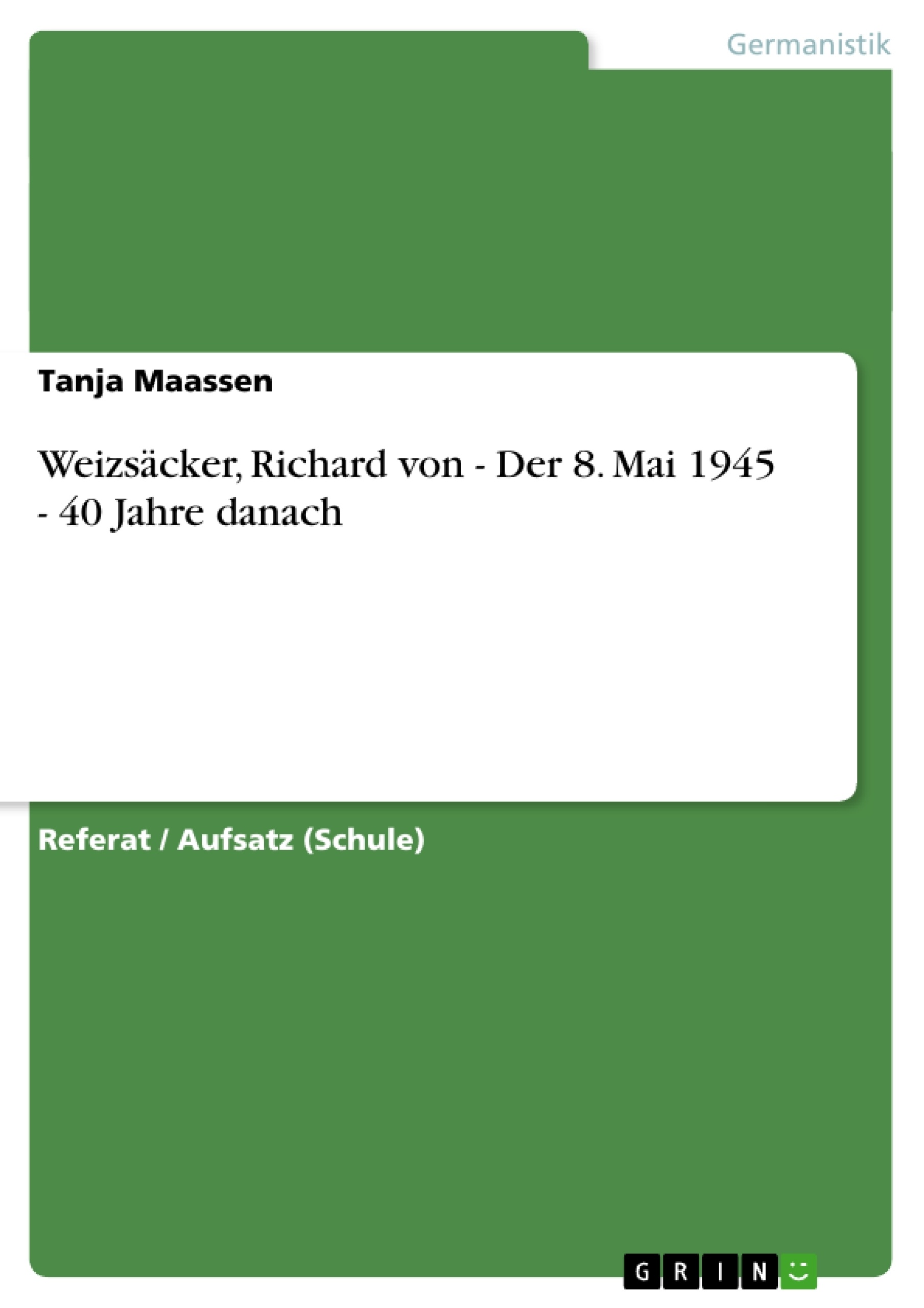Stellen Sie sich einen Moment vor, in dem die Welt den Atem anhielt, ein Moment der Zäsur, der das Echo einer grausamen Vergangenheit in sich trug und gleichzeitig den Keim für eine ungewisse Zukunft barg. Richard von Weizsäckers Rede zum 8. Mai 1945, gehalten vierzig Jahre später vor dem Deutschen Bundestag, ist weit mehr als eine historische Aufarbeitung; sie ist ein eindringlicher Appell an das kollektive Gedächtnis, eine schonungslose Auseinandersetzung mit Schuld und Verantwortung, und ein leidenschaftliches Plädoyer für Frieden und Versöhnung. Weit entfernt von einem Tag der ungeteilten Freude oder schlichten Niederlage, entfaltet sich der 8. Mai in Weizsäckers Analyse als ein vielschichtiges Datum, das individuelle Schicksale, nationale Identität und die europäische Geschichte auf beklemmende Weise miteinander verwebt. Die Rede seziert die komplexe Gemengelage aus persönlicher Betroffenheit, politischer Verantwortung und moralischer Verpflichtung, die den Umgang mit der deutschen Vergangenheit prägt. Es geht um das Erinnern der Opfer, der Millionen Toten des Krieges, der Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen und politisch Verfolgten, deren Leid Mahnung und Verpflichtung zugleich ist. Doch es geht auch um die Auseinandersetzung mit der Frage, wie aus der Asche der Vergangenheit eine Zukunft des Friedens und der Gerechtigkeit entstehen kann. Weizsäckers Worte sind ein Aufruf zur Wachsamkeit, eine Warnung vor der Wiederholung der Geschichte und eine Ermutigung, die Lehren aus den dunkelsten Kapiteln der deutschen Vergangenheit zu ziehen. Diese Rede ist ein zeitloses Dokument, das gerade in unserer heutigen Zeit, in der rechtsextreme Tendenzen wieder an Boden gewinnen, von erschreckender Aktualität ist. Sie fordert uns heraus, uns unserer Verantwortung bewusst zu werden und aktiv für eine Gesellschaft einzutreten, die auf Toleranz, Respekt und Mitmenschlichkeit basiert. Tauchen Sie ein in eine Rede, die bis heute nichts von ihrer Brisanz verloren hat und uns alle angeht. Erleben Sie die Kraft der Worte eines Staatsmannes, der sich der Vergangenheit stellt, um die Zukunft zu gestalten. Entdecken Sie die subtilen rhetorischen Kniffe und die überzeugende Argumentation, die diese Rede zu einem Meisterwerk der politischen Rhetorik machen. Lassen Sie sich von Weizsäckers Vision einer besseren Welt inspirieren und werden Sie Teil einer Bewegung, die sich gegen Hass und Gewalt stellt. Diese Rede ist ein Muss für alle, die sich für Geschichte, Politik und die Zukunft unserer Gesellschaft interessieren. Sie ist ein Weckruf, ein Mahnmal und eine Hoffnung zugleich.
Rhetorische Analyse
Richard von Weizsäcker:
Der 8. Mai 1945 - 40 Jahre danach
*Redesituation/Zielgruppen*
Richard von Weizsäcker hält diese Gedenkrede am 8. 05. 1985 anlässlich der vierzigjährigen Wiederkehr des Kriegsendes vor dem deutschen Bundestag in Bonn. Schon vorher gibt es viele öffentliche Diskussionen zu diesem Thema. Streitpunkt ist die Frage, ob dieser Tag ein Tag der Niederlage oder der Befreiung war. Auch wurde seit einiger Zeit unter Wissenschaftlern die sogenannte Historikerdebatte geführt wo es um die Frage geht, ob der Nationalsozialismus ein einmaliges und verwerfliches deutsches Phänomen ist oder ob er ein wertfrei zu betrachtendes „normales“ Phänomen im Rahmen eines die Dreißiger- und Vierzigerjahre beherrschenden „gesamteuropäischen Bürgerkriegs“ war. Die Rede wird über Rundfunk und Fernsehen übertragen und richtet sich an die deutsche Bevölkerung.
*Intention des Redners*
Aus dieser Rede sind mehrere Absichten zu erkennen. Zum einen mahnt er die Deutschen, den 8. Mai 1945 nicht zu vergessen. Es ist ein Tag von entscheidender historischer Bedeutung, ein Tag der Erinnerung an das, was Menschen erleiden mussten (Zeile 19). Der 8. Mai ist für die Deutschen kein Tag zum Feiern. Jeder soll darüber nachdenken und seine Gefühle mit Gedanken an die Vergangenheit nicht schonen. Man soll der Wahrheit ins Auge blicken ohne die damalige Situation zu beschönigen. Keiner soll die Vergangenheit verdrängen, jeder soll sich mit ihr auseinandersetzen. Richard von Weizsäcker will den Leuten klar machen, dass sich so etwas leicht wiederholen kann. Gerade in der heutigen Zeit gibt es immer mehr rechtsextremistische und nationalsozialistische Gruppen, die genau dies erreichen wollen. Er mahnt die Menschen davor, nicht zu leichtgläubig zu sein, damit so etwas nicht wieder passiert. Jeder einzelne soll sich der furchtbaren Erinnerung an den Nationalsozialismus bewusst sein, denn durch schreckliche Erinnerungen oder Überlieferungen werden wir vielem kritischer gegenübertreten. Die Rede ist auch ein Gedenken an Opfer von damals: „Wir gedenken Heute in Trauer aller Toten des Krieges und der Gewaltherrschaft ... insbesondere der 6 Millionen Juden ... aller Völker, die im Krieg gelitten haben ...“ (Zeile 88). Des weiteren appelliert Herr von Weizsäcker an das Volk, auf Gewalt zu verzichten. Das heißt, den Menschen eine dauerhafte, politisch unangefochtene Sicherheit für ihre Zukunft zu (Zeile 218).
Auch bittet er die deutsche Bevölkerung, in Frieden zu leben, sich nicht in Feindschaft und Hass hineintreiben zu lassen (Zeile 254).
*Argumentation des Redners*
Richard von Weizsäcker versucht die deutsche Bevölkerung von der Wichtigkeit dieses Tages überzeugen: „Der 8. Mai 1945 ist ein Datum von entscheidender historischer Bedeutung in Europa“ (Zeile 8). Keiner soll diesen Tag vergessen, man soll darüber nachdenken, über die Ereignisse, über den Gang unserer Geschichte (Zeile 22). Er erinnert immer wieder an die Schicksale der Menschen, die diesen Tag „bewusst erlebt haben“ (Zeile 28). Richard von Weizsäcker argumentiert logisch. Erst stellt er eine Behauptung auf („Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern“ Zeile 26), welche er danach mit einem Beispiel begründet („Viele waren einfach nur dafür dankbar, dass Bombennächte und Angst vorüber und sie mit dem Leben davongekommen waren“ Zeile 32). Zum Thema, ob dieser Tag ein Tag der Befreiung oder der Niederlage sei, argumentiert Richard von Weizsäcker differenziert, es ist eine Polarisierung zu erkennen. Seine Begründungen sind sachlich nachvollziehbar, er zählt verschiedene Beispiele auf. Da er 1945 noch nichts mit der Politik zu tun hatte, steht er der ganzen Sache neutral gegenüber. Zwar hat er seine eigene Meinung dazu, jedoch argumentiert er beidseitig. Auf der einen Seite die Menschen, für die der Krieg nun ein Ende hatte, die dankbar waren, „dass Bombennächte und Angst vorüber und sie mit dem Leben davon gekommen waren“ (Zeile 33). Auf der anderen Seite die, die Schmerz empfanden „über die vollständige Niederlage des Vaterlandes“ (Zeile 35). Viele der deutschen Soldaten mussten in Kriegsgefangenschaft und viele Menschen wurden aus ihrem Zuhause vertrieben. Er appelliert an das Gewissen der Leute, an Anständigkeit und Alltagsmoral, indem er die damaligen Zustände beschreibt und die Ängste der Menschen von damals schildert. Gleichzeitig warnt er die Bevölkerung, den Fehler, den die Menschen damals begingen, nicht zu wiederholen. Denn auch in der heutigen Zeit gibt es noch viele Gruppen und Organisationen, welche die Leichtgläubigkeit mancher Leute ausnutzen, genau wie die NSDAP damals.
*Untersuchung der rhetorischen Mittel und deren vermutliche Wirkung*
Die Absichten des Redners werden durch die Verwendung unterschiedlicher rhetorischer Mittel unterstützt. So versucht Richard von Weizsäcker durch Anaphern die Wichtigkeit dieses Tages zu unterstreichen. Durch die ständigen Wiederholungen prägt sich der Zuhörer die Begriffe und damit die große Bedeutung besser ein: „Wir gedenken heute in Trauer aller Toten des Krieges und der Gewaltherrschaft. Wir gedenken insbesondere der sechs Millionen Juden, die in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden. Wir gedenken aller Völker, die im Krieg gelitten haben ... Als Deutsche gedenken wir in Trauer der eigenen Landsleute ... Wir gedenken der ermordeten Sinti und Roma, der getöteten Homosexuellen, der umgebrachten Geisteskranken, der Menschen, die um ihrer religiösen oder politischen Überzeugung willen sterben mussten. Wir gedenken der erschossenen Geiseln. Wir denken an die Opfer des Wiederstandes“ (Zeile 88).
Durch negative Bezeichnungen wird der damalige Zustand abgewertet: „Der Blick ging zurück in einen dunklen Abgrund der Vergangenheit“ (Zeile 59) „dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“ (Zeile 65) „den unmenschlichen Zielen einer verbrecherischen Führung“ (Zeile 52) usw ...
Mit Hilfe von rhetorischen Fragen („Hatte ein Neuaufbau in diesen Ruinen überhaupt Sinn?“ Zeile 57), worauf keine Antwort erwartet wird, will Herr von Weizsäcker seine Rede mehr Ausdruck verleihen.
Hyperbeln („das ganze Volk zum Werkzeug dieses Hasses“ Zeile 119) dienen zur stärkeren Überzeugung der Zuhörer.
Außerdem verwendet Richard von Weizsäcker Hendiadyoinen („Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn ...“ Zeile 72), um die Aussage zu verstärken.
Des weiteren werden Allegorien verwendet („... der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren ..“ Zeile 157)
*Einschätzung der eigenen Rolle und der Adressaten durch den Redner*
Richard von Weizsäcker sieht sich selbst als einen der Leute, er will die Menschen aufklären. Er sieht den 8. Mai nicht als einen Tag zum Feiern. Das versucht er seinen Mitmenschen zu vermitteln. Herr von Weizsäcker sieht sich als einen der Deutschen, nicht als „Anführer“ oder jemand, der „über“ dem restlichen Volk steht. Er ist einer von ihnen und so spricht er auch. Dies wird deutlich da er immer von „wir“ oder „uns“ spricht („Je ehrlicher wir ihn begehen“ Zeile 22; „Der 8. Mai ist für uns vor allem“ Zeile 19; „Unser Schicksal lag in der Hand unserer Feinde“ Zeile 42; „Wir haben wahrlich keinen Grund“ Zeile 77; usw.)
Natürlich steht er als jetziger Bundespräsident der ganzen Angelegenheit neutral gegenüber, da er nichts mit der damaligen Regierung zu tun hat, und kann dadurch beide Seiten der Frage nach der Bedeutung des 8. Mai gleichermaßen erörtern, obwohl er dazu seine eigene Meinung hat. Sein Appell für Frieden zeigt seine politische Einstellung. Richard von Weizsäcker ist ein Gegner des Nationalsozialismus und er versucht die heutige Generation, in die er seine Hoffnung setzt, davon zu überzeugen. Sie sollen die Vergangenheit nicht vergessen, sondern aus ihr lernen und die Fehler, welche die Deutschen damals begangen haben, nicht wiederholen („Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus wird“ Zeile 229).
Die Adressaten sieht Herr von Weizsäcker als „gleichrangig“ an, er verwendet keine Apostrophe. Er macht keinen Unterschied zwischen dem „normalen“ Volk und sich selbst, dem Bundespräsidenten. Für ihn sind alle gleich und so redet er auch.
*Kritische Beurteilung*
Richard von Weizsäcker ist meiner Meinung nach ein guter Redner. Er verwendet sehr geschickt rhetorische Mittel wie zum Beispiel Anaphern, rhetorische Fragen oder Hyperbeln. Damit ist es ihm gelungen, die Menschen von seiner Rede zu begeistern und sie zum nachdenken zu bringen. Obwohl er diese Rede 1985 gehalten hat ist sie inhaltlich auch heute noch sehr aktuell. Denn gerade in der jetzigen Zeit gibt es immer mehr rechtsextremistische Gruppen in Deutschland. Wenn wir nicht aufpassen und diese Entwicklung stoppen kann es leicht wieder zu so einem Vorfall wie damals kommen. Deshalb kann man diese Rede auch als eine Art Warnung ansehen: „Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus wird“.
Seiten: 4
Wörter: 1340
Zeichen (ohne Leerzeichen): 7702
Zeichen (mit Leerzeichen): 9036
Absätze: 25
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Rede "Richard von Weizsäcker: Der 8. Mai 1945 - 40 Jahre danach"?
Die Rede thematisiert den 8. Mai 1945, den Tag des Kriegsendes, aus deutscher Perspektive. Richard von Weizsäcker erörtert, ob dieser Tag als Tag der Niederlage oder der Befreiung zu betrachten ist und mahnt zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, um Wiederholungen zu verhindern.
An wen richtet sich die Rede?
Die Rede richtet sich an den deutschen Bundestag und die deutsche Bevölkerung, die sie über Rundfunk und Fernsehen verfolgen konnte.
Welche Absichten verfolgt Richard von Weizsäcker mit seiner Rede?
Weizsäcker möchte die Deutschen an die historische Bedeutung des 8. Mai 1945 erinnern, zur Reflexion über die Vergangenheit anregen, vor Rechtsextremismus warnen und die Menschen zu Frieden und Versöhnung aufrufen. Er gedenkt auch der Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft.
Wie argumentiert Richard von Weizsäcker in seiner Rede?
Weizsäcker argumentiert logisch und differenziert. Er stellt Behauptungen auf und belegt sie mit Beispielen. Er betrachtet den 8. Mai sowohl als Tag der Befreiung als auch als Tag der Niederlage, indem er die unterschiedlichen Erfahrungen der Menschen zu dieser Zeit berücksichtigt. Er appelliert an das Gewissen der Zuhörer und warnt vor der Wiederholung der Fehler der Vergangenheit.
Welche rhetorischen Mittel verwendet Richard von Weizsäcker?
Weizsäcker verwendet verschiedene rhetorische Mittel wie Anaphern, negative Bezeichnungen, rhetorische Fragen, Hyperbeln, Hendiadyoinen und Allegorien, um seine Aussagen zu verstärken und die Zuhörer zu überzeugen.
Wie schätzt Richard von Weizsäcker seine eigene Rolle und die der Adressaten ein?
Weizsäcker sieht sich selbst als einen Teil des deutschen Volkes und spricht als einer von ihnen. Er betrachtet die Adressaten als gleichrangig und appelliert an sie, aus der Geschichte zu lernen und eine friedliche Zukunft zu gestalten.
Wie wird die Rede abschließend beurteilt?
Die Rede wird als gelungen und überzeugend beurteilt, da Weizsäcker geschickt rhetorische Mittel einsetzt, um die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Sie wird als auch heute noch aktuell angesehen, da sie vor den Gefahren des Rechtsextremismus warnt.
- Quote paper
- Tanja Maassen (Author), 2001, Weizsäcker, Richard von - Der 8. Mai 1945 - 40 Jahre danach, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104569