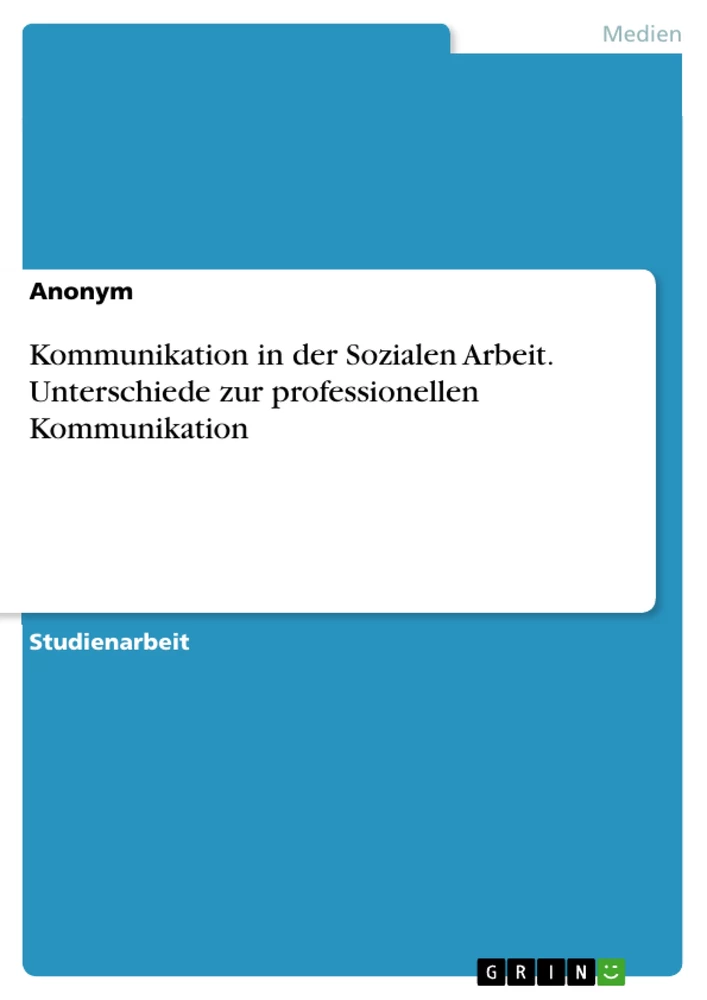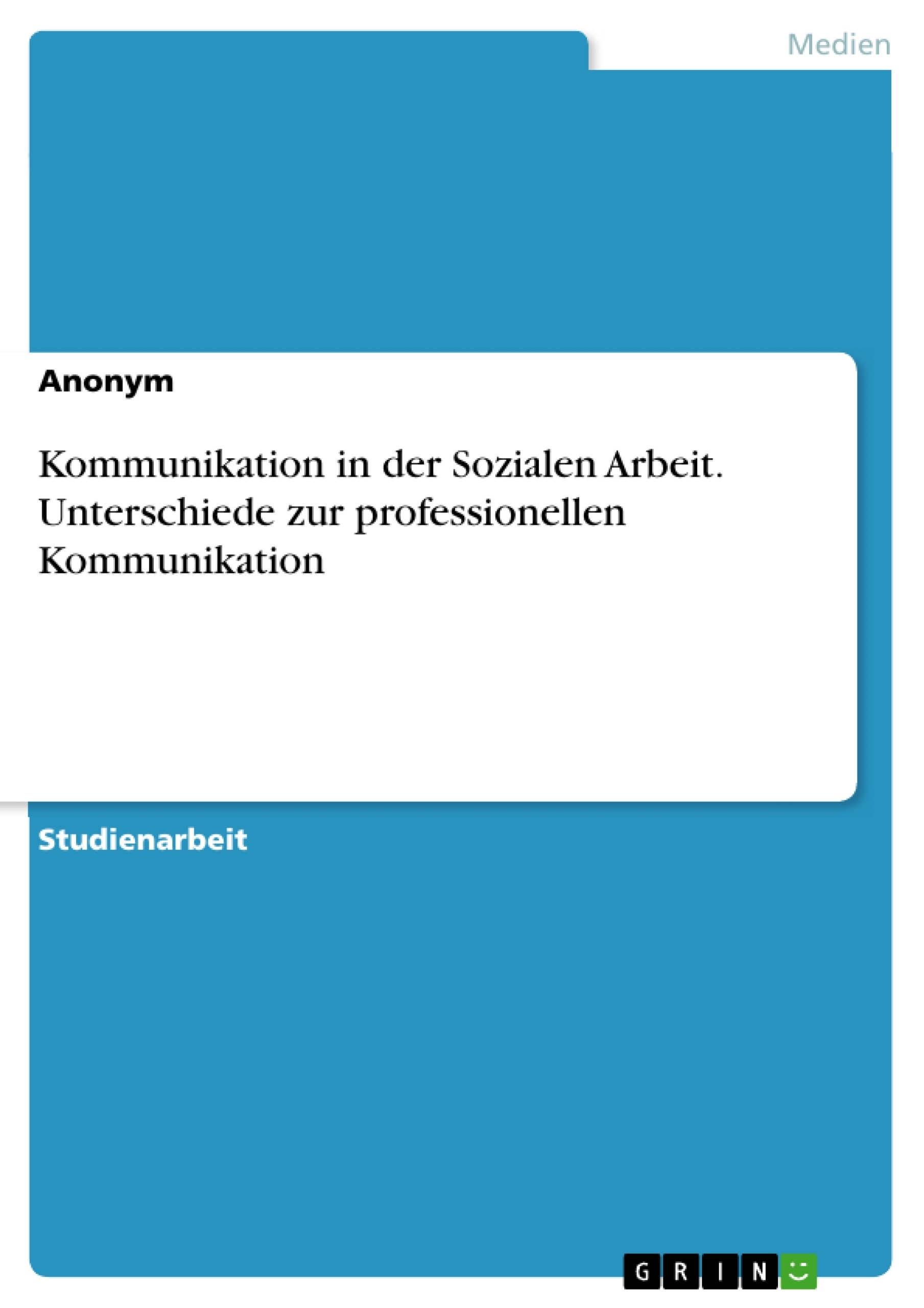Das Ziel der Hausarbeit ist es, deutlich zu machen, wo der Unterschied zwischen der Alltagskommunikation und der professionellen Kommunikation liegt. Des Weiteren zielt es auf die Frage ab, was die Kommunikation konkret für Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen bedeutet.
Die Hausarbeit beginnt im zweiten Kapitel mit der Kommunikation in der Sozialen Arbeit, in dem der Begriff Kommunikation definiert und aufzeigt wird und wieso diese Definition als Professionelle/r der Sozialen Arbeit wichtig erscheint. Darauf folgt ein kurzer Einblick in die Welt der "Alltagskommunikation" und wo hierbei z.B. Schwierigkeiten in Konfliktsituationen auftreten können. Der letzte Punkt dieses Kapitels verdeutlicht dann den Unterschied zu professioneller Kommunikation. Das dritte Kapitel befasst sich mit relevanten Ansätzen, Modellen und Handlungskonzepten professioneller Kommunikation, wo der Blick speziell auf die beiden Kommunikationsmodelle nach Watzlawick und Schultz von Thun gerichtet wird. Im vierten Kapitel - der Reflexion – werden aus den vorigen Erkenntnissen die Schlussfolgerungen für das Verständnis von sozialer Arbeit abgeleitet und auf die Frage, welche Bedeutung die Auseinandersetzung mit Kommunikation für die berufliche Arbeit als Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in hat, genauer eingegangen. Abschließend folgt im fünften und letzten Kapitel eine Abschlussdiskussion, bei der wesentliche Erkenntnisse aus den vorigen Kapiteln zusammengefasst und ein Fazit formuliert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Kommunikation in der Sozialen Arbeit
- Definition Kommunikation
- Definition Alltagskommunikation
- Alltagskommunikation und professionelle Kommunikation im Vergleich
- Ansätze, Modelle und Handlungskonzepte professioneller Kommunikation
- Prämissen für Kommunikation
- Kommunikationsmodelle
- Die Axiome der zwischenmenschlichen Kommunikation nach Watzlawick
- Das Kommunikationsquadrat zur Konfliktlösung nach Schulz von Thun
- Handlungskonzept Beratung
- Reflexion
- Abschlussdiskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit zielt darauf ab, den Unterschied zwischen Alltagskommunikation und professioneller Kommunikation in der Sozialen Arbeit aufzuzeigen. Sie untersucht, welche Bedeutung Kommunikationsmodelle und -konzepte für die praktische Arbeit in diesem Bereich haben. Weiterhin werden die Grenzen der Kommunikation und die Rolle der Beratung in der Sozialen Arbeit beleuchtet.
- Definition und Bedeutung von Kommunikation in der Sozialen Arbeit
- Unterschiede zwischen Alltagskommunikation und professioneller Kommunikation
- Relevanz von Kommunikationsmodellen in der Sozialen Arbeit
- Grenzen der Kommunikation und Umgang mit Missverständnissen
- Bedeutung des Handlungskonzepts Beratung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Arbeit stellt die Thematik der Kommunikation in der Sozialen Arbeit vor und beleuchtet die Bedeutung des Themas im Kontext der professionellen Tätigkeit.
- Kommunikation in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Kommunikation und erläutert die Bedeutung unterschiedlicher Kommunikationsformen, darunter die verbale, non-verbale und para-verbale Kommunikation.
- Ansätze, Modelle und Handlungskonzepte professioneller Kommunikation: Hier werden relevante Ansätze und Modelle für die Kommunikation in der Sozialen Arbeit vorgestellt, mit einem Fokus auf die Axiome der Kommunikation nach Watzlawick und das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun.
- Reflexion: Aus den vorangegangenen Ausführungen werden Schlussfolgerungen für das Verständnis von sozialer Arbeit gezogen und die Bedeutung der Auseinandersetzung mit Kommunikation für die berufliche Arbeit von Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe Kommunikation, Alltagskommunikation, professionelle Kommunikation, Kommunikationsmodelle, Handlungskonzepte, Beratung, Sozialarbeit, Missverständnisse und Kommunikationsstörungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Kommunikation in der Sozialen Arbeit. Unterschiede zur professionellen Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1045602