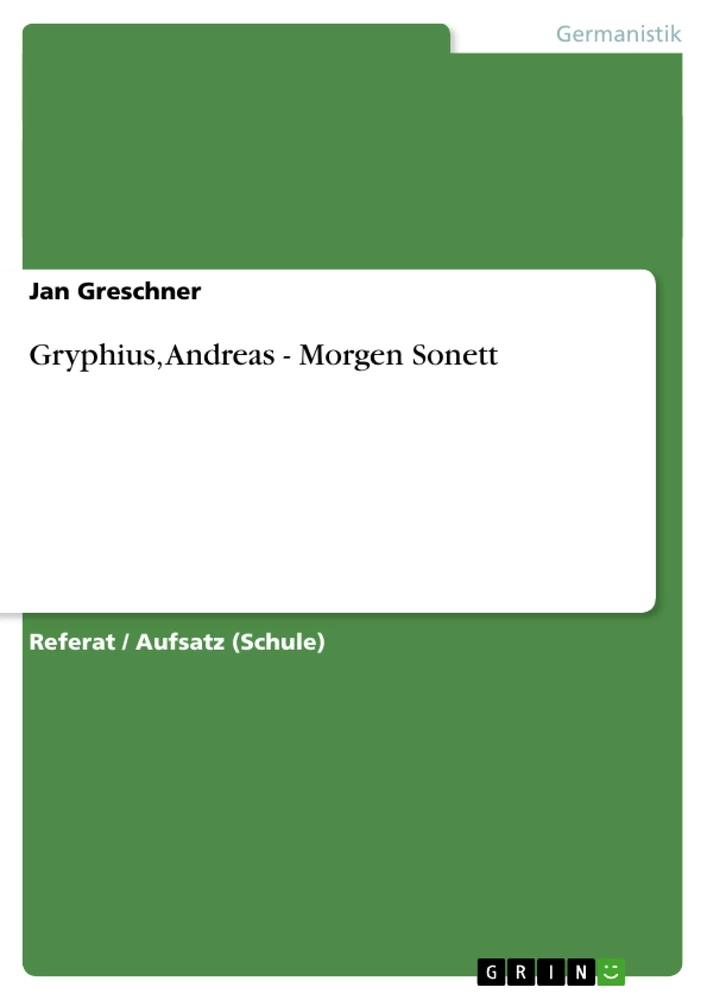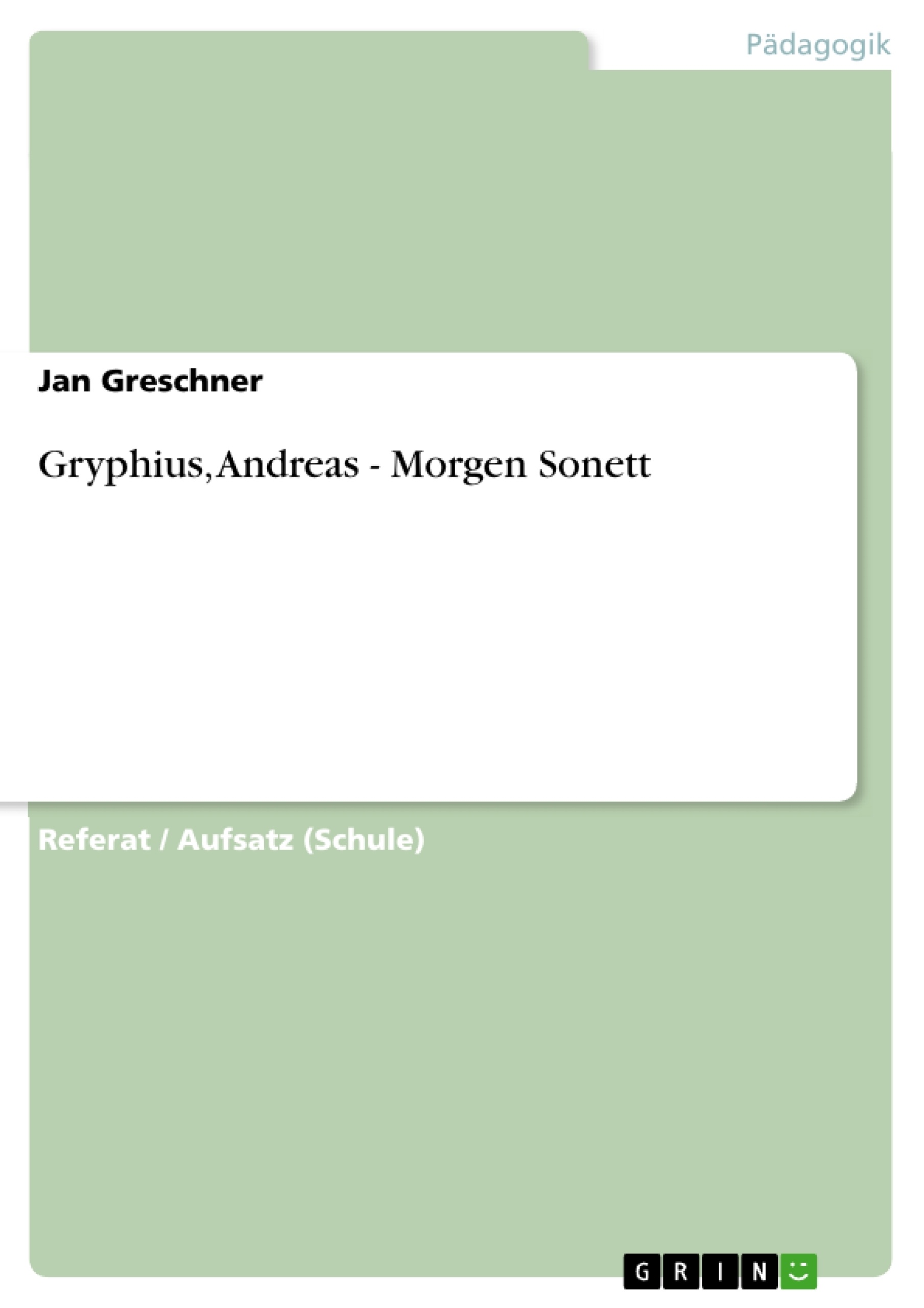Andreas Gryphius - „Morgen Sonnet“
Der Krieg! Kriege verändern unseren Planeten und das Zusammenleben schon seit Jahrmillionen.
Schon die Dinosaurier haben sich bekämpft um ihren Hunger zu stillen oder um einfach zu zeigen wer der Stärkste war. Dies war und ist bei den Tieren nicht viel anders auch wir Menschen haben uns diese Form der Auseinandersetzung genutzt um andere Völker oder Andersdenkende zu vernichten. Kriege bringen aber auch positives mit sich. So sind die politischen oder wirtschaftlichen Veränderungen nach einem Krieg meist sehr wertvoll für die Nachwelt. Doch die Leiden und Qualen, welche ein Krieg anrichten kann sind oft viel bedeutsamer als die positiven Aspekte. Ein Mensch der bereits in Zeiten des Krieges gelebt hat ist nur zu bedauern. So auch einer der bedeutendsten Literaten seiner Zeit Andreas Gryphius, der nur zwei Jahre vor Ausbruch eines der längsten Kriege in Europa geboren ist. Gryphius der selbst den furchtbaren Krieg bereits als kleiner Junge hautnah miterlebt hat, indem er bereits im Alter von 5 Jahren seinen Vater und im Alter von 11 seine Mutter verlor kann genau nachempfinden welche Leiden alle Menschen durchgemacht haben müssen. Diese Leidvollen Erfahrungen dieser Zeit hat Gryphius in vielen seiner Gedichten verarbeitet. So auch in dem hier zu interpretierendem Werk, welches im Jahre 1650 und damit unmittelbar nach Kriegsende geschrieben wurde befasst sich damit wie schön die Welt ist aber das die gesamte Menschheit vergänglich ist und nur Gott allein dazu in der Lage ist diesen Prozess zu umgehen. Das das Kriegsende nicht sehr lange zurückliegt spürt man beim Lesen vor allem im unteren Abschnitt ganz eindeutig die Bedrücktheit des lyrischen Subjektes sowie die Gespaltenheit, die ebenfalls ganz stark beim Lesen zum Ausdruck kommt. Diese Merkmale sind ganz typisch für diese Zeit des Leidens. Es ist aber auch eindeutig Hoffnung und Erleichterung herauszulesen, denn die Menschen der damaligen Zeit waren sicherlich froh, dass der Krieg nach 30 Jahren endlich beendet war. Es ist aber auch natürlich, dass das Leben immer noch von Leid geprägt war. Denn die Folgen des Krieges aber auch die Folgen der Pest waren für die Menschen auch nach dem Krieg noch deutlich zu spüren. Dies ist auch der Grund für diese Gespaltenheit des lyrischen Subjektes, welches im übrigen als lyrisches „Ich“ zu bezeichnen ist. In den ersten beiden Strophen wird es zwar nicht direkt benannt aber man spürt, dass diese weltliche Naturbeschreibung aus der Sicht eines einzelnen wiedergeben ist. Speziell benannt wird das lyrische „Ich“ dann im Schlussteil, denn es wird fast jedem Vers direkt benannt. Nicht nur das „Ich“ wechselt innerhalb des Gedichtes. Es ist auch ein klarer Wechsel des Themas zu spüren. Im ersten Teil wird von der Natur, der Umgebung und den damit verbunden Eindrücken gesprochen. Die ländliche Idylle, die hier beschrieben ist, ist ein ganz typisches Thema, welches die Dichter oft bearbeitet haben. Die Anpreisung Gottes steht im Mittelpunkt des letzten Teiles. Dieses Merkmal zeigt die Hoffnung die der Schöpfer den Menschen gegeben hat.
Der Aufbau dieses Werkes deckt sich in etwa mit dem was bereits gesagt wurde. Durch die klassische Form des Sonetts entsteht diese Aufteilung des Gedichtes in zwei Hälften. Das es sich um ein Sonett handelt wird bereits in der Überschrift zum Ausdruck gebracht. Im ersten Teil, der die ersten beiden Quartette des Sonetts umfasst, beschreibt das lyrische „Ich“ seine Eindrücke und gibt eine ziemlich detaillierte Beschreibung der Natur und seine Stimmung wieder, die er während eines Sonnenaufgangs erlebt. Die beiden Terzette erscheinen einem beim Lesen wie ein Gebet, denn man findet beim Lesen sehr oft den Bezug zu Gott und der Welt so zum Beispiel in der ersten Verszeile des ersten Terzettes,: „Vertreib die dicke Nacht / die meine Seel umbgibt / “. Dies zeigt, dass das „Ich“ Gott den Schöpfer bittet das Leid, welches das „Ich“ umgibt zu vertreiben. Der Inhalt des Gedichtes aber auch die äußere Form ist also durch das Sonett zweigeteilt. Einmal in Beschreibung und zum Anderen in Gebet. Die Reimformen, die verwendet wurden und ebenfalls kennzeichnend für das Sonett sind haben ebenfalls eine tiefere Bedeutung, vor allem der umschließende Reim in den beiden Quartetten. So stellen diese das „Umschließen“ der Sonne von Landschaft während eines Sonnenaufgangs dar, wie man auch inhaltlich sehr gut nachweisen kann,: Das Leben dieser Welt / eilt schon die Welt zu küssen / Erleuchte den / der sich itzt beugt vor deinen Füssen!“. Dies zeigt das die Sonnen am Morgen die Welt aus ihrem Schlaf wach küsst und die ganzen Menschen mit Licht versorgen soll. Aber auch innerhalb der Verse ist eine Teilung festzustellen. Dadurch wird dem Gedicht ein gewisser Rhythmus gegeben, der gegen Ende hin sehr erhebend und aufsteigend wirkt. Er wird auch durch die Zeilensprünge beispielsweise von Vers zwei zu drei der ersten Strophe bestimmt. Die Gliederung der einzelnen Verse kommt auch im Metrum zum Ausdruck, das hier verwendet wurde. Der sechshebige Jambus, ein sogenannter Alexandriner ist typisch für das klassische Sonett und verstärkt einmal die Absicht des Rhythmus und einmal die Gegensätzlichkeit, die im Barock häufig zu finden war. Ein Beispiel dafür wie antithetisch solch eine Verszeile aufgebaut ist, findet man bereits im ersten Vers. Hier wird aus „ewig helle Schar“ plötzlich „ihr Licht verschließen“. Dies steht vor allem für die Gespaltenheit und Vergänglichkeit des Menschen. Ebenfalls für die Vergänglichkeit sprechen die Personifikationen in der ersten Strophe,: „Morgenröte lacht“, „Wind erwacht“. Wie Leitmotive durchziehen sich die beiden Schlüsselwörter dieses Gedichtes „Licht“ und „Sonne“. Zu Beginn wurde es für die Beschreibung des Sonnenaufganges und für das Erwachen des Tages genutzt. Im gebetsteil als Zeichen der Hoffnung und der Hilfe Gottes. Die Sonne hier auch als Symbol für Gott genutzt soll verdeutlichen, dass alles was existiert, egal ob es dieser einzigartige Himmelskörper ist, einzig und allein auf Gott zurückzuführen ist. Ein weiteres Schlüsselwort ist das Wort „ewig“. Anfänglich wird damit noch etwas irdisches beschrieben. Doch die Vergänglichkeit des Menschen erlaubt nur das Gott die Ewigkeit verkörpert.
Nach ausgiebiger Betrachtung des hier vorliegenden Textes kann man sagen, dass die Sinnvermutung, die ich zu Beginn der Interpretation aufgestellt habe, fast mit der Autorenintention, die ich nach detaillierter Bearbeitung herausbekommen habe, übereinstimmt. Es können zwar kleine Veränderungen durchgeführt werden, diese wären aber nicht von großer Bedeutung.