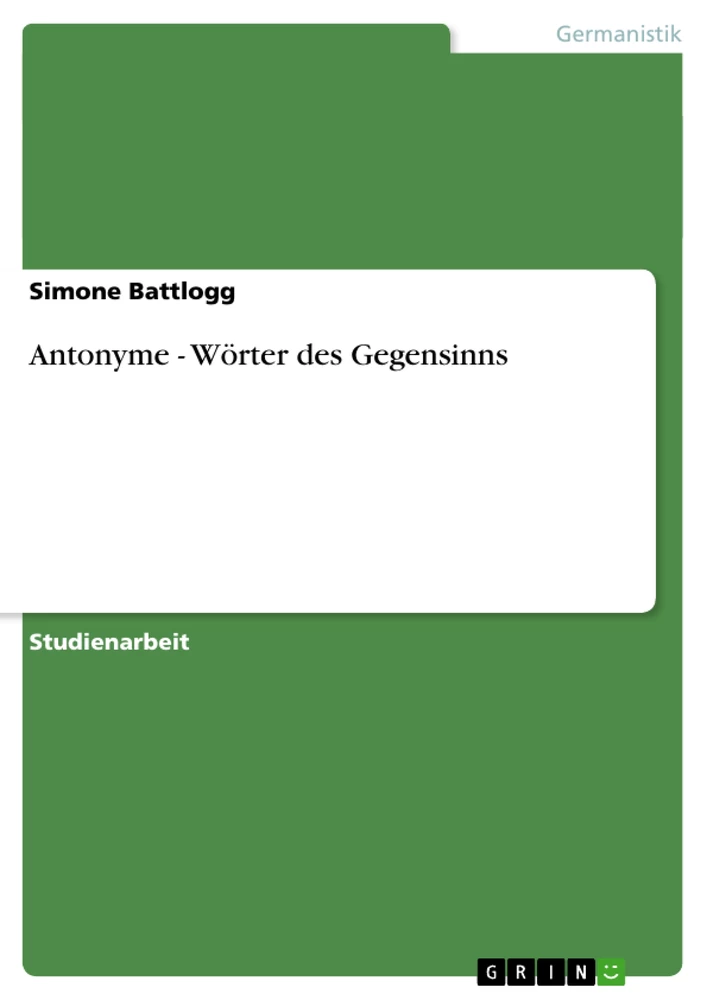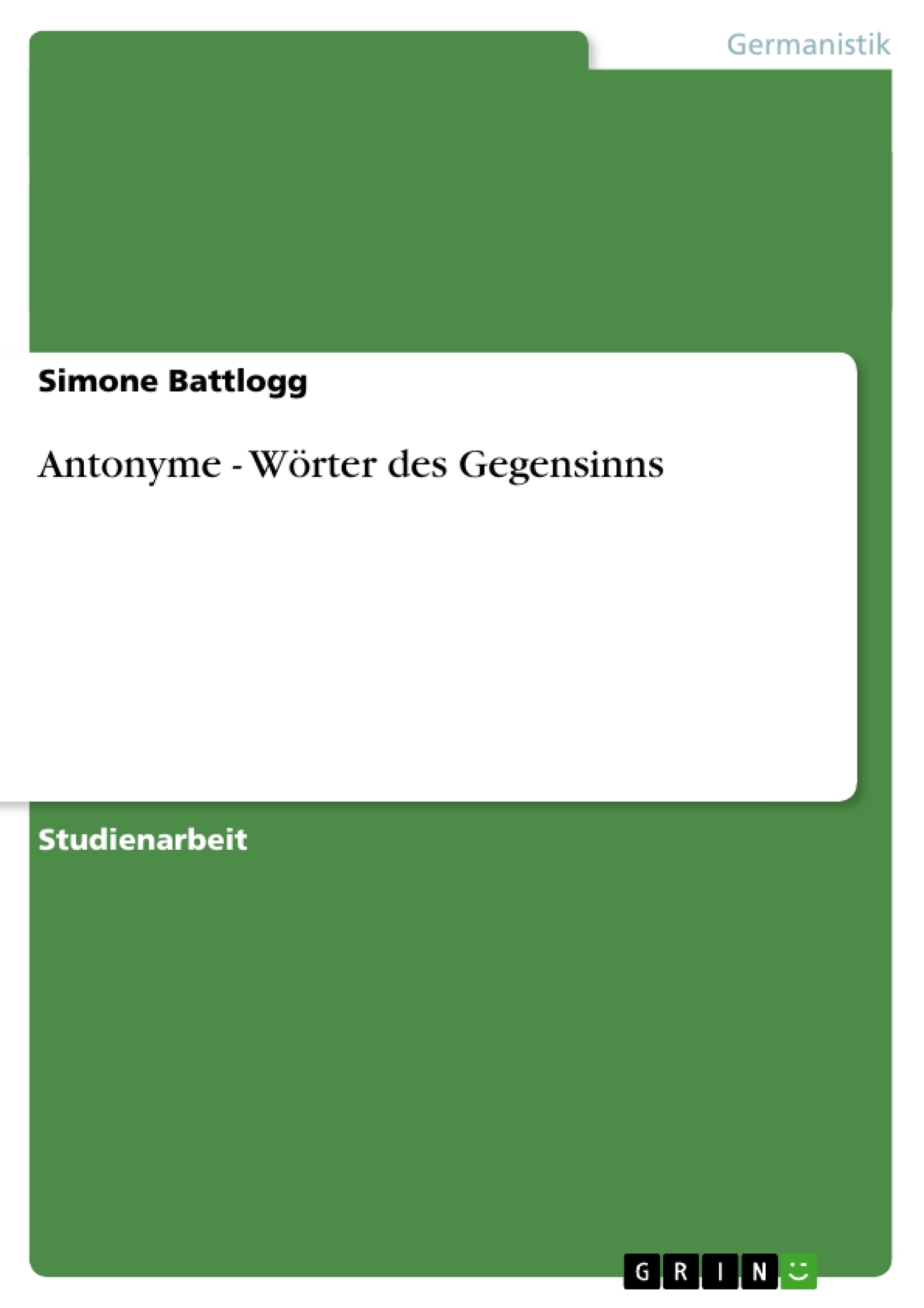Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Wörter nicht nur beschreiben, sondern auch ihr exaktes Gegenteil offenbaren – eine Welt der Antonyme. Diese Arbeit entführt Sie in das faszinierende Reich der gegensätzlichen Wörter, beginnend mit Aristoteles' frühen Überlegungen bis hin zu modernen linguistischen Deutungen. Entdecken Sie die historische Entwicklung der Antonymie, die oft auf Polarisierungsprozessen in unserer Alltagssprache beruht, wo Gegensätze konstruiert werden, selbst wenn keine offensichtlich sind. Die Analyse erstreckt sich von der grundlegenden Definition des Begriffs – Gegenwörter, Gegensatzwörter, Wörter mit Gegenbedeutung – bis hin zu den vielfältigen Typen, insbesondere im Bereich der Adjektive, die reichhaltige Beispiele für Antonyme liefern. Untersucht werden graduierbare Adjektive und die Herausforderungen ihrer Klassifizierung, da subjektive Wahrnehmungen und kontextuelle Abhängigkeiten eine objektive Bewertung erschweren. Die Arbeit beleuchtet auch Wörter, die scheinbar Antonyme sind, aber bei genauerer Betrachtung diese Eigenschaft verlieren, und berücksichtigt dabei unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen zur Rolle von Präfixen und Negationspartikeln. Ein besonderer Fokus liegt auf der Typologie nach Warczyk, die verschiedene Formen der Antonymie aufzeigt, von Verben mit Präfixen bis hin zu unregelmäßigen und regelmäßigen Antonymen. Die Arbeit berührt auch die Grenzen der Antonymie, indem sie aufzeigt, wo sie im Wortschatz nicht existiert, nämlich bei Gegenstandsbezeichnungen, Kollektiva oder Stoffbezeichnungen, und betont ihre Bindung an qualitative Merkmale. Abschließend wird die Problematik einer allgemeingültigen Definition von Antonymen erörtert, da sich selbst Sprachwissenschaftler in ihren Ansichten unterscheiden. Diese tiefgreifende Analyse bietet einen umfassenden Überblick über die Antonymie, ihre Komplexität und ihre Bedeutung für das Verständnis von Sprache und Bedeutung, und lädt dazu ein, die Nuancen und Feinheiten gegensätzlicher Wörter zu erkunden. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der heiß nicht ohne kalt, groß nicht ohne klein und Leben nicht ohne Tod denkbar ist, und entdecken Sie die subtilen Regeln und Muster, die diese faszinierende sprachliche Opposition bestimmen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Entstehung der Antonymie
3 Definition:
4 Die Typen der Antonymie nach Warczyk
5 Graduierbare Adjektive
6 Wörter die keine Antonyme sind
7 Konklusion
8 Bibliographie
1 Einleitung
Der Titel dieser Arbeit - „Antonyme - Wörter des Gegensinns“ läßt die Schwierigkeit einer genauen und hundert prozentigen Definition von Antonymen nicht erahnen, und wird einem bei erst bei einer intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema bewußt. In meiner Arbeit stütze mich vor allem auf die Einteilung von Richard Warczyk, die ich mit anderen mir wichtig und interessant erscheinenden Punkten ergänzt habe. Die Lehrmeinungen zu diesem Thema sind jedoch nicht immer übereinstimmend und aus diesem Grund stütze ich mich nicht nur auf eine wissenschaftliche Meinung. Nach einer Definition und der Erklärung der historischen Entstehung, werde ich die Antonymie vor allem anhand der Adjektive darstellen, da diese Wortart die häufigsten Beispiele für Antonyme bietet.
Ziel dieser Arbeit ist es einen Überblick über die Antonymie und einigen unterschiedlichen Meinungen von Sprachwissenschaftler zu geben. Die Grobeinteilung der Typen von Antonymen habe ich von Warczyk übernommen. Der letzte Punkt ist eine Definition von Antonymen verschiedener Sprachwissenschaftler, was noch einmal die Problematik der eindeutigen Bezeichnung von Antonymen darstellt.
2 Die Entstehung der Antonymie
Die anfänglichen Studien zu diesem Thema entstanden schon vor zwei Millionen Jahren, mit dem Wissenschaftler Aristoteles. Natürlich hat sich während dieser Zeit viel verändert, dennoch, nach Warczyk, stützt man sich auch heute noch auf eine gewisse Art und Weise auf seine Theorien. Eine der schwierigen Veränderungen die sich im Laufe der Zeit ergeben haben, stellt bestimmt auch die unterschiedliche Terminologie der Wissenschaftler dar.(vgl. Warczyk, 1981:29) Dennoch haben sich in bestimmten Teilbereichen solche herauskristallisiert, die öfters angewandt werden und die auch in diese Arbeit einfließen.
Viele der Antonyme sind historisch gesehen das Ergebnis eines Polarisierungsprozesses. In der Umgangssprache bedeutet das ein Denken in Gegensätzen, obwohl keine vorhanden sind:
Bsp.: Die Zukunft ist nicht rosig.
nicht immer
Das erste Beispiel bedeutet nicht automatisch, daß „die Zukunft düster ist“, genauso wenig wie das zweite Beispiel nicht „niemals“ bedeutet. Im menschlichen Gespräch ist aber eine automatische Tendenz zur Polarisierung gegeben und somit tritt das Konträre oftmals an die Stelle des Neutralen. (vgl. Lyons, 1971:480)
3 Definition:
Antonymie kommt aus dem griechischen und bedeutet [antí >gegen<, ónyma (=ónoma) >Name<] (Bußmann, 1989:87). Antonyme sind also Gegenwörter, Gegensatzwörter, gegensinnige Wörter, Wörter mit Gegenbedeutung und existieren nur von Semem zu Semem.
Bsp.: rico - pobre
hermoso - feo
vida - muerte
Es ist nicht unschwer zu erkennen, daß Antonymie nur auf einen relativ geringen Teil des Wortschatzes zutreffen kann. Während alle Klassen vollbedeutender Wortarten Synonyme ihrer Glieder hervorbringen können, kann überall dort wo eine gewisse Polarität nicht möglich ist, kein Antonym entstehen. So treten zum Beispiel bei Gegenstandsbezeichnungen (Möbelbezeichnungen, Gebäudebezeichnungen, Gerätenamen), Kollektiva (Herde, Gebirge, Gestirn) oder Stoffbezeichnungen keine Antonyme auf (Lewandowski, 1990:148ff). Daraus ergibt sich, daß Antonyme an das Vorhandensein qualitativer Merkmale gebunden sind, die sich wiederum graduieren und/oder zum Gegensatz führen lassen. Dies trifft dann vor allem auf Adjektive und mit ihnen in Relation stehenden Substantive und Verben zu.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eine interessante Feststellung ist, daß es weder im Spanischen noch im Deutschen ein Verb für das Totsein gibt. Die Opposition tritt wohl im substantivischen Bereich auf, nicht aber im verbalen Bereich.
Sätze mit Antonymen wie groß - klein, viel - wenig, hoch - niedrig zeigen, daß sie meist nicht als Repräsentanten absolut gegensätzlicher Werte gebraucht werden und die jeweiligen Positionen nicht absolut anzusetzen sind, sondern kontextabhängig:
Bsp.: Eine große Maus ist kleiner als ein kleiner Elefant. (Bußmann, 1989 :87). oder: Nuestra casa es grande.
„Grande“ muß in diesem Beispiel semantisch gesehen als Komparativ aufgefaßt werden, da der Satz im Sinne von „Unser Haus ist größer als das durchschnittliche Haus“ aufgefaßt werden muß (vgl. Lyons, 1971:476). Die Repräsentanten sind also zu relativen Begriffen geworden, die auf impliziten verbindlichen Normen basieren.
Eine der Hauptunterscheidungen der gegensätzlichen Wörter sind:
Der kontradiktorische Gegensatz:
Bsp.: Armut - Reichtum, Liebe - Haß, jeder - keiner
Der konträre Gegensatz:
Bsp.: kommen - gehen, nehmen - geben, fragen - antworten
Der komplementäre Gegensatz:
Bsp.: männlich - weiblich, verheiratet - ledig
John Lyons unterteilt dabei noch weiter in :
Antonyme: wobei die Negation eines Ausdrucks nicht die Behauptung des anderen impliziert.
Bsp.: nicht groß bedeutet nicht klein
Komplementarität: wobei die Negation einer lexikalischen Einheit die Bedeutung der anderen impliziert.
Bsp.: männlich - weiblich, ledig - verheiratet
Konversion: ein Terminus impliziert den anderen.
Bsp.: kaufen - verkaufen, geben - nehmen (Lewandowski, 1990:72)
Wie man sieht, kann ein Antonym also nicht einfach nur als Gegensinniges Wort erklärt werden, da es auch wichtig ist zu unterscheiden, in welcher Weise die lexikalischen Termini zueinander in Opposition stehen.
4 Die Typen der Antonymie nach Warczyk
1) Typ: commencer - cesser:
Diese Art von Antonymen entstehen vor allem bei Verben die mit Hilfe eines Präfix wie zum Beispiel de(s)-, re- gebildet werden:
a) Bsp.: placer-deplacer; inflar - desinflar; jeter - rejeter durch eine Deplazierung befindet sich das Objekt nicht mehr am selben Platz.
2) Typ: Aktion der Eliminierung des Resultats von einer Aktion:
Bsp.: coller-décoller, coudre-découdre, construir-destruir, obligar - desobligar Das Präfix dé- gibt also entweder eine konträre Aktion an oder eine Eliminierung des Resultats einer unvollendeten Aktion, décoller ist die Auflösung des Resultats von coller aber nicht umgekehrt.
3) Typ: umfaßt eine große Gruppe von Wörter, die aber nicht immer als echte Antonyme angesehen werden. Es werden unregelmäßige und regelmäßige Gruppen unterschieden:
Unregelmäßige Antonyme:
Bsp.: présence-absence, identité-différence, vivant-mort, abierto - cerrado
Regelmäßige Antonyme:
- das Präfix hängt sich an ein Wort:
Bsp.: rationnel-irrationnel, logique-illogique, exacto - inexacto
- das Präfix hängt sich an 2 Wörter:
Bsp.: monogamie-polygamie, procommuniste-anticommuniste, exterior - interior
Die Sprachwissenschaftler sind sich nicht alle einig, ob die Gegenüberstellung mit Hilfe von Wortbildungsmitteln (Präfixen) als systemhafte antonymische Erscheinung gelten kann. Nach John Lyons werden zum Beispiel Wörter deren gegensätzliche Bedeutung mit Hilfe eines Negationspartikels gebildet werden nicht als reine Antonyme angesehen(vgl. Lewandowski, 1990:136 und Punkt 6).
Aber es gibt eine grundlegende Unterscheidung zwischen der Inversion und der einfachen Negation von graduierbaren Adjektiven, welche sich auf einer Achse mit Hilfe von Polen darstellen lassen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese Antonyme können als entgegengesetzte Pole auf einer angenommenen „Achse“ angesehen werden. Die differenzierenden Elemente beziehen sich meist auf die Qualität einer Ausdehnung (hoch - tief), eines Schalles (laut - leise), einer Beschaffenheit, einer zeitlichen Einordnung, einer Wertung (gut - böse). Die beiden Antonyme könnten als entgegengesetzte Pole auf einer angenommenen Achse für eine entsprechende Raum-, Zeit, Beschaffenheits-, Wertungs- oder Lageangabe angesehen werden. Das differenzierende Bedeutungselement kann auch als ein Plus - oder Minuselement bezeichnet werden. (Lewandowski, 1990:148)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
wo die Adjektive nicht verglichen werden können weil sie eine graduierte Antonymie bilden. Das Adjektiv non-grand ist auch kein Antonym zu grand, da es nur eine Graduierung darstellt.
4) Typ: plus - moins:
Der Großteil dieser Gruppen wird durch metrische Adjektive konstruiert:
Bsp.: grand - petit, haut - bas, long - étroit, fréquent - rare Adverbien: beaucoup - peu
Der Unterschied zwischen den Termini besteht in der Opposition: plus grand - plus petit: grand bedeutet hier größer als die Norm petit bedeutet kleiner als die Norm
Antonyme die ein Element des Typs haben von : bas, court, haben immer eine Grenze: Wasser in einem See kann sinken, es kann bis zum verschwinden gehen aber die umgekehrte Situation ist unbegrenzt.
Einige Homonyme Typen können 2 oder mehr Antonyme besitzen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Da Adjektive Merkmale im weitesten Sinne des Wortes bezeichnen, sind in ihren Bedeutungsstrukturen auch „Plätze frei“ für Bedeutungselemente des höheren oder niederen Grades dieses Merkmales oder einer positiven/negativen Wertung. Diese Anordnung der Bedeutungselemente manifestiert sich in der Existenz adjektivischer Antonympaare. Zum Beispiel:
Adjektive der Dimension:
geringer Grad der Ausdehnung: kurz, niedrig, klein
großer Grad der Ausdehnung: lang, hoch, groß
Adjektive der Verstandesqualität:
positive Wertung: klug
negative Wertung: dumm
5) Andere Typen der Antonymie: Diese beziehen sich auf:
a) auf die Räumlichkeit: est - ouest, izquierda - derecha, hoch - tief,
b) die Farben: wo sich vor allem bei negro durch die Polarisation automatisch blanco als Opposition eingestellt hat. Auch wenn sich im Kontext Farbgegensätze fixiert haben (wie zum Beispiel bei Wein: tinto - blanco; Früchten: verde - amarillo), darf man nicht vergessen, daß Farben grundsätzlich mehrere Gegensätze haben können (Bsp.: blau: mit rot, gelb, braun, grün,...)
c) der Geschmackssinn: salado-soso
d) das Geschlecht: [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
e) die Gefühle: amar - odiar
Alle diese Normen sind natürlich stark subjektiv beeinflußt und je nach sozialen und persönlichen Abhängigkeiten unterschiedlich. Dies ist auch durch
5 Graduierbare Adjektive
erklärbar. Vor allem bei Gefühlen und Qualitätsunterscheidungen ist aufgrund der fehlenden objektiven Kriterien eine Klassifikation kaum möglich. So stehen uns zum Beispiel zur Beschreibung der Temperatur nicht nur heiß und kalt zur Verfügung. Ein Wettervorhersage in den Nachrichten beschreibt die Temperaturen des nächsten Tages mit vielmehr Ausdrücken. Von lauwarm, über frisch bis hin zu eiskalt werden die unterschiedlichen Wetterwerte angekündigt. Zwei Grad Celcius können für den Sprecher das Wetter als „kühl“ bewerten lassen, für den Zuhörer aber eiskalt bedeuten. In einem anderen Zusammenhang bedeutet die Beschreibung kalt für ein Schwimmbad nicht dasselbe wie für eine Frau. Genauso wenig ist die Temperatur eines heißen Tees nicht dieselbe wie die einer heißen Dusche. Natürlich ist heiß eine höhere Temperatur als die Norm und kalt ist niederer als die Norm, aber die Definition der Norm selbst ist nicht klar definierbar.
6 Wörter die keine Antonyme sind
Wie die Synonymie ist auch die Antonymie nur partiell und existiert nur von Semem zu Semem. So erscheinen kontextfrei hoch und niedrig als Antonyme. Es ist aber zu beachten, daß durch die Einordnung in den Kontext, nicht mehr alle Antonympaare Repräsentanten des Gegensinns sein können.
Bsp.: hohes Haus - niedriges Haus
aber: das Haus ist 10 m hoch - kein Antonym
Eine eindeutige Bezeichnung für Antonyme ist also schwer zu definieren. Nicht einig sind sich die Wissenschaftler, ob die Gegenüberstellung mit Hilfe von Wortbildungsmitteln (Präfixen) als systemhafte antonymische Erscheinung zu gelten habe. Nach Schmidt fallen Wörter, deren gegensätzliche Bedeutung mit Hilfe von Negationspartikeln zustande kommen, nicht unter den Begriff Antonyme.
Bsp.: Tiefe - Untiefe, ehrenhaft - unehrenhaft, zufrieden - unzufrieden
Nach Lenkova und Iskoz ist aber in der Wortbildung eine Quelle für die Entstehung von Antonymen. In der Gruppe der Antonyme werden alle Wörter eingeschlossen, die zu einem gegeben Wort in einem gegebenen Kontext die Gegenbedeutung tragen. Weiters ist die Begriffsdefinition Antonymie semantisch interpretiert, und der Bau dieser Wörter ist somit nicht zu berücksichtigen. Daher zählen sie alle jene Wörter zu Antonymen, die in einem gegebenen Kontext die Gegenbedeutung tragen.
Nach Fleischer ist eine der Hauptquellen der Entstehung von Antonymen die Wortbildung mit Hilfe von Suffixen und Präfixen. Er stellt folgende Gegenüberstellung auf:
über-/unter-, unter-/ober-: Oberarm - Unterarm, Oberbekleidung - Unterbekleidung, Oberlauf - Unterlauf, Oberhaus - Unterhaus, aber auch Vor- und Haupt- in Vorzug - Hauptzug, Vortrupp - Haupttrupp.
7 Konklusion
Wie wir nun gesehen haben ist es nicht immer möglich eine klare, eindeutige Definition von Antonympaaren zu geben, da nicht für jedes Wort ein allgemein gültiges Kriterium existiert. Daher ist es nicht verwunderlich, daß sich auch die Sprachwissenschaftler nicht immer einig sind und die verschiedenen Untersuchungen sich durch die verschieden angewandten Termini und Lösungen unterscheiden. Bleibt nur abzuwarten was sich, durch die Einbeziehung der sich laufend ändernden Trends der gesprochenen Sprache, noch alles verändern wird und inwiefern sich mit dieser Einbeziehung die Untersuchungen verändern und erweitern werden.
Natürlich konnte die Thematik der Antonyme hier nur oberflächlich und anhand weniger Beispiele behandelt werden; die grundlegende Idee dieser Arbeit liegt darin, einen generellen Überblick über die vielfältigen Typen und Einteilungen zu geben.
8 Bibliographie
Abraham, Werner: Terminologie zur neueren Linguistik. Max Niemeyer Verlag, Erlangen 1988, S. 51ff.
Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. Alfred Kröner Verlag Stuttgart 1989, S.87
Dubois, Jean: Dictionnaire de linguistique. Librairie Larousse, Paris VI 19 , S.37ff.
Lewandowski, Theodor: Linguistisches Wörterbuch 1. Quelle und Meyer Heidelberg, Wiesbaden 1990.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Antonyme - Wörter des Gegensinns"?
Der Text behandelt das Thema der Antonymie, also Wörter mit gegensätzlicher Bedeutung. Er untersucht die Schwierigkeiten bei der Definition von Antonymen und stützt sich dabei hauptsächlich auf die Einteilung von Richard Warczyk, ergänzt durch andere Perspektiven. Der Fokus liegt auf Adjektiven als häufigste Beispiele für Antonyme.
Was ist das Ziel dieser Arbeit über Antonyme?
Ziel ist es, einen Überblick über die Antonymie und verschiedene Meinungen von Sprachwissenschaftlern zu geben. Die Arbeit gliedert sich in die Entstehung, Definition, Typen (nach Warczyk) und die Problematik der eindeutigen Bezeichnung von Antonymen.
Wie hat sich das Studium der Antonymie entwickelt?
Die Anfänge der Antonymieforschung reichen bis zu Aristoteles zurück. Im Laufe der Zeit haben sich Terminologien und Perspektiven verändert, aber einige grundlegende Theorien haben Bestand. Viele Antonyme sind historisch gesehen das Ergebnis von Polarisierungsprozessen in der Umgangssprache.
Wie wird Antonymie definiert?
Antonymie stammt aus dem Griechischen und bedeutet "Gegenname". Antonyme sind Gegenwörter, Gegensatzwörter oder Wörter mit Gegenbedeutung. Sie existieren nur von Semem zu Semem und treffen nur auf einen geringen Teil des Wortschatzes zu, insbesondere dort, wo Polarität möglich ist.
Welche Arten von Gegensätzen gibt es?
Es gibt den kontradiktorischen Gegensatz (z.B. Armut - Reichtum), den konträren Gegensatz (z.B. kommen - gehen) und den komplementären Gegensatz (z.B. männlich - weiblich). John Lyons unterscheidet zusätzlich zwischen Antonymen, Komplementarität und Konversion.
Welche Typen der Antonymie werden nach Warczyk unterschieden?
Warczyk unterscheidet verschiedene Typen, darunter: 1) Verben mit Präfixen wie de(s)-, re- (z.B. placer-deplacer), 2) Aktionen, die das Ergebnis einer anderen Aktion eliminieren (z.B. coller-décoller), 3) unregelmäßige und regelmäßige Antonyme (z.B. présence-absence, rationnel-irrationnel) und 4) Antonyme, die auf plus - moins basieren (z.B. grand - petit).
Was sind graduierbare Adjektive im Zusammenhang mit Antonymen?
Graduierbare Adjektive ermöglichen eine Abstufung zwischen den Polen eines Gegensatzes (z.B. heiß - kalt). Die Bedeutung der Adjektive ist stark kontextabhängig und subjektiv beeinflusst.
Welche Wörter sind keine Antonyme?
Wörter, deren gegensätzliche Bedeutung mit Hilfe von Negationspartikeln gebildet wird, werden von einigen Wissenschaftlern nicht als reine Antonyme angesehen (z.B. Tiefe - Untiefe). Kontext spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung, ob ein Wortpaar tatsächlich Antonyme sind.
Wie werden Antonyme in der Wortbildung erzeugt?
Nach Fleischer ist die Wortbildung mit Hilfe von Suffixen und Präfixen eine der Hauptquellen für die Entstehung von Antonymen (z.B. über-/unter-).
Was ist die Schlussfolgerung der Arbeit?
Eine klare, eindeutige Definition von Antonympaaren ist nicht immer möglich, da nicht für jedes Wort ein allgemein gültiges Kriterium existiert. Die Meinungen der Sprachwissenschaftler gehen auseinander. Die Einbeziehung der sich ändernden Trends der gesprochenen Sprache wird die Untersuchungen in Zukunft beeinflussen.
Welche Literatur wird in der Arbeit zitiert?
Die Arbeit zitiert Werke von Werner Abraham, Hadumod Bußmann, Jean Dubois, Theodor Lewandowski und Richard Warczyk.
- Citar trabajo
- Simone Battlogg (Autor), 2000, Antonyme - Wörter des Gegensinns, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104378