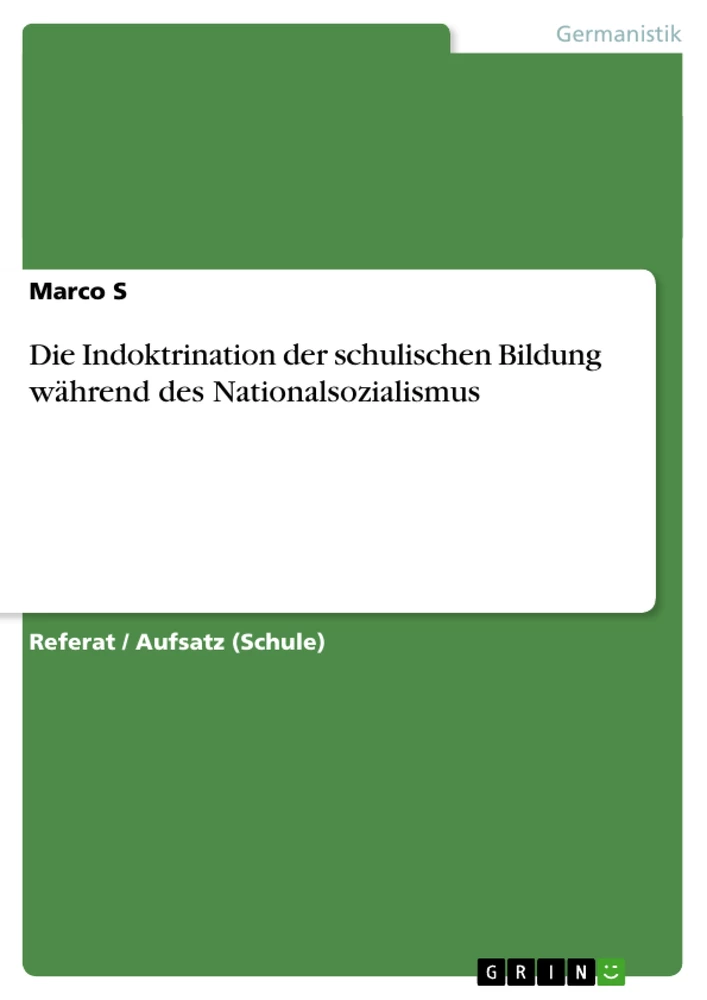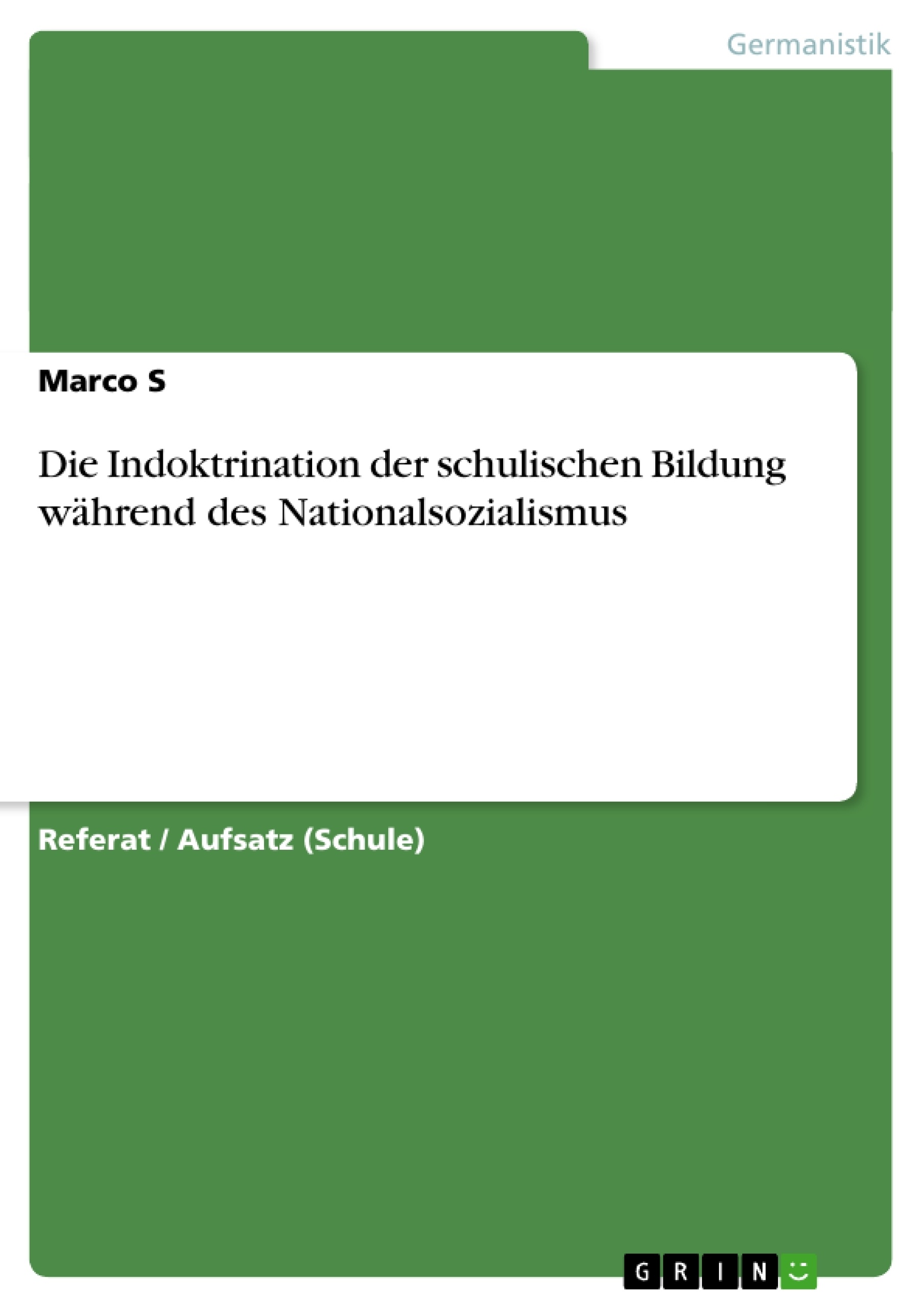Was bedeutet es, Mensch zu sein in einer Zeit, in der Ideologie über Moral gestellt wird? Ödön von Horváths erschütternder Roman "Jugend ohne Gott" entführt den Leser in das Deutschland der 1930er Jahre, wo ein Lehrer durch den aufkeimenden Nationalsozialismus mit einer zunehmend indoktrinierten Jugend konfrontiert wird. Als er einen Schüler für rassistische Äußerungen im Unterricht kritisiert, findet er sich bald im Kreuzfeuer seiner Klasse, der Schulleitung und einer Gesellschaft wieder, die sich blind dem totalitären Regime verschrieben hat. Die Situation eskaliert, als der Lehrer seine Klasse in ein militärisches Zeltlager begleitet, in dem ein Mord geschieht und er in einen Strudel aus Lügen, Verdächtigungen und moralischen Konflikten gerät. "Jugend ohne Gott" ist nicht nur ein packender Kriminalroman, sondern auch eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Themen Schuld, Verantwortung und dem Verlust der Menschlichkeit unter dem Einfluss von Propaganda und politischer Verblendung. Die präzise Charakterzeichnung, die subtile Kritik an der NS-Ideologie und die eindringliche Schilderung der psychologischen Auswirkungen auf die beteiligten Personen machen diesen Roman zu einem zeitlosen Mahnmal gegenTotalitarismus und für die Bedeutung individueller Freiheit und moralischer Integrität. Die formale Analyse des Buches zeigt Horváths meisterhaften Einsatz stilistischer Mittel, um die Atmosphäre der Zeit einzufangen und die inneren Konflikte des Lehrers widerzuspiegeln. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die Indoktrination der schulischen Bildung während des Nationalsozialismus, insbesondere durch Zeltlager und Schulbücher, und vergleicht diese mit den Zielen des heutigen Schulsystems, das auf selbstständiges Denken und Meinungsbildung ausgerichtet ist. Eine fesselnde Lektüre, die zum Nachdenken anregt und die Frage aufwirft, wie wir als Gesellschaft sicherstellen können, dass sich solche Gräueltaten niemals wiederholen. "Jugend ohne Gott" ist ein Muss für alle, die sich für Geschichte, Literatur und dieConditio humana interessieren. Der Roman regt zu einer wichtigen Diskussion über die Rolle von Bildung und individueller Verantwortung in einer Demokratie an und erinnert uns daran, wachsam zu bleiben gegenüber den Gefahren von Extremismus und Intoleranz. Ein zeitloser Klassiker, der auch heute noch von erschreckender Aktualität ist und uns dazu auffordert,Courage zu zeigen und für unsere Werte einzustehen.
I. Prolog
Um ein geeignetes Buch für meine erste Hausarbeit zu finden, habe ich nicht lange gebraucht. Ich habe mich für „Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horváth entschieden, weil ich das Buch bereits in der Mittelstufe im Unterricht behandelt habe. Damals habe ich festgestellt, dass es mehrere Arten gibt, dieses Buch zu lesen. Einmal als eine schöne Geschichte und ein anderes mal als ein tiefergehendes Buch. Es sind dem Leser mehrere Möglichkeiten gegeben, das Buch zu behandeln.
Außerdem interessiere ich mich sehr stark für den Nationalsozialismus. Also dachte ich mir, dass ich es nicht schwer haben würde, eine geeignete Themenstellung für meine erste Hausarbeit zu finden. Dies gestaltete sich dann jedoch schwieriger als erwartet. Man kann sich diesem Buch auf mehrfache Weise nähern. Einerseits kann man untersuchen, wie sich die Lehrer im Nationalsozialismus verhalten haben. Andererseits kann man, wie ich es tat, die Indoktrination der schulischen Bildung untersuchen. Und es gibt noch mehr Aspekte, die man untersuchen könnte Diese Arbeit soll zum Einen die formalen Aspekte des Buches untersuchen. So unter anderem, wie Horváth dieses Buch geschrieben hat und welche stilistischen Mittel er angewendet hatte. Zum Anderen widmet sich diese Arbeit den Mitteln, mit denen die Nationalsozialisten versucht haben, die Jugend auf ihre Seite zu bringen und wie es ihnen möglich war, aus den Menschen solche „Kampfmaschinen“ zu formen. Die verschiedenen Methoden, die dafür angewendet wurden, waren unter anderem die damaligen Schulbücher und die Zeltlager, die während des Nationalsozialismus zugelassen wurden.
Diese Arbeit soll aber auch ein Vergleich zwischen dem damaligen Schulsystem und dem heutigen Schulsystem sein, worin deutlich werden soll, wie sich die Ziele der schulischen Bildung verändert haben.
II. Hauptteil
1. Formale Analyse des Buches
1.1 Inhaltsangabe
In dem Roman „Jugend ohne Gott“ des österreichischen Schriftstellers Ödön von Horváth geht es um einen Gymnasiallehrer, der in einen Konflikt mit seiner Klasse gerät, die dem Nationalsozialismus verfallen ist und in einen Mord verwickelt wurde.
Die Erzählung von Ödön von Horváth spielt zur Zeit des Nationalsozialismus, in der es den Lehrkräften verboten war, ihre eigene Meinung zu vermitteln. Sie hatten sich an die strengen Vorgaben des Regimes zu halten. In einem Aufsatz über das von der Aufsichtsbehörde vorgegebene Thema »Warum müssen wir Kolonien haben?«1 schreibt ein Schüler: »Alle Neger sind hinterlistig, feig und faul.«2 Bei der Korrektur möchte der Lehrer diesen Satz durchstreichen, entschließt sich dann aber, es nicht zu tun. Bei der Rückgabe der Arbeiten macht der Lehrer den Schüler darauf aufmerksam und sagt ihm, dass dies eine sinnlose Verallgemeinerung darstelle und so nicht stimme. Nun kommt der Vater des Schüler in die Schule, um den Lehrer darauf aufmerksam zu machen, dass die Behauptung seines Sohnes jedoch stimme und fügt hinzu, dass man den Satz der Bibel, dass alle Menschen gleich seien, im übertragenen Sinne zu verstehen habe oder gar nicht. Nach dieser Unterhaltung mit dem Vater wird der Lehrer von seinen Schülern genau beobachtet. Seine Worte werden mitstenographiert und analysiert. Als er sie darauf anspricht, übergibt ihm die Klasse ein Papier, das alle unterzeichnet haben. Sie fordern einen neuen Lehrer. Der Direktor, den der Lehrer aufsucht, weist ihn darauf hin, dass er fortan auf die Vermittlung seiner eigenen Überlegungen verzichten und die offizielle Richtlinie befolgen solle, auch wenn der Direktor eher seiner Überzeugung zustimmen würde.
Kurz nach dem Zwischenfall, der zu einem Spannungsverhältnis zwischen Lehrer und Schülern führt, fährt der Lehrer mit seiner Klasse für eine Woche auf ein Zeltlager. In dieser Woche bekommen die Schüler dort eine vormilitärische Ausbildung vermittelt. In diesem Lager lernt der Lehrer den Dorfpfarrer kennen, der ihm erklärt, dass die nächste Generation so gefühllos und starr wie Fische werde. Später wird der Lehrer noch Zeuge eines Überfalls von zwei Buben und einem größeren Mädchen auf eine alte, blinde Frau. Weil trotz aufgestellter Wachen, aus Angst vor der Bande, etwas aus dem Lager gestohlen wird, kontrolliert der Lehrer gemeinsam mit dem Feldwebel einen Wächter, nämlich den Z. Dieser bekommt heimlich von einem fremden Jungen einen Brief überreicht, der daraufhin sofort wieder verschwindet. Am nächsten Morgen findet eine Rauferei statt, in der es darum geht, dass der Z nachts immer in sein Tagebuch schreibt. Der Lehrer erfährt, dass das Tagebuch in einem verschlossenen Kästchen aufbewahrt wird.
Anschließend, als die Jungen schießen lernen, geht der Lehrer aus Neugier in das Zelt des Z und bricht das Kästchen auf. Er liest in dem Tagebuch von dem Liebesverhältnis zwischen Z und Eva, die eine junge Räuberbande anführt. Am Ende des Tagebuches steht, dass jeder, der das Tagebuch liest, sterben werde. Als der Lehrer von den zurückkehrenden Schülern überrascht wird, muss er das Kästchen unverschlossen stehen lassen. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Schüler N und Wächter Z. Z verdächtigt den N, sein Kästchen aufgebrochen zu haben. Der Lehrer fühlt sich schuldig und bedauert seine Tat, hat jedoch nicht den Mut, es zuzugeben. Es fällt ihm auch auf, dass ihn der Schüler T beobachtet, als würde er etwas ahnen. Einige Tage später wird der Schüler N tot aufgefunden, und es stellt sich heraus, dass der Wächter Z und Eva an dem Mord beteiligt sind.
Die erste Überraschung während des Prozesses ist, dass der Schüler Z den Mord an dem Schüler N gesteht und auf eine Verteidigung verzichtet. Im weiteren Verlauf der Verhandlung stehen die Zeugenaussagen.
Im Mittelpunkt dieser Aussagen steht die Mutter des Z. Die wichtigste Aussage, die sie macht, ist, dass der Kompass, der bei der Leiche des N gefunden wurde, nicht der ihres Sohnes sei. Sie will ihren Sohn dazu bringen, zuzugeben, dass er gar nicht der Mörder sei. Es kommt zu einem Streit zwischen Z und seiner Mutter, währenddessen man erfährt, dass sich der Z von seiner Mutter vernachlässigt fühlt. Anschließend wird der Lehrer in den Zeugenstand gerufen. Er sagte, dass er das Kästchen aufgebrochen habe und nicht der N. Danach wird Eva befragt. Sie sagt, das Z und sie unschuldig seien und ein fremder Bub plötzlich aufgetaucht sei, von dem sie nur wisse, dass er Fischaugen habe. Er habe den N von hinten erschlagen. Der Lehrer ist sofort alarmiert, weil der Schüler T in die Beschreibung von Eva passt. Er vermutet auch, dass Z den Mord nur aus Liebe zu Eva gestanden hatte, weil er Eva für die Mörderin hielt.
Eines Morgens bekommt der Lehrer Besuch von einem Schüler seiner Klasse, der ihm erzählt, dass sie einen Klub zur Unterstützung ihres Lehrers gegründet hätten. Dieser Klub will den Schüler T überführen, weil Schüler B ihn hat sagen hören, dass er gerne einmal sehen wollte, wie ein Mensch stirbt und wie ein Mensch zur Welt kommt. Der Klub beobachtet T Tag und Nacht und erstattet dem Lehrer Bericht.
Etwa eine Woche später bekommt der Lehrer von dem Dorfpfarrer Besuch und bekommt eine Stelle in einer Missionarsschule in Afrika angeboten. Der Pfarrer fordert den Lehrer auch auf, der Mutter des T von dem Kästchen zu berichten, was er dann auch tut. Er trifft jedoch nur den T an und unterhält sich kurz mit ihm, da seine Mutter offenbar keine Zeit hat, erwähnt aber nichts von dem Kästchen.
In der darauffolgenden Nacht wird der Lehrer von zwei Kriminalkommissaren abgeholt und zu dem Haus des T gebracht. Die Polizei will wissen, was er der Mutter des Schülers T erzählen wollte, weil dieser in der Zwischenzeit Selbstmord begangen hatte. Die Mutter beschimpft den Lehrer, den T in den Selbstmord getrieben zu haben. Als Beweis hat sie ein abgerissenes Stück Papier, auf dem steht: »Der Lehrer trieb mich in den Tod.«3 Als die Mutter einen Nervenzusammenbruch erleidet, fällt ihr die zweite Hälfte des Zettels aus der Hand, auf dem geschrieben steht: »Denn der Lehrer weiß es, daß ich den N erschlagen habe. Mit dem Stein -«4
Damit ist der Mord des N aufgeklärt. Der Lehrer geht zu den „Negern“, um dort zu unterrichten, da er in seinem Heimatland den Beruf nicht mehr ausüben darf.
1.2 Der Autor
Ödön von Horváth wurde am 9. Dezember 1901 im heutigen Rijeka in Kroatien geboren. Horváths Vater, Dr. Edmund Josef Horváth, war Diplomat und seine Mutter hieß Maria Hermine Prehnal. Während seiner Schulzeit zog er mit seinen Eltern sehr oft um. Er selbst sagte darüber: »Während meiner Schulzeit wechselte ich viermal die Unterrichtssprache und besuchte fast jede Klasse in einer anderen Stadt. Das Ergebnis war, dass ich keine Sprache ganz beherrschte.« Bis 1924 studierte er in München Germanistik und schrieb danach viele Bücher und Theaterstücke. Ein frühes Theaterstück Horváths ist z. B. „Revolte auf Côte 3018“, in dem er die Hinwendung zur Volkskultur aufzeigte. Als die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) ihre Macht verstärkte, emigrierte er nach Wien, wo er weiterhin literarisch tätig war. In Deutschland stand Ödön von Horváth, neben Remarque und anderen, auf der Liste der verbotenen Autoren. Nach dem Zusammenschluss von Österreich mit dem Deutschen Reich (1938) siedelte Horváth nach Paris über.
1937/38 veröffentlichte er das Buch „Jugend ohne Gott“, in dem er beschreibt, wie sich die nationalsozialistische Jugend verhält. Erste Datierungen des Buches sind schon 1935 bekannt. Erstaunlich ist auch, dass er das Buch vor dem Nationalsozialismus geschrieben hatte und man demnach meinen könnte, dass es ein Tatsachenbericht sei. Sein Tod ist Ironie des Schicksals oder eine Verschwörung. Darüber ist man geteilter Meinung. Am 1. Juni 1938 wurde Horváth während eines Gewitters auf den Champs- Élysées von einem herunterfallenden Ast erschlagen. Wenige Tage zuvor hatte Horváth noch einem Freund erklärt: »Vor den Nazis habe ich keine so sehr große Angst Es gibt ärgere Dinge, nämlich die, vor denen man Angst hat, ohne zu wissen warum. Ich fürchte mich zum Beispiel vor der Straße. Straßen können einem übelwollen, können einen vernichten. Straßen machen mir Angst.« Daraus ergibt sich die Frage, ob Horvath von seinem Tod gewusst hatte oder ihn auch nur geahnt hatte.
1.3 Auffälligkeiten des Buches
Horváth benutzt in seinem Buch sehr viele stilistische Mittel, um den Leser direkt in sein Buch hineinzuversetzen. Der Schreibstil des Roman ist so, dass man mehrere Ebenen des Lesens erkennen kann. Zum Einen kann man das Buch als schöne Geschichte betrachten und einfach so hinnehmen. Die Aufmerksamkeit des Lesers wird auf den Ablauf des Inhalts gelenkt und so bemerkt er nicht, welche Kritik am Nationalsozialismus und der damaligen Zeit von Horváth geäußert wird. Durch diesen Erzählstil, erhält das Buch einen leichten Touch, als wäre es eine kleine, aber schöne Geschichte.
Eine zweite Leseebene erkennt man, wenn man das Buch geschichtlich interpretiert. So fällt ein Zusammenhang mit der Biographie schnell auf, dass Horváth das Buch vor dem Nationalsozialismus geschrieben hatte und noch nicht wissen konnte, was Hitler damals geplant hatte. Obwohl man das Buch auch als Tatsachenbericht einstufen könnte. Auffällig ist, dass Horváth am Anfang seines Romans fast ausschließlich positive Begriffe verwendet. Er schreibt immer »lieb«, »brav« oder »lieblich«. Dadurch, dass Horváth nur diese Begriffe verwendet, hat der Leser den Eindruck, als sei der Romananfang sehr naiv und oberflächlich geschrieben. Dies ist jedoch nicht der Fall, da Horváth am Anfang ein Fußballspiel bei schlechtem Wetter schildert5, in dem er die Ideologie der NSDAP widerspiegelt. So sind alle, die das Fußballspiel besuchen, geblieben. Wenn man dies nun auf die Politik der NSDAP bezieht, kann man feststellen, dass die Leute so sehr von der Propaganda erfasst worden sind, dass sie auch bei „Regen oder Schnee“ bis zum Ende bleiben. Jeder, der dort gegangen wäre, könnte als Feind des Nationalsozialistischen Regimes angesehen werden.
Bedeutungsvoll ist auch, dass Ödön von Horváth in seinem Roman kaum einen Namen benutzt. Eine Vielzahl der Namen, die Horváth verwendet, sind als Buchstaben abgekürzt. So erklärt er am Anfang, welche Schüler in seiner Klasse sind, und beschreibt, dass er »... vier ... mit S, drei mit M, je zwei mit E, G, L ...«6 in seiner Klasse habe. Nur vereinzelt gebraucht Horváth Namen. So zum Beispiel Eva, den Schüler Otto N, Franz Bauer usw. Er will damit deutlich machen, dass das Geschehen, das dort geschildert ist, nicht von den einzelnen Personen bzw. Individuen abhängig ist. Sie sind für die Handlung des Romans unwichtig. In dem gesamten Roman wird jedoch kein Ortsname erwähnt, was kennzeichnen soll, dass dieses Geschehen nicht an einen bestimmten Ort gebunden ist. Es wäre möglich, es in die ganze Welt zu übertragen. Häufig benutz Horváth auch an Stelle der Namen Synonyme. So unterhält er sich mit Julius Caesar in einer Bar und bekommt von ihm allerlei erzählt. In Wirklichkeit war Julius Caesar vermutlich Ludwig Köhler, der ebenfalls als Lehrer tätig war, jedoch frühzeitig in den Ruhestand versetzt worden ist. Dieser Lehrer soll homosexuell veranlagt gewesen sein, weswegen er vermutlich in dem Buch als Erotomane dargestellt wird.
Das Buch „Jugend ohne Gott“ könnte auch als Detektivroman bezeichnet werden. Es sind alle Anzeichen dafür vorhanden. Es gibt einen Fall bzw. Sachverhalt, der geklärt werden soll (so der Mordfall des N) und einen Detektiv oder Aufklärer (wie ihn der Lehrer darstellt). Außerdem noch ein existierenden Täter (in diesem Fall der T) und weitere Zeugen (Eva) sowie Indizien (Kompass und Bleistift), die helfen sollen, den Fall aufzuklären. Aus diesem Grund komme ich zu der Überzeugung, dass „Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horváth ebenfalls einen Detektivroman darstellen könnte und nicht nur einen „einfachen“ oder „geschichtlichen“ Roman.
1.4 Stil des Buches
Der Stil des Buches ist gekennzeichnet durch kurze, relativ eigenständige Kapitel. Diese Kapitel haben eine Überschrift, die sich exakt zitiert auch im Text wiederfindet. Kennzeichnend für diese Kapitel ist die erwähnte Eigenständigkeit sowie die knappen Dialoge, die zwischen den Personen stattfinden. Allerdings befinden sich in dem Text auch einige Monologe. Diese sind von Horváth aufgelockert worden, in dem er Fragen stellt und somit eine Art des Dialoges schafft. Dadurch sind die Monologe sehr spannend gestaltet. (Im Gegensatz zur Faustdichtung, wo die Monologe lang und ohne jede Unterbrechung sind. Die Monologe Fausts sind daher sehr schwer zu lesen.) Was ebenfalls kennzeichnend für den Roman ist, sind die mannigfaltigen telegrammartig gekürzten Sätze. Außerdem verwendet Horváth in seinem Roman viele Einwortsätze. Diese stellen häufig Antworten dar oder Worte, die Personen bezeichnen sollen. Höhepunkte schafft Horváth, in dem er einen Bericht unvermittelt in die Darstellung von Situationen übergehen lässt. Diese werden oft nur sichtbar an den fast unmerklichen Tempuswechseln, die dann das Vergangene sichtbar werden lassen. Interessant ist auch, dass Horváth viele der NS-Parolen wiedergibt, diese jedoch umkehrt. Das ist eine der versteckten Kritiken an der damaligen Zeit in seinem Roman. Horváth verwendet hauptsächlich Parataxen, die auch der Ich-Erzähler in seinen inneren Monologen verwendet. Die Dialoge im Roman sind sehr knapp gehalten und die sprechenden Personen kommen schnell auf den Punkt, um zu sagen, was sie sagen wollen, ohne großartig darum zu reden.
Wie bereits unter 1.1 erwähnt, ist der Roman so geschrieben, dass man ihn auf verschiedenen Ebenen lesen kann. Die erste Ebene kennzeichnet, dass das Werk einfach zu lesen ist, ohne dass man größer darüber nachdenkt. Dann ist es eine schöne Geschichte. Eine zweite Ebene ist, wenn man den Text interpretiert und die Kritiken des Autors versteht. Die Intention des Autors ist, auf die kommenden Missgeschicke bzw. Unglücke des Dritten Reiches und des Nationalsozialismus hinzuweisen. Dadurch wird das Buch für den Leser interessant gestaltet.
2. Die Indoktrination der schulischen Bildung während des Nationalsozialismus
2.1 Das Zeltlager
Das Hauptaugenmerk in dem Buch „Jugend ohne Gott“ liegt ohne Zweifel im Zeltlager. Anzumerken ist hier, dass den Schülern in diesem Zeltlager eine vormilitärische Ausbildung zuteil wurde (s. 1.1 Inhaltsangabe). Mit dieser Ausbildung soll der Mut der Jungen geweckt werden. Sie sollen schließlich nach Hitler zum „perfekten“ Soldaten erzogen werden. Damals hatte man festgestellt, dass die »Keimzellen zum Mut, zur Entschlossenheit und Willensenergie im systematischen Aufbau des Geräteturnens«7 liegen. Daraus wird ersichtlich, dass die Jugendlichen bereits im Sport, oder gerade mit dem Sport, zum Soldaten erzogen werden sollten. Aus diesem Grunde hatten die Jungen auch das Fechten zu erlernen. Dies wurde aus „plausiblen“ Gründen gemacht. Durch das Fechten sollte den Jugendlichen (meist Jungen) Schnelligkeit und Geschicklichkeit vermittelt werden.
All dies waren Tugenden, die sie im Krieg gut verwenden konnten. Hitler ließ jedoch auch die Mädchen nicht unbeachtet. In „Mein Kampf“ von 1925 sagte er: »Auch dort [bei der Erziehung der Mädchen] ist das Hauptgewicht vor allem auf die körperliche Ausbildung zu legen, erst dann auf die Förderung der seelischen und zuletzt auch auf die geistigen Werte. Das Ziel der weiblichen Erziehung hat unverrückbar die kommende Mutter zu sein.«8 Dieser Ausspruch Hitlers zeigt, dass er nichts dem Zufall überlassen wollte. Alles, was er tat, hatte einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Im Wehrsport, und unter anderem auch in den Zeltlagern, wurde vor allem auf die folgenden drei Ausbildungsziele Wert gelegt: 1. Schießausbildung; 2. militärische Ordnungsübungen; 3. eine Gefechtsausbildung. Hinzu kam noch eine spezialisierte Ausbildung, sowie Seh- und Hörübungen und Täuschung und Tarnung, die sie zu absolvieren hatten. Diese ganzen Ausbildungsmöglichkeiten trugen zur politischen Deformation der Jugend bei. Damit ist gemeint, dass der Individualismus der Jungen abgebaut werden sollte. Mit besonderer Gründlichkeit geschah dies in den damaligen Zeltlagern. Dort sollen sie zu den künftigen „Kampfmaschinen“ ausgebildet werden. Am deutlichsten wird das in der Aussage des Lehrers: »Alles Denken ist ihnen verhaßt. Sie pfeifen auf den Menschen! Sie wollen Maschinen sein, Schrauben, Räder, Kolben, Riemen - doch noch lieber als Maschinen wären sie Munition: Bomben, Schrapnells, Granaten. Wie gerne würden sie krepieren auf irgendeinem Feld! Der Name auf einem Kriegerdenkmal ist der Traum ihrer Pubertät.«9 Hitler sagte in seiner Rede in Reichenberg zu diesem Thema: »Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln «10
2.2 Die Schulbücher
Dass Hitler die Jugend nicht erst in den Zeltlagern erzog, ist weitestgehend bekannt. Die erste Instanz, in der Hitler die Jugend in seinem Sinne erziehen konnte, war in der Schule. Wenn man sich die Schulbücher ansieht, wird Hitlers Wahn sehr deutlich. In Physik zum Beispiel wurde berechnet, wie sich die Witterung auf die Geschossbahn einer Kugel auswirken kann. Ein anderes Bespiel kommt aus der Chemie. Dort hatten die Schüler die Qualität von Sprengstoffen zu untersuchen. Dies zeigt, dass Hitler nichts dem Zufall überlassen wollte. Diese Art von Aufgaben ließ die Jugend gegen etwaige Beschuldigungen wegen Grausamkeiten von Außen, wie z.B. die Alliierten oder KZ- Häftlinge, abstumpfen und sie sahen nicht ein, was sie denn falsch machen würden. Anfangs wurden solche Aufgaben nur in Sonderheften des NS-Lehrerbundes verbreitet, später waren sie in den Schulbüchern integriert. Hitler sagte einmal über die Erziehung der Jugend: »Seine gesamte Erziehung und Ausbildung muss darauf angelegt werden, ihm die Überzeugung zu geben, anderen unbedingt überlegen zu sein.«11 Dazu möchte ich ein Beispiel aus dem Bereich der Mathematikbücher benennen. Dort sollte das »Euthanasie«-Problem aus »Ersparnisgründen« »plausibel« gemacht werden. So heißt es 1936: »Der Bau einer Irrenanstalt kostet 6 Mill. RM. Wie viel Familien könnten dafür eine Wohnung erhalten?« Diese Aufgabe nimmt bezug auf die Pflegekosten für Taube, Blinde, körperlich und geistig Behinderte. Da wird die Zahl von 167 000 geistig Behinderten, 8 300 tauben und blinden Menschen sowie 20 600 weiteren körperlich Behinderten genannt. Die Frage, die dazu gestellt wurde, lautete: »Wie viele erbgesunde Familien könnten bei RM 60 durchschnittlicher Monatsmiete für diese Summe untergebracht werden ... ?«12 Diese und andere Schulbücher trugen später dazu bei, dass ca. 60 000 bis 70 000 sogenannte Erbkranke in Deutschland durch Giftgas oder Injektionen umgekommen sind, ohne dass die Täter moralische Bedenken hatte.
2.3 Die Hitler-Jugend im Unterricht
Aber nicht nur die Schulbücher haben zu dieser „Abstumpfung“ der Jugend beigetragen. Hitler sagte einmal: »Im völkischen Staat soll also das Heer nicht mehr dem einzelnen Gehen und Stehen beibringen, sondern es hat als die letzte und höchste Schule vaterländischer Erziehung zu gelten ...«13 Daraus wird ersichtlich, dass Hitler eine Strategie zur Vernichtung „nicht arischer“ Menschen vorbereitet hatte. Anfangs gab es die Hitler-Jugend (HJ) als freiwillige Organisation. Niemand wurde gezwungen beizutreten. Jedoch wurde die HJ am 25. März 1939 zur Staatsjugendorganisation erklärt und galt ab diesem Zeitpunkt als nicht mehr freiwillig. Sie wurde für alle Jungen zur Pflicht.
Für die Mädchen wurde damals der „Bund Deutscher Mädels“ gegründet. Sie erlernten dort, wie man seinem Land auch von zu Hause aus helfen konnte. So war zum Beispiel eine Übung das „Flieger suchen“, in der es darum ging, ein abgestürztes Flugzeug schnell zu finden, um dann entweder den Piloten zu helfen oder zu überwältigen, wenn es ein feindliches Flugzeug gewesen ist.
Der Leiter war Baldur von Schirach, der für die „Erziehung“ der deutschen Jugend „außerhalb von Elternhaus und Schule“ verantwortlich war. Wer nun nicht mehr der HJ beitreten wollte, musste damit rechnen, von seinen Mitschülern, welche die Hitler- Jugend angehörten, gehänselt und verprügelt zu werden. Auch mussten die Schüler, die anfangs nicht die HJ besuchten, einen „Nachhilfeunterricht“ absolvieren, während die anderen zu Jungvolkversammlungen gingen. In diesem „Nachhilfeunterricht“ bekamen die Schüler einen Sonderunterricht in „deutscher Staatskunde“, um zu lernen wie man sich als Deutscher verhalten solle.
Hieraus ergab sich ein Streitpunkt zwischen den HJ-Führern und den Schulen bzw. den Schulleitern. So galt zwar der Grundsatz, dass die Schule Vorrang habe, die Realität sah jedoch etwas anders aus. So galt die Hitler-Jugend mehr als die Schule. Auch wurden diejenigen Schüler geärgert, die nicht in der HJ waren. Das sorgte für großen Spannungen. So mussten an der Holbeinschule in Frankfurt diejenigen Schüler im Musikunterricht aufstehen, wenn in einem Lied eine bestimmte Strophe kam. Diese Strophe hieß zum Beispiel »Der Weichling fällt!«. Nun sollten alle Schüler, die nicht in der HJ waren, aufstehen, und worauf dann die Lehrer bemerkten, dass die anderen sich diesen „Abschaum“ ansehen sollen. Um diese Jugendlichen dann noch mehr zu peinigen, wurde diese Strophe mehrfach wiederholt und die Jungen mussten so lange stehen bleiben, bis es vorbei war. Diese und andere Vorfälle waren für die meisten Schüler so „normal“, dass sie sich heute nicht mehr daran erinnern können.
2.4 Vergleich mit unserem Schulsystem
Während Hitler seine Erziehung auf totalen Gehorsam ausgelegt hatte, ist unser Schulsystem dazu da, das selbständige Lernen bzw. Arbeiten zu fördern.
Hitler sagte einmal über seinen „perfekten“ Schüler: »Er soll lernen, zu schweigen, nicht nur, wenn er mit Recht getadelt wird, sondern soll auch lernen, wenn nötig, Unrecht schweigend zu ertragen.«14 Dies zeigt, dass die Jugendlichen keinen eigenen Willen haben sollten. Sie hatten ihre eigene Meinung zu Gunsten des Nationalsozialismus zu opfern, auch wenn sie anderer, vielleicht besserer, Meinung waren. Diese Handlungsweise war jedoch nicht unüblich, weil ihnen durch die Propaganda von Reichspropagandaminister Goebbels klar gemacht wurde, dass das einzig Wahre die Ideologie des Nationalsozialismus war. Das Ziel der Hitler’ schen Erziehung war, die Jugend zu blindem Gehorsam zu erziehen und sie so zu einem „perfekten“ Soldaten zu formen. Hitlers Ziel, war, dass er Männer brauchte, um sie zu Kommandanten in Konzentrationslagern zu machen, die dann nicht hinterfragen würden, welche Befehle er gab. Diese Männer sollten nicht darüber nachdenken, wie viele Menschen sie täglich ermordeten.
Im Vergleich dazu möchte ich unser Schulsystem aufzeigen. Während unserer Schulzeit wird permanent das selbständige Arbeiten und Denken gefördert. So sollen die Schüler lernen, Aufgaben zu bearbeiten, ohne dass der Lehrer erforderlich ist. Ein Beispiel dafür ist unsere Gruppenarbeit zum Buch „Effi Briest“ von Theodor Fontane. Wir haben das Buch selbständig erarbeitet und es daraufhin der Klasse vermittelt. Dies macht deutlich, dass die Selbständigkeit in unserem Schulsystem wichtig ist und gefördert werden soll.
Weiterhin soll durch unsere schulische Erziehung die Meinungsbildung verstärkt werden. So besteht eine Arbeit aus drei Aufgabenbereichen. Eine davon ist, seine eigene Meinung begründet darzustellen. Dies ist sehr wichtig, um erneut eine Entwicklung wie im Nationalsozialismus zu verhindern. Beurteilt wird jedoch nicht die eigene Meinung, sondern wie man sie begründet. Der größte Gegensatz ist also, dass man sich eine eigene Meinung bilden soll und nicht einfach einem anderen glaubt. Wichtig ist nur, dass unsere Meinung nicht „aus der Luft gegriffen“ ist und begründet werden kann. Deshalb fördert unser Schulsystem die eigene Meinungsbildung.
III. Epilog
Diese Arbeit beschäftigte sich mit Hitler und dessen Erziehungsidealen. Sie sollte aufzeigen, was es ausmachte, ein Hitler-Junge zu sein.
Ich möchte an dieser Stelle auch auf das der Arbeit vorangestellt Zitat verweisen. Dies verdeutlicht meiner Meinung nach sehr deutlich, wie wertvoll ein einziges Menschenleben ist. Und während des Nationalsozialismus sind mehr als genug Menschen umgekommen, die als „lebensunwert“ bezeichnet wurden. Es zeigt auch, was es heißt, ein Mensch zu sein. Es sollte jedem Einzelnen bewusst sein, wie wertvoll es ist zu leben, denn das Leben ist kurz genug. Jeder sollte versuchen, sein Leben zu genießen.
Abschließend möchte ich Stellung zu den in der Arbeit angesprochenen Themen beziehen.
Dies ist natürlich nur ein kleiner Ausblick, was passiert ist. Geschichtlich war noch mehr in Aufruhr versetzt worden als hier beschrieben. Diese Arbeit ist eine Spezialisierung über die Jugend im Dritten Reich.
Ich will nicht befürworten, was im Dritten Reich geschah. Man konnte schließlich erkennen, welche Unterschiede es in den Erziehungsstrukturen gab. Hitler wollte einen Gehorsam, der meiner Meinung nach in der heutigen Zeit undenkbar ist. Es würde heute niemand mehr einem „Führer“ folgen und deshalb denke ich, ist es sehr wichtig, dass sich alle gegen die Neo-Nazis wehren.
Man kann Deutschland aber auch nicht ewig für die Verbrechen des Nationalsozialismus verurteilen. Ich will auch nicht, dass dies alles in Vergessenheit gerät, ganz im Gegenteil. Aber man muss auch heute noch die in Ansätzen existierende Gewalt gegenüber anderen Menschen bekämpfen. Denn Jostein Gaarder hatte kein Unrecht mit seinem Zitat. Ein Menschenleben ist sehr viel wert und man darf es nicht vergeuden. Und es ist falsch, eine Ablehnung gegen Menschen zu haben, nur weil sie anders sind als wir. Wir müssen auch helfen, die Tiere zu retten, denn auch sie sind für ein funktionierendes Gleichgewicht der Natur nötig. Und wir wiederum sind von der Natur abhängig.
Mir selbst gefiel das Buch sehr. Man kann es, wie bereits erwähnt, aus vielen Sichtweisen betrachten, und es hat viele Ansätze, über die man weiter nachdenken kann. So hat diese Arbeit viele Motive nicht aufgegriffen. Zum Beispiel die Motive Jugend und Gott, die ich anfangs für meine Arbeit ausgesucht hatte. Während des Schreibens, an dieser Arbeit, kamen mir immer neue Ideen und Vorstellungen, wie die Arbeit am Ende sein sollte. Ich denke auch nicht, dass man das Thema Nationalsozialismus abschließen kann. Noch viele werden sich mit diesem Thema beschäftigen, und es wird immer neue Gedanken geben.
An dem Buch von Ödön von Horváth gefiel mir besonders, dass er dem Leser viele Möglichkeiten gab, weiterzudenken. Er beschrieb zwar vieles sehr detailliert, jedoch blieb trotz dieser Beschreibungen viel Freiraum für die eigene Phantasie.
Wir dürfen aber niemals vergessen, was im Dritten Reich geschah. Denn wenn man etwas vergessen hat, dann begeht man einen Fehler auch ein weiteres Mal.
IV. Literaturverzeichnis
1. Primärliteratur
Horváth, Ödön von: Jugend ohne Gott Frankfurt am Main, 1983.
2. Sekundärliteratur
Keufgens, Norbert: Erläuterungen und Dokumente zu Jugend ohne Gott Stuttgart, 1998.
Knopp, Guido: Hitler - Ein Verbrecher Digital Publishing, Deutschland 1998
Ortmeyer, Benjamin: Schulzeit unterm Hitlerbild Frankfurt am Main, April 1996.
www.hausarbeiten.de/rd/archiv/deutsch/deutsch-jugend-handout.shtml
www.hausarbeiten.de/cgi-bin/superDBdruck.pl/archiv/deutsch/deutsch-horvath.shtm www.referate.de/cgi-bin/referate.cgi/deu0053.zip
www.zum.de/faecher/D/BW/gym/horvath/jugend.htm
[...]
1 Horváth, Ödön von: Jugend ohne Gott Frankfurt am Main, 1983. S. 12.
2 Horváth S. 13.
3 Horváth S. 144.
4 Horváth S. 147.
5 Vgl. Horváth S. 14.
6 Horváth S. 12.
7 Keufgens, Norbert: Erläuterungen und Dokumente zu Jugend ohne Gott Stuttagrt, 1998. S. 43.
8 Knopp: Hitler über die Erziehung der deutschen Jugend
9 Horváth S. 24.
10 Ortmeyer, Benjamin: Schulzeit unterm Hitlerbild Frankfurt am Main, 1996. S. 20f.
11 Ortmeyer S. 23f.
12 vgl. Ortmeyer S. 53f.
13 Knopp: Hitler über die Erziehung der deutschen Jugend
Häufig gestellte Fragen zu "Jugend ohne Gott"
Worum geht es in "Jugend ohne Gott"?
Der Roman handelt von einem Gymnasiallehrer zur Zeit des Nationalsozialismus, der mit der Indoktrination seiner Schüler konfrontiert wird und in einen Mordfall verwickelt wird.
Wer ist der Autor von "Jugend ohne Gott"?
Der Autor ist Ödön von Horváth, ein österreichischer Schriftsteller, der 1901 geboren wurde und 1938 in Paris durch einen Unfall starb.
Welche formalen Aspekte kennzeichnen das Buch?
Das Buch verwendet viele Stilmittel, um den Leser in die Geschichte hineinzuversetzen. Es gibt verschiedene Lesarten: als einfache Geschichte oder als Kritik am Nationalsozialismus. Horváth verwendet oft abgekürzte Namen, Synonyme und nur wenige Ortsangaben, um die Allgemeingültigkeit der Handlung zu betonen. Der Roman weist auch Elemente eines Detektivromans auf.
Welchen Schreibstil verwendet Horváth in dem Buch?
Horváth verwendet kurze Kapitel, knappe Dialoge, Monologe mit Fragen, telegrammartig gekürzte Sätze und Einwortsätze. Er lässt Berichte unvermittelt in die Darstellung von Situationen übergehen und kehrt NS-Parolen um, um versteckte Kritik zu üben.
Welche Rolle spielt das Zeltlager im Buch?
Das Zeltlager ist ein zentrales Element, in dem die Schüler eine vormilitärische Ausbildung erhalten. Dies dient dazu, ihren Mut zu wecken und sie zu "perfekten" Soldaten im Sinne Hitlers zu erziehen. Es dient als Beispiel für die Indoktrination der Jugend im Nationalsozialismus.
Wie wurden die Schulbücher zur Indoktrination genutzt?
Die Schulbücher enthielten Aufgaben, die militärisches Wissen vermittelten und die Jugend gegen Grausamkeiten abstumpfen sollten. Beispielsweise wurden Berechnungen zur Witterungseinfluss auf Geschossbahnen oder Aufgaben zur Qualität von Sprengstoffen gestellt. Auch das Euthanasie-Problem wurde aus "Ersparnisgründen" "plausibel" gemacht.
Welche Rolle spielte die Hitler-Jugend (HJ) im Unterricht?
Die Hitler-Jugend wurde zur Staatsjugendorganisation erklärt und war für Jungen Pflicht. Die HJ-Führer hatten oft Vorrang vor den Schulen. Schüler, die nicht in der HJ waren, wurden gehänselt und mussten "Nachhilfeunterricht" in "deutscher Staatskunde" absolvieren.
Wie unterscheidet sich das damalige Schulsystem vom heutigen?
Während das Schulsystem im Nationalsozialismus auf totalen Gehorsam ausgerichtet war, fördert das heutige Schulsystem das selbstständige Lernen und Arbeiten sowie die Meinungsbildung. Im Nationalsozialismus sollten Jugendliche keinen eigenen Willen haben, während heute die Schüler lernen sollen, sich eine eigene, begründete Meinung zu bilden.
Was ist die Hauptaussage der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Erziehungsideale Hitlers und die Indoktrination der Jugend im Nationalsozialismus. Sie vergleicht das damalige Schulsystem mit dem heutigen und betont die Bedeutung der eigenen Meinungsbildung und des selbstständigen Denkens.
- Quote paper
- Marco S (Author), 2001, Die Indoktrination der schulischen Bildung während des Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104350