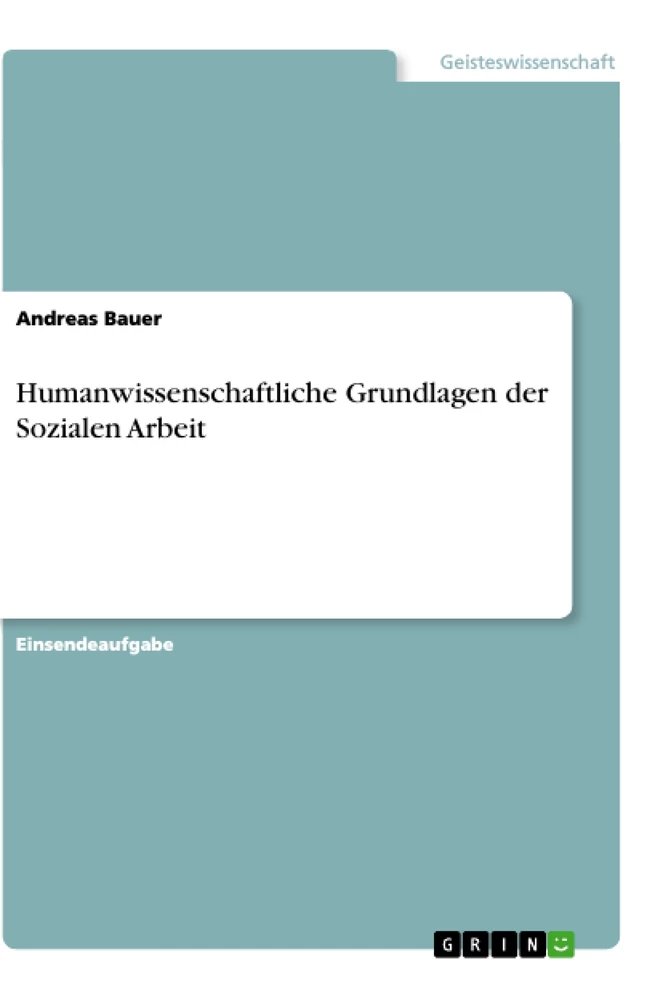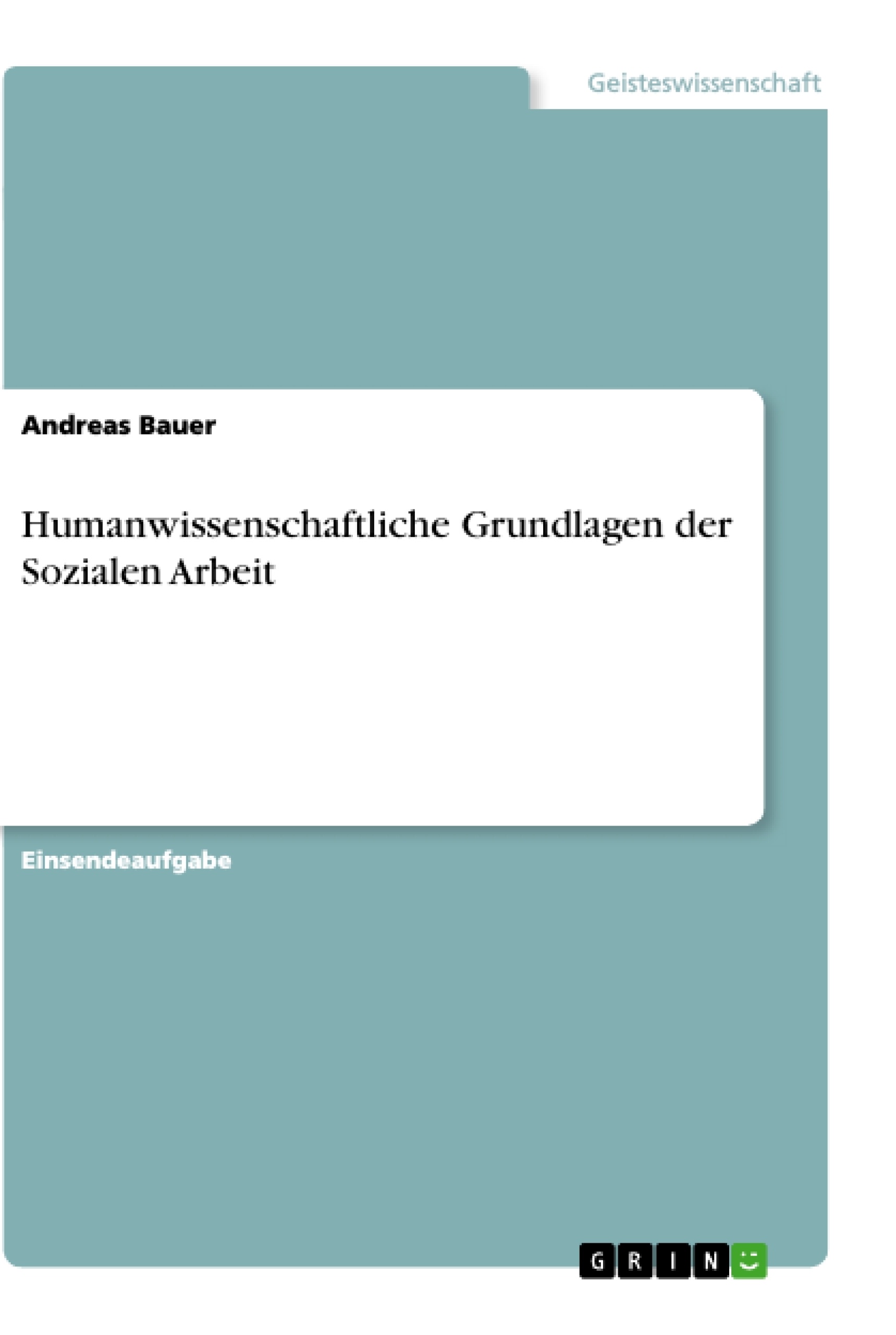Scheinbar selbstverständlich gehen wir im mit dem Begriff "Psychologie" um. Er begegnet uns in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Ein Fußballspieler der einen Elfmeter verschießt, ist der Situation "psychisch" nicht gewachsen, oder ein Lehrer meldet Besorgnis an da sein Schüler über einen längeren Zeitraum "psychisch" auffällig geworden ist. Warum fällt es uns so leicht, Situation oder menschliches Verhalten im alltäglichen Leben "psychologisch" zu bewerten, ohne dass wir uns jemals tiefer mit dieser Wissenschaft beschäftigt haben? Dazu werden im Folgenden die Begriffe der Alltags- und der Wissenschaftspsychologie voneinander abgegrenzt.
Die folgenden Punkte geben einen Überblick über die größten Einflussfaktoren auf die Entwicklungsgeschichte der Pädagogik, von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, da sich in dieser Zeitspanne die grundlegendsten, geschichtlichen Einflüsse ereigneten.
Würden wir Menschen fragen, was sie unter Bildung verstehen oder wie Bildung entsteht, würde ein Großteil vermutlich antworten, dass Bildung durch das "Lernen" in der Schule entsteht. Diese Annahme ist nicht falsch, mit einem Blick in die Literatur zum Thema Lernen stellen wir jedoch fest, dass der Begriff des "Lernens" weitaus umfassender ist als zunächst angenommen. Ziel dieser Ausarbeitung ist, den Begriff des "Lernens" genauer zu erläutern um anschließend den Unterschied zwischen formalem und informalem Lernen an einem Beispiel zu erörtern.
Inhaltsverzeichnis
- Teilaufgabe A1.
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Psychologie im Alltag – ein ständiger Begleiter
- 1.3 Psychologie als Wissenschaft
- 1.4 Abgrenzung Alltags- zu Wissenschaftspsychologie
- 1.5 Empirische Untersuchung eines Alltagsphänomens in der Psychologie am Beispiel des „Bystander-Effekt“
- 1.5.1 Die fünf Phasen des empirischen Forschungsprozesses am Beispiel des,,Bystander-Effekts“
- Teilaufgabe A2.
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Bildung und Erziehung in der Antike
- 2.3 Bildung und Erziehung im Mittelalter
- 2.4 Comenius und Rousseau, zwei große Pädagogen der Neuzeit
- 2.5 Die Bildungsreform des 18. und 19. Jahrhunderts
- Teilaufgabe A3.
- 3.1 Einleitung
- 3.2. Der Begriff des „Lernens“
- 3.3 Unterscheidung zwischen formalen und informalem lernen
- 3.3.1 Formales Lernen
- 3.3.2 Informelles Lernen
- 3.4 Unterscheidung des formalen und informellen Lernprozesses anhand eines Beispiels aus der Sozialen Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Einsendeaufgabe befasst sich mit den humanwissenschaftlichen Grundlagen der Sozialen Arbeit und beleuchtet verschiedene Aspekte der Psychologie, Bildung und Erziehung sowie des Lernens in diesem Kontext. Die Arbeit zielt darauf ab, ein grundlegendes Verständnis dieser Themen zu vermitteln und deren Relevanz für die Soziale Arbeit aufzuzeigen.
- Psychologie im Alltag und als Wissenschaft
- Entwicklung der Bildung und Erziehung in verschiedenen Epochen
- Das Konzept des Lernens und dessen Ausprägungen
- Empirische Forschung in der Psychologie
- Bedeutung von Bildung und Lernen für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die erste Teilaufgabe beschäftigt sich mit der Psychologie und beleuchtet die Bedeutung des Fachs sowohl im Alltag als auch in der Wissenschaft. Im Mittelpunkt steht die Abgrenzung der Alltags- von der Wissenschaftspsychologie. Darüber hinaus wird der „Bystander-Effekt“ als Beispiel für ein Alltagsphänomen in der Psychologie vorgestellt und der empirische Forschungsprozess anhand dieses Themas erläutert.
Die zweite Teilaufgabe widmet sich der Geschichte der Bildung und Erziehung. Es werden die Entwicklungen in der Antike, dem Mittelalter sowie in der Neuzeit mit Fokus auf die Pädagogen Comenius und Rousseau beleuchtet. Die Bildungsreform des 18. und 19. Jahrhunderts rundet diese Betrachtung ab.
In der dritten Teilaufgabe wird der Begriff des Lernens im Zentrum der Betrachtung stehen. Es werden die Unterscheidung zwischen formalem und informalem Lernen sowie die jeweiligen Lernprozesse analysiert. Ein Beispiel aus der Sozialen Arbeit veranschaulicht diese Unterscheidung.
Schlüsselwörter
Humanwissenschaftliche Grundlagen, Soziale Arbeit, Psychologie, Alltags- und Wissenschaftspsychologie, Bystander-Effekt, Empirische Forschung, Bildung, Erziehung, Antike, Mittelalter, Neuzeit, Comenius, Rousseau, Bildungsreform, Lernen, Formales und Informelles Lernen, Lernprozess.
- Quote paper
- Andreas Bauer (Author), 2021, Humanwissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1043498