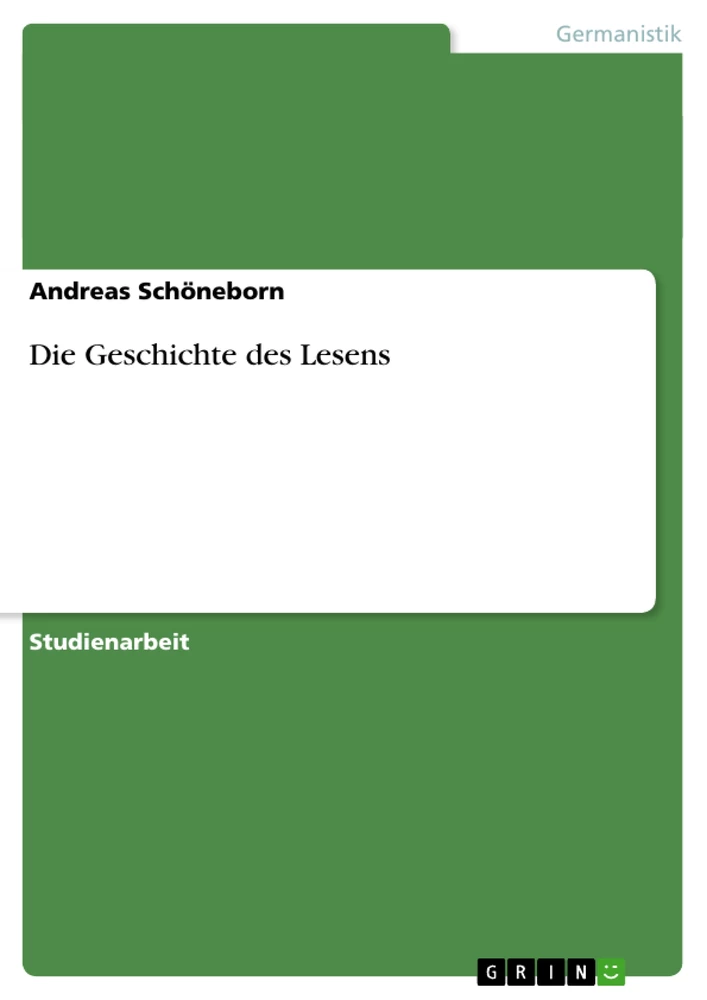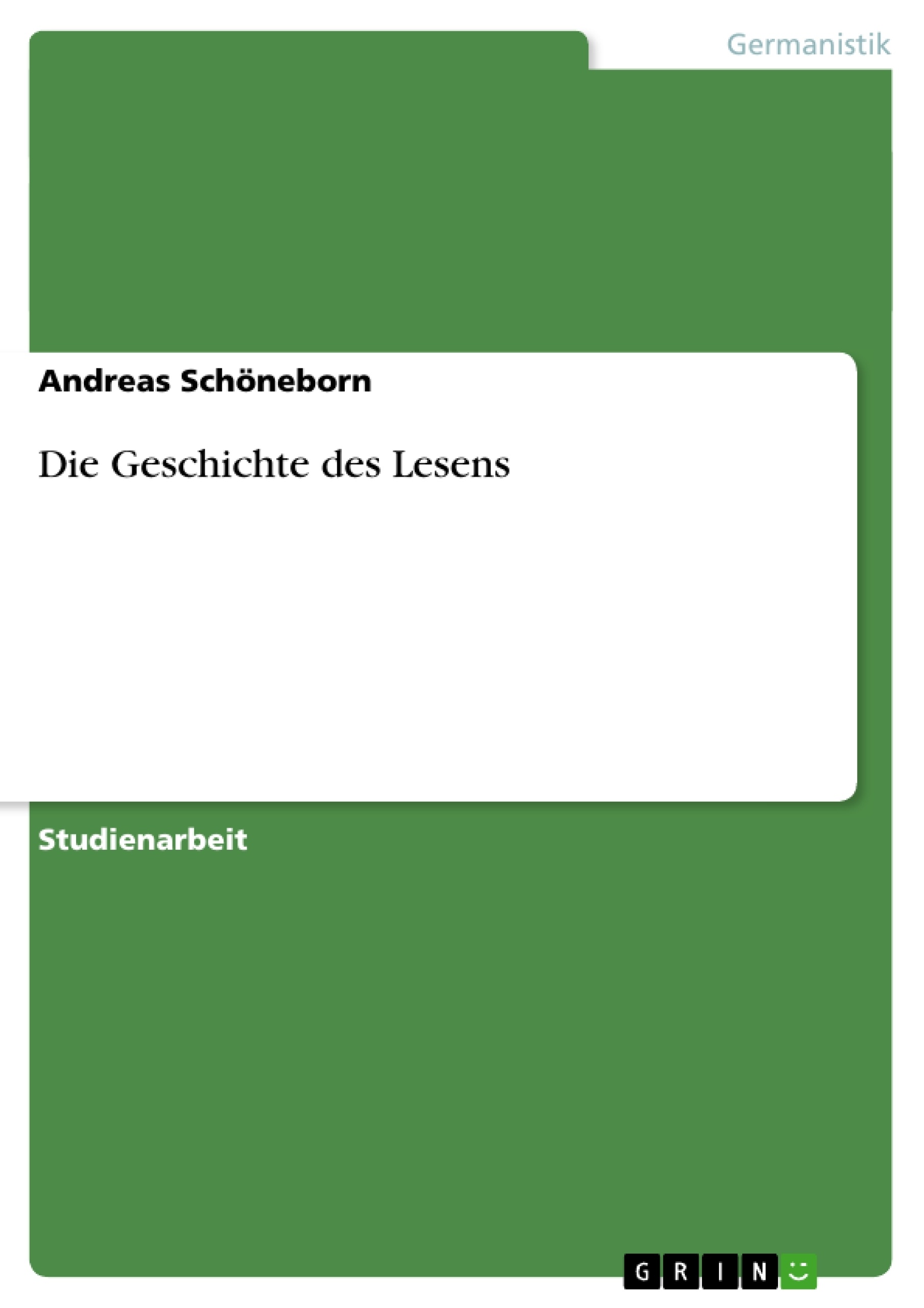Inhalt:
1. Einleitung
2. Die Geschichte des Lesens
2.1. Das gemeinsame Rezipieren
2.2. Der Leser und sein Körper
2.2.1. Beobachtungen an Bildern von Lesenden
2.2.2. Der Körper
2.3. Das Ende des lauten Lesens
3. Kommentar
3. Literatur
1. Einleitung
Das Seminar „Didaktik des Lesens“ beschäftigt sich mit alten und neuen lesedidaktischen Konzepten, Arbeiten zur Geschichte des Lesens und Forschungen zur Lesesozialisation.
Bis zum Zeitpunkt dieses Referates wurden bereits mehrere Themen behandelt. Im Laufe der ersten Sitzung wurden Lesebilder betrachtet.
Die zweite Sitzung stellte an Textauszügen von Hans Robert Jauß, Wolfgang Iser und Bernd Scheffer verschiedene Rezeptionstheorien in den Mittelpunkt der Dis- kussion. Jauß trat dabei vor allem für das Recht des Lesers auf ästhetisch befrei- enden Genuss ein, während Isers Leerstellentheorie besagte, dass der literarische Text erst durch die vom Leser geleistete Konkretisation als Werk vollendet wird. Im Anschluß daran erstellten die Seminarteilnehmer eigene Lesebiographien, die auswertend besprochen wurden.
Die beiden folgenden Sitzungen befassten sich mit Texten von Petra Wieler und Daniel Pennac zum Lesen und zum Vorlesen. Pennacs Kernaussage war dabei, dass das Lesen an sich immer „zweckfrei“ den Kindern vermittelt werden muss, um ihnen die Freude am selbständigen Lesen zu erhalten oder zu vermitteln.
Bei diesem Referat „Die Geschichte des Lesens“ handelt es sich nun um die Fortführung des eben beschriebenen bisherigen Seminarverlaufs.
2. Die Geschichte des Lesens
Gegenstand dieses Referates ist das Buch von Erich Schön „ Der Verlust der Sinnlichkeit oder Die Verwandlung des Lesers “. Erich Schön betrachtet darin den das Lesen betreffenden Mentalitätswandel vom 18. Jahrhundert an bis in das 20. Jahrhundert. Er beschreibt, wie sich die heutige Art zu lesen infolge verschiedener Teilschritte in unterschiedlichen Bereichen (u.a. Lesehaltungen, Leseorte, artikuliertes/nicht artikuliertes Lesen, etc.) entwickelt hat. Diese Bereiche untergliedert Schön in seinem Buch in folgende „Kategorien“:
Der Leser und sein Körper
Das Ende des lauten Lesens Das Lesen im Freien
Das gemeinsame Rezipieren Das einsame Lesen
Die Zeit des Lesens (vgl. Schön, 1987: S.21 f.)
Innerhalb dieser Ausarbeitung beschäftige ich mich nicht mit allen genannten As- pekten, sondern nur mit den Kapiteln „Der Leser und sein Körper“, „Das Ende des lauten Lesens“ und „Das gemeinsame Rezipieren“. Allerdings gibt es in Schöns Arbeit keine klare Abtrennung zwischen den einzelnen Kapiteln; immer wieder werden Querverbindungen deutlich, so dass verschiedene Aspekte mehr- fach genannt oder auch früh auftetende Fragen erst im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden.
Schön äußert sich auch zur „Gültigkeit“ seiner Arbeit, da er bei seinen Recher- chen auf diverse Schwierigkeiten gestoßen ist. Als Informationsquellen stützt sich Schön auf (teilweise wissenschaftliche) schriftliche Dokumente, Bilder und Zeichnungen. Sein größtes Problem war dabei u.a. die Bewertung der Quellen in Bezug auf ihre „Normalität“1. Weiterhin gibt es bei den von ihm beschriebenen Entwicklungen ein weiteres Hindernis, welches eine Beschreibung der Lesestile wohl zulässt, eine allgemeingültige zeitliche Einordnung jedoch nahezu unmöglich macht: die sogenannte Ungleichzeitigkeit2. (vgl. Schön, 1987: S. 26 ff.)
So kann zusammenfassend gesagt werden, dass Schön durch seine Auswahl und Interpretation der verschiedenen Quellen die Leseentwicklung darstellt, wie sie sich zwar sehr wahrscheinlich, aber keinesfalls sicher zugetragen hat.
2.1. Das gemeinsame Rezipieren
Neben dem individuellen Lesen gab es auch eine Vielzahl von Situationen, in denen gemeinsam gelesen wurde. Dabei handelte es sich häufig um Vorlesesitua- tionen, welche heute oftmals mit der damals mangelhaften Lesefähigkeit der Zu- hörenden erklärt wird. Dies war vor allem im 18. Jahrhundert durchaus üblich, wenn in ländlichen Gebieten Pfarrer oder Schulmeister den Bauern vorlasen. Aber es gab auch noch andere Gründe, das Vorlesen und Zuhören weiterleben zu las- sen, auch bei Leuten, die selbst lesen konnten. (vgl. Schön, 1987: S. 177)
So sind zuerst einmal zwei verschiedene Rollen zu nennen, die je nach Autoritätsstrukturen und Leseobjekt verschieden besetzt waren.
Die Tradition des Vorlesens als dienende Rolle reichte von den Vorlesesklaven der Antike bis zu bezahlten Vorlesern im 19. Jahrhundert, welche z.B. in Gasthäusern angestellt waren und den Gästen aus der neuesten Zeitung vorlasen.
Auf der anderen Seite sind Situationen autoritativ bestimmten Vorlesens überlie- fert, eine Art frontales Vorlesen, bei der die vorlesende Person allein durch ihre Tätigkeit Respekt erlangte. Diese Form war vor allem bei Vorlesesituationen in bürgerlichen Familien, aber auch bei den oben schon erwähnten Schulmeisterle- sungen üblich.
Der Gegensatz dieser beiden Rollen schwächt sich ab in Situationen, in denen z.B. der Vater das Vorlesen im Familienkreis an ältere Kinder delegierte. (vgl. Schön, 1987: S. 177 ff.)
Im Laufe der Zeit jedoch begannen sich ebendiese Rollen langsam aufzulösen und es fand ein allmählicher Übergang zu geselligen Rezeptionssituationen statt. Dazu gehörten die Rezeption im Rahmen von Freundeskreisen ebenso wie das Lesen eines Buches zur Familienunterhaltung und gemeinsame Leseerfahrung in Zirkeln und Kränzen. Wichtig war dabei die starke Einschränkung des „belehrenden“ E- lements, welches für die autoritativen Rezeptionssituationen noch charakteristisch war. Ziel der geselligen Rezeptionssituationen war vor allem die Anregung zur Konversation, wobei nicht unbedingt ein Konsens gefunden werden musste. (vgl. Schön, 1987: S. 190 f.)
Diese Lesungen in geselliger Runde sind ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Entwicklung je nach Gesellschaftsschicht in unterschiedlichen Zeiträumen vollzog3. Beim Adel wurden als erstes Bücher im „ausgesuchten Kreis“ rezipiert, dann übernahm das Bürgertum diese „Geselligkeit“; als letztes etablierte sich das gemeinsame Leseerlebnis bei den „niederen“ Schichten.
Trotz dieser beschriebenen Vorlesesituationen wird angenommen, dass das individuelle Lesen der Normalfall war.
2.2. Der Leser und sein Körper
2.2.1. Beobachtungen an Bildern von Lesenden
Anhand zeitgenössischer Zeichnungen lassen sich Veränderungen in den Lesehaltungen beobachten. Charakteristisch ist dabei, dass nicht irgendeine neue Lesehaltung auftrat, sondern ganz bestimmte Veränderungen der vorhergehenden.
15. Jahrhundert:
Die Leserin sitzt, der Tisch befindet sich jedoch in deutlichem Abstand. Sie hält das Buch nur in der rechten Hand, es besteht kein unterstützen- der Körperkontakt. Sie sitzt frei und mit aufrechtem Oberkörper, die lin- ke Hand dient zum Umblättern und als Lesehilfe. Nur der Kopf ist ge- neigt.
17. Jahrhundert:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1 : Oberrheinischer Meister: Das Para- diesgärtlein, um 1410 (in: Schön, 1987: S. 1)
Es existieren mehrere gemalte Varianten von Lesenden, von denen Schön allerdings keine in seinem Buch präsentiert.
a) Der Leser sitzt in einem Sessel mit Armlehnen, auf denen die Unterarme ruhen. Beide Hände halten das Buch.
b) Häufiger: Die Personen sitzen, das Buch ruht auf den Knien. Wegen des dabei entstehenden krummen Rückens sind häufig Fußschemel in Gebrauch.
c) Auch: Das Buch wird mit beiden Händen frei vor dem Körper gehalten (im Sitzen), allenfalls werden die Ellenbogen am Körper abgestützt.
18. Jahrhundert:
a) Statt des Fußschemels wer- den die Knie mit dem Buch darauf auf die Querstrebe zwi- schen den Stuhlbeinen ge- stützt. So wird das Buch dem Gesicht näher in eine höhere Position gebracht.
b) Statt vor dem Tisch zu sit- zen und das Buch frei zu hal- ten, sitzt die Leserin am Tisch, hat das (allerdings sehr große) Buch auf den Knien, während sie ihren Kopf mit dem rech- ten Arm am Tisch stützt.
c) Der Leser sitzt an einem Tisch, sowohl das Buch als auch der Körper werden auf dem Tisch abgestützt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2: J.H.W. Tischbein: Goethe, lesend am Fenster seiner römischen Wohnung (in: Schön, 1987: S.65)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.3: D.N. Chodowiecki: Lesendes Mädchen. Studie zu einem Kupfer von 1778 (in: Schön, 1987: S. 67)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.4: C.D. Friedrich: A.G. Friedrich, lesend, um 1789 (in Schön, 1987: S. 68)
19. Jahrhundert:
a) Der Leser hat die Beine auf die Querstrebe gestützt. Zusätzlich sind die Ellen- bogen auf den Oberschenkeln abgestützt, was das Buch dem Gesicht noch näher bringt.
b) Das Buch liegt frei auf einem Tisch, die Hände stüt- zen entweder beide den Kör- per oder Kopf der lesenden Person oder eine Hand ist frei für eine beiläufige Tätigkeit (Rauchen).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.5: R.Pudlich: Leser mit Zigarette, vor 1940 (in: Schön, 1987: S. 69)
Von der Lesehaltung, bei der man frei saß und beide Hände das Buch umfassten, geht die Entwicklung stufenweise dahin, dass das Buch frei auf einem Tisch oder auf den Knien liegt, während die Hände den Körper stützen oder anderweitig be- schäftigt sind.
Schön filtert aus den ausgewerteten Zeichnungen drei Tendenzen heraus, die auch für das folgende Teilkapitel sehr wichtig sind:
Erstens wird gegen Ende der Entwicklung bis ins 19.Jahrhundert der Kontakt zum Buch nur noch mit dem Auge hergestellt, die Hände sind nicht mehr „erfassend“ beteiligt (VISUALISIERUNG).
Zweitens wird es üblich, das Buch vom „haltenden Körper“ auf ein Möbel zu verlagern. Das Buch bekommt einen „eigenen“ festen Platz (MÖBLIERUNG). Drittens wird der Körper des Lesers durch die eben genannten Punkte unbeweglicher (IMMOBILISIERUNG). (vgl. Schön, 1987: S. 72)
2.2.2. Der Körper
Kritiker der eben aufgeführten Entwicklung beobachteten schon im 18. Jahrhundert, dass die Aktivität des Körpers beim Lesen darauf reduziert wurde, die Zeilen der Texte mit den Augen zu verfolgen (Visualisierung). Der Körper musste sich nicht einmal selbst halten, wenn er sich z.B. an einem Lesetisch befand und reichhaltig Abstützung fand (Möblierung und Immobilisierung).
Die Tendenz, den Körper immer weniger an verschiedenen Rezeptionen teilhaben zu lassen, beginnt für Erich Schön im Theater des 18. Jahrhunderts: hier war es vor allem im bürgerlichen Theater üblich, dass zwar Logenplätze und Plätze für Frauen Sitzplätze waren, im Parterre jedoch und in der Galerie standen die Zu- schauer. Für eben dieses Parterre-Publikum wurde es im Laufe der Zeit üblich, ebenfalls zu sitzen. Als Folge ging die bis dahin übliche Interaktion zwischen
Publikum und Schauspielern (Werfen von Blumen oder faulem Obst, Dazwi- schenreden, Bravo-/Fort-Rufe, Händeklatschen, Füßescharren, Mitagieren und teilweise sogar Handgreiflichkeiten) stark zurück. Bei den üblich werdenden Mischformen aus Hof- und öffentlichem Theater entwickelte sich schließlich das Händeklatschen als Beifallsbekundung aus einer Art Kompromiss zwischen dem „unzivilisierten“ Bürgertheater und dem sehr zurückhaltenden Hoftheater. (vgl. Schön, 1987: S. 83 ff.)
Diese eben erwähnte Zurückhaltung, die Contenance, war Teil eines im 18. Jahr- hundert modern werdenden „Verhaltensideals“4, mit der sich vor allem der Adli- ge vom gemeinen Volk abgrenzen wollte. Diese sogenannten „Lebensregeln“ blieben jedoch nicht spezifisch für den Adel; für das Bürgertum wurden sie eben- falls üblich.
Die Contenance, die der Theaterbesucher wahren sollte, wurde schließlich auch auf rezipierte literarische Objekte übertragen. Dabei bedeutet Contenance die Un- terdrückung des körperlichen Reagierens und der körperlichen Beteiligung, kurz: die Ausgrenzung des Körpers vom Miterleben5. (vgl. Schön, 1987: S. 85 f.)
Überbleibsel, Reflexe oder Spuren des sinnlichen körperlichen Erlebens, welches heute gar nicht mehr als solches realisiert wird, sind von Erich Schön mit dem Begriff der körperlichen Phantasie bedacht worden und nach wie vor latent vor- handen:
Die Gedanke an ein quietschendes Messer erzeugt eine Gänsehaut, der Gedanke an Prüfungen lässt den Blutdruck steigen, der Anblick einer leicht bekleideten Person lässt uns frösteln und sehen wir einen rührenden Film, kommen uns die Tränen.
Körperliche Phantasie zeigt sich demnach darin, dass eine geistige Vorstellung eine körperliche Bewegung nach sich zieht; es funktioniert allerdings auch umge- kehrt. Diese körperlichen Reaktionen auf das Erleben symbolischer Gebilde sind uns heute -zumindest im Bewusstsein des sozialen Beobachtetwerdens- meistens peinlich. (vgl. Schön, 1987: S. 87)
Das Ausleben der körperlichen Phantasie ist an eine gewisse Freiheit des Körpers gebunden. Durch die Tendenz zur Visualisierung und Immobilisierung bei der Rezeption wurde schließlich eine Herrschaft über den Körper erreicht, die es erlaubte, ganz von ihm abzusehen. Wer die Phantasien des Körpers unter Kontrolle bringt, „befreit seinen Geist zu einer Teilnahme in nur mentaler Phantasie an symbolischen Gegenständen, wo Körperlichkeit ihm den Zugang erschweren , ja verhindern würde.“ (Schön, 1987: S. 90)
Eben diese mentale Phantasie erreichte bei den Lesern Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts langsam ein Übergewicht gegenüber der sinnlich-körperlichen Phantasie.
Das Ende dieser Entwicklung besteht darin, dass der Körper stillgelegt wird, damit der Geist frei wird für die Erfahrung von „Ideenparadiesen“(vgl. Schön, 1987: S.90). Die Beweglichkeit des Geistes wird damit bezahlt, dass der Körper vom Erleben ausgeschlossen wird.
2.3. Das Ende des lauten Lesens
Von der Antike bis in das Mittelalter war es selbstverständlich, dass man, wenn man vom Lesen sprach, das laute Lesen meinte. Stilles Lesen war dabei nicht un- möglich, auf jeden Fall aber eine Ausnahme. In einer Lesepropädeutik von Sac- chini 1614 hieß es:
Man müsse die Dichter laut und gleichsam singend lesen; lautes Lesen ermuntere die Seele des Lesers und bringe leichter die nämlichen Empfindungen hervor, die im Gedicht herrschten; das Lautlesen stärke sowohl die Stimme als auch den Körper; wenn man richtig und laut läse, würde die Art der Erzählung, der Klage, der Anklage, etc, sichtbarer und stärker6. (vgl. Schön, 1987: S. 99 f.)
Im 17. und 18.Jahrhundert geriet das laute Lesen in die Diskussion, aber es ist bis heute nicht klar zu sagen, wann diese Gewohnheit endete. Das laute Lesen war zu dieser Zeit noch nicht wirklich ungewöhnlich, jedenfalls bei Werken der Dicht- kunst. Dabei ist bei Schauspielen allerdings zwischen Versen (laut) und Prosa (leise) zu unterscheiden. Romane wurden wohl schon immer leise gelesen. Ebenso wurde Lyrik selbstverständlich weiter laut gelesen.
Der Lesepropädeutiker Bergk sagte zum lauten Lesen noch 1799:
Lautes Lesen ersetze einen Spaziergang - die Anstrengung verhüte „das Stocken der Säfte“ und verscheuche so Krankheiten und Missvergnügen; es verbessere ebenfalls fehlerhafte Sprachorgane; schwierig sei die Lektüre von Schauspielen, da man hier immer alle Töne seines Geistes anschlagen müsse7 und dabei nicht die Kontrolle über seinen Körper ver- lieren dürfe. (vgl. Schön, 1987: S. 101)
Durch die Contenance kam das intensive Erleben von Affekten abhanden. Dieser Umstand wurde durchaus bemerkt und mehrfach beklagt:
C.M. Wieland meint:„...alle Dichter und überhaupt alle Schriftsteller von Talent und Geschmack müssen laut gelesen werden, wenn nicht die Hälfte ihrer Schön- heiten für den Leser verloren gehen sollen.“ (Schön, 1987: S.104) Adam Müller behauptete 1812: „... wenn sich nicht das Theater einzelner Werke erbarmte, so hätten wir die ganz eigene Erscheinung der Literatur, ...deren Werke kaum ein einziges Mal von einer menschlichen Brust in den angemessenen, arti- kulierten Tönen wirklich ausgesprochen worden wären.“ (in: Schön, 1987: S.104) Auch Goethe wird zitiert: „Und gewiß schwarz auf weiß sollte durchaus verbannt seyn; das Epische sollte rezitirt, das Lyrische gesungen und getanzt und das Dra- matische persönlich mimisch vorgetragen werden.“ (in: Schön, 1987: S.105) Trotz dieser Unmutsbekundungen zum leisen Lesen muss im Auge behalten wer- den, dass dieses Zeitalter von etwa 1730 -18008 unter dem Einfluss der Kant- Maxime stand, „’jederzeit selbst zu denken’“ (Schön, 1987: S.113). Bergk sagte 1799 dazu, dass das „’Bestreben beim Lesen (...) stets dahin gehen (muss), uns über den Stof zu erheben, um ihn beherrschen zu können.’“ (Bergk „Die Kunst, Bücher zu löesen“, 1799, S.63 zitiert in: Schön, 1987: S. 113) Dort, wo eben diese Beherrschung beim Leiselesen nicht gelang, wurden nahezu kathartische Körperäußerungen beobachtet: der Erregungsstau des zunächst leisen Lesens wurde dabei nicht ertragen, der Leser verfiel ins Lautlesen oder er sprang auf. (vgl. Schön, 1987: S. 116 f.)
Am Ende dieser Entwicklung wird erregende Überwältigung durch die Texte weitgehend unterdrückt. An ihre Stelle tritt die Fähigkeit, literarisch vermittelte affektive Zustände empathisch zu übernehmen, sie aber so zu beherrschen, dass sie auf den geschlossenen Gültigkeitsbereich literarischer Erfahrung beschränkt und jederzeit wieder abgelegt werden können. (vgl. Schön, 1987: S. 121 f.)
3. Kommentar
Schon an der Betrachtung dieser gewählten Kapitel aus Erich Schöns Buch lässt sich erahnen, dass die für uns heute selbstverständlichen Lesegewohnheiten in dieser Form im 18. bis 20. Jahrhundert noch nicht existiert haben. Das Buch zeigt in vielen kleinen Schritten auf, dass das Lesen permanenten Veränderungen unter- liegt. Meiner Meinung nach wird auch die momentane Form unserer Lesege- wohnheiten nicht bis in alle Ewigkeit Bestand haben. Allein schon durch die Ent- wicklung dahin, ganze Büchersammlungen als Bildschirmtexte auf CD-ROM zu bannen, zieht fast zwangsläufig die Entwicklung anderer Lesarten nach sich.
In jedem Fall wird durch Erich Schöns Arbeit das Potential deutlich, welches in literarischen Texten vorhanden sein muss. Die Beschreibung großer ungehemmter Emotionen beim Lesen kommt uns befremdlich vor, weil wir heutzutage nicht mehr die Fähigkeit haben, dieses erwähnte Potential erschöpfend zu erschließen. Für die Didaktik des Lesens ließe sich in diesem Fall immerhin die Möglichkeit ableiten, Kindern über andere, ihnen bislang unbekannte Formen der Rezeption - wie in Schöns Buch beschrieben- das intensive „Erleben“ von Texten zu ermögli- chen bzw. nahe zu bringen. Gerade über eine stärkere emotionale Einbindung in Texte müsste es möglich sein, in Kindern die Begeisterung für das Lesen zu we- cken. Voraussetzung dafür ist dann natürlich, sich im Vorfeld selbst mit diesen „Rezeptionserlebnissen“ auseinander zu setzen, um diese auch adäquat vermitteln zu können.
4. Literatur
Schön, Erich : „Der Verlust der Sinnlichkeit oder Die Verwandlung des Lesers - Mentalitätswandel um 1800“
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 1987
[...]
1 Meistens wurden die Dinge aufgezeichnet, die eher ungewöhnlich waren. Es lässt sich jedoch schwierig vom Ungewöhnlichen auf das Gewöhnliche schließen.
2 Das Auftreten unterschiedlicher Lesarten war oft abhängig von der Gesellschaftsschicht: In A- delskreisen entwickelten sich Lesegewohnheiten anscheinend zuerst, erst später wurden sie dann vom Bürgertum und noch später von den untersten Gesellschaftsschichten übernommen.
3 Siehe Kapitel 2
4 Dazu zählte neben der Contenance auch, dass auf der Straße nicht gelaufen wurde und dass man Gepäck nicht (oder zumindest nicht selbst) trug. (vgl. Schön, 1987: S. 86)
5 Unterdrückt wurden dabei nicht nur impulsive Reaktionen wie schon genannt: es wurde sich bemüht, selbst Spuren von Betroffenheit o.ä. zu verbergen
6 Die moderne empirische Psychologie sagt zu diesem Punkt, dass der motorische Ausdruck eines Gefühls dieses Gefühl selbst verstärkt oder überhaupt erst erzeugt.
7 um sich in jede Stimmungslage jedes Charakters hineinversetzen zu können
Häufig gestellte Fragen zu "Die Geschichte des Lesens"
Worum geht es in dem Seminar „Didaktik des Lesens“?
Das Seminar beschäftigt sich mit alten und neuen lesedidaktischen Konzepten, Arbeiten zur Geschichte des Lesens und Forschungen zur Lesesozialisation.
Welche Themen wurden bereits im Seminar behandelt?
Lesebilder, Rezeptionstheorien von Hans Robert Jauß, Wolfgang Iser und Bernd Scheffer, eigene Lesebiographien der Seminarteilnehmer, sowie Texte von Petra Wieler und Daniel Pennac zum Lesen und zum Vorlesen.
Was ist das Kernaussage von Daniel Pennac zum Lesen?
Das Lesen an sich muss immer „zweckfrei“ den Kindern vermittelt werden, um ihnen die Freude am selbständigen Lesen zu erhalten oder zu vermitteln.
Was ist Gegenstand des Referates „Die Geschichte des Lesens“?
Das Buch von Erich Schön „Der Verlust der Sinnlichkeit oder Die Verwandlung des Lesers“. Schön betrachtet darin den Mentalitätswandel bezüglich des Lesens vom 18. Jahrhundert an bis in das 20. Jahrhundert.
Welche "Kategorien" untergliedert Erich Schön in seinem Buch?
Der Leser und sein Körper, Das Ende des lauten Lesens, Das Lesen im Freien, Das gemeinsame Rezipieren, Das einsame Lesen, Die Zeit des Lesens.
Mit welchen Aspekten beschäftigt sich diese Ausarbeitung konkret?
Die Kapitel „Der Leser und sein Körper“, „Das Ende des lauten Lesens“ und „Das gemeinsame Rezipieren“.
Welche Schwierigkeiten traten bei Schöns Recherchen auf?
Bewertung der Quellen in Bezug auf ihre „Normalität“ und die sogenannte Ungleichzeitigkeit.
Was wird unter "gemeinsamen Rezipieren" verstanden?
Vorlesesituationen, die entweder von Personen in dienender Rolle oder von Personen in autoritativer Rolle durchgeführt wurden. Später Übergang zu geselligen Rezeptionssituationen, bei denen die Anregung zur Konversation im Vordergrund stand.
Was wird unter "Der Leser und sein Körper" beschrieben?
Anhand von Zeichnungen werden Veränderungen in den Lesehaltungen im Laufe der Zeit dargestellt. Die Entwicklung geht von einer Lesehaltung, bei der man frei saß und beide Hände das Buch umfassten, stufenweise dahin, dass das Buch frei auf einem Tisch oder auf den Knien liegt, während die Hände den Körper stützen oder anderweitig beschäftigt sind. Schön filtert drei Tendenzen heraus: Visualisierung, Möblierung und Immobilisierung.
Was wird unter "Das Ende des lauten Lesens" beschrieben?
Von der Antike bis in das Mittelalter war lautes Lesen selbstverständlich. Im 17. und 18. Jahrhundert geriet das laute Lesen in die Diskussion. Durch die Contenance kam das intensive Erleben von Affekten abhanden.
Was bedeutet der Begriff "körperliche Phantasie" nach Erich Schön?
Überbleibsel, Reflexe oder Spuren des sinnlichen körperlichen Erlebens, welches heute gar nicht mehr als solches realisiert wird. Eine geistige Vorstellung zieht eine körperliche Bewegung nach sich, oder umgekehrt.
Was bedeutet Contenance?
Die Unterdrückung des körperlichen Reagierens und der körperlichen Beteiligung, kurz: die Ausgrenzung des Körpers vom Miterleben.
Was ist die Kant-Maxime?
„’jederzeit selbst zu denken’“
Wie lautet die Schlussfolgerung des Referates?
Die heute selbstverständlichen Lesegewohnheiten existierten im 18. bis 20. Jahrhundert noch nicht in dieser Form und unterliegen permanenten Veränderungen.
- Quote paper
- Andreas Schöneborn (Author), 2000, Die Geschichte des Lesens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104348