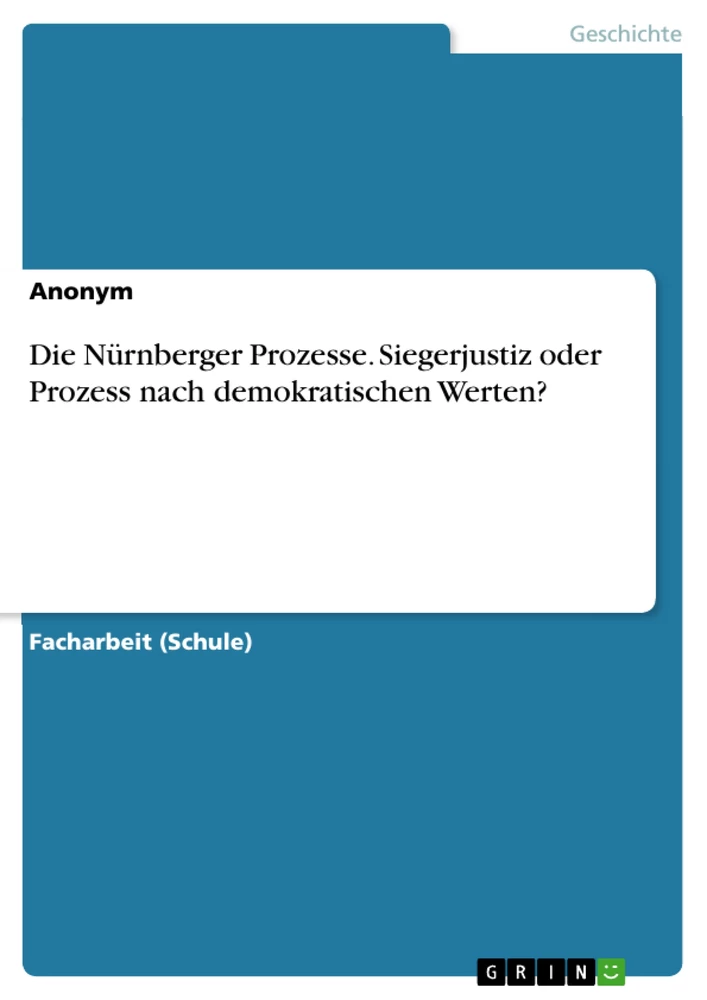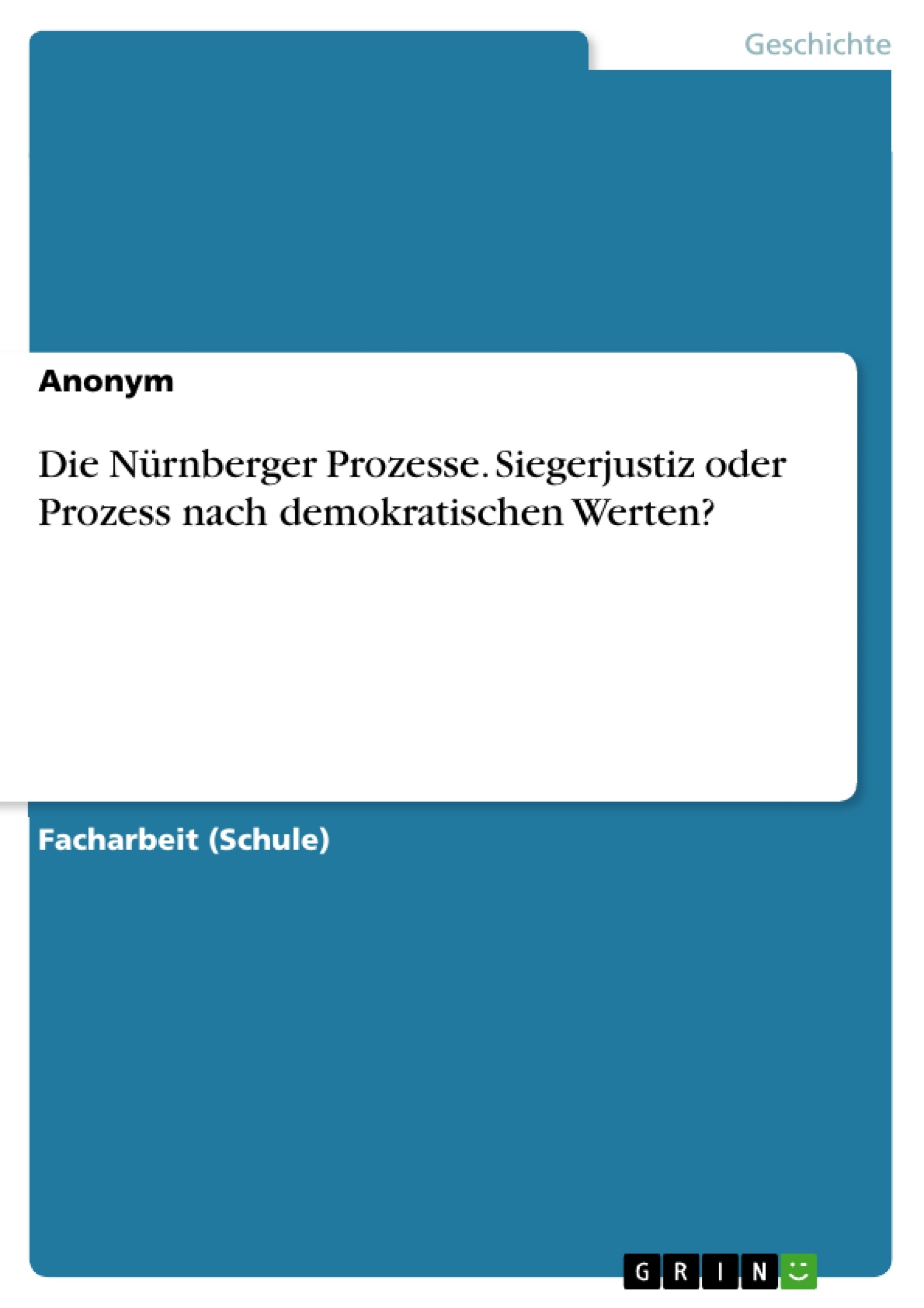Diese Facharbeit befasst sich auf zwölf Seiten mit der Frage, ob es sich bei den Nürnberger Prozessen um eine Form der Siegerjustiz handelte. Hierzu werden die Prozesse zunächst faktisch dargestellt und in den historischen Kontext eingeordnet. Anschließend werden zwei Angeklagte, Karl Dönitz und Hermann Göring, vorgestellt und ihr Prozess sowie ihr jeweiliges Urteil miteinander verglichen, wodurch eine Beurteilung der Fragestellung ermöglicht wird.
Am 20. November 1945 um 10.03 Uhr begann im Schwurgerichtssaal in Nürnberg der Prozess gegen 24 Angeklagte, welche als Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs bezeichnet wurden und den Führungsstab des nationalsozialistischen Deutschlands gebildet hatten. Die vier vorgelesenen Anklagepunkte lauteten Verschwörung gegen den Weltfrieden, Planung und Vollstreckung eines Angriffskrieges, Durchführen von einer Vielzahl an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die französische und sowjetische Anklage sah die Todesstrafe für alle Angeklagten vor, England forderte individuelle Strafen, die amerikanischen Ankläger gaben keine klare Empfehlung ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Nürnberger Prozesse
- Faktische Darstellung
- Historische Einordnung
- Kritik an den Prozessen
- Fallbeispiele
- Hermann Göring
- Politischer Aufstieg in der NSDAP
- Rolle in der NSDAP zur Zeit des Zweiten Weltkrieges
- Die Anklage und der Prozess
- Das Urteil
- Karl Dönitz
- Militärischer Aufstieg
- Rolle im Zweiten Weltkrieg
- Die Anklage und der Prozess
- Das Urteil
- Hermann Göring
- Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Nürnberger Prozesse und die Frage, ob diese als Siegerjustiz zu betrachten sind oder ob sie einem rechtsstaatlichen Verfahren entsprachen. Es wird geprüft, ob die Alliierten neutral urteilten oder ob Rachemotive im Vordergrund standen.
- Faktische Darstellung der Nürnberger Prozesse
- Einordnung der Prozesse in den historischen Kontext
- Analyse der Kritik an den Prozessen
- Fallstudien zu Hermann Göring und Karl Dönitz
- Vergleich der Urteile und Bewertung der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Nürnberger Prozesse ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Gerechtigkeit des Verfahrens. Der persönliche Hintergrund des Autors zur Auseinandersetzung mit dem Thema wird ebenfalls genannt.
Die Nürnberger Prozesse - Faktische Darstellung: Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf der Nürnberger Prozesse, beginnend mit dem Prozessbeginn am 20. November 1945. Es werden die Anklagepunkte, die beteiligten Mächte und die unterschiedlichen Strafforderungen erläutert. Die Herausforderungen bei der Beweisführung und der Rechtsgrundlage werden detailliert dargestellt. Die Rolle der Dokumente als Hauptbeweismittel und die Schwierigkeiten bei der Etablierung einer rechtlichen Grundlage werden hervorgehoben. Die unterschiedlichen Reaktionen der Angeklagten auf die Anklage und der Prozessverlauf selbst werden ebenfalls erörtert. Schließlich wird die Urteilsfindung mit der Vollstreckung der Todesurteile abgeschlossen.
Die Nürnberger Prozesse - Historische Einordnung: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Kontext der Nürnberger Prozesse. Es beginnt mit Hitlers Machtergreifung und der darauf folgenden Aufrüstung und der Propagandamaschinerie des NS-Regimes. Der Weg zum Zweiten Weltkrieg wird durch den Anschluss Österreichs, die Sudetenkrise und den Überfall auf Polen nachgezeichnet. Die militärischen Erfolge der Wehrmacht zu Beginn des Krieges und die spätere Wende mit der Schlacht um Stalingrad und dem Übergang in die Defensive werden geschildert. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung der zunehmenden Brutalität und Verbrechen des NS-Regimes.
Fallbeispiele - Hermann Göring: Diese Sektion beschreibt den politischen Aufstieg Hermann Görings in der NSDAP und seine Rolle im NS-Regime während des Zweiten Weltkrieges. Der Prozess gegen Göring, die Anklagepunkte und das Urteil werden detailliert dargestellt. Der Fokus liegt hier auf der Darstellung von Görings Verantwortung für die Verbrechen des NS-Regimes.
Fallbeispiele - Karl Dönitz: Ähnlich wie bei Göring wird hier der militärische Aufstieg Karl Dönitz und seine Rolle im Zweiten Weltkrieg behandelt. Die Darstellung umfasst seine Beteiligung an der Kriegsführung und der nachfolgende Prozess mit den Anklagepunkten und dem Urteil. Der Fokus liegt auf der Beleuchtung seiner Rolle und Verantwortung innerhalb des NS-Regimes.
Schlüsselwörter
Nürnberger Prozesse, Siegerjustiz, Völkerrecht, Hauptkriegsverbrecher, Zweiter Weltkrieg, NS-Regime, Hermann Göring, Karl Dönitz, Rechtsstaatlichkeit, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Nürnberger Prozesse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Nürnberger Prozesse und die Frage, ob diese als Siegerjustiz zu betrachten sind oder ob sie einem rechtsstaatlichen Verfahren entsprachen. Es wird geprüft, ob die Alliierten neutral urteilten oder ob Rachemotive im Vordergrund standen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die faktische Darstellung der Nürnberger Prozesse, deren Einordnung in den historischen Kontext, die Analyse der Kritik an den Prozessen, Fallstudien zu Hermann Göring und Karl Dönitz sowie einen Vergleich der Urteile und eine Bewertung der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Nürnberger Prozesse (faktische Darstellung und historische Einordnung), Fallbeispiele zu Hermann Göring und Karl Dönitz, einen Vergleich der Fälle und ein Fazit. Jedes Kapitel enthält detaillierte Informationen zu den jeweiligen Aspekten.
Wie werden die Nürnberger Prozesse faktisch dargestellt?
Das Kapitel zur faktischen Darstellung beschreibt den Ablauf der Prozesse, beginnend mit dem Prozessbeginn am 20. November 1945. Es werden die Anklagepunkte, beteiligten Mächte, Strafforderungen, Herausforderungen bei der Beweisführung, die Rechtsgrundlage, die Rolle der Dokumente als Beweismittel und die Reaktionen der Angeklagten erläutert. Die Urteilsfindung und die Vollstreckung der Todesurteile werden ebenfalls behandelt.
Wie werden die Nürnberger Prozesse historisch eingeordnet?
Die historische Einordnung beginnt mit Hitlers Machtergreifung, der Aufrüstung, der NS-Propaganda, dem Weg zum Zweiten Weltkrieg (Anschluss Österreichs, Sudetenkrise, Überfall auf Polen), den militärischen Erfolgen der Wehrmacht und dem späteren Übergang in die Defensive. Die zunehmende Brutalität und die Verbrechen des NS-Regimes stehen im Fokus.
Was wird in den Fallbeispielen zu Göring und Dönitz dargestellt?
Die Fallbeispiele beschreiben den politischen (Göring) bzw. militärischen (Dönitz) Aufstieg der beiden Männer in der NSDAP bzw. der Wehrmacht, ihre Rollen im NS-Regime während des Zweiten Weltkriegs, die Prozesse gegen sie, die Anklagepunkte und die Urteile. Der Fokus liegt auf der Darstellung ihrer Verantwortung für die Verbrechen des NS-Regimes.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Nürnberger Prozesse, Siegerjustiz, Völkerrecht, Hauptkriegsverbrecher, Zweiter Weltkrieg, NS-Regime, Hermann Göring, Karl Dönitz, Rechtsstaatlichkeit, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Waren die Nürnberger Prozesse gerecht, oder handelte es sich um Siegerjustiz?
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Die Nürnberger Prozesse. Siegerjustiz oder Prozess nach demokratischen Werten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1043185