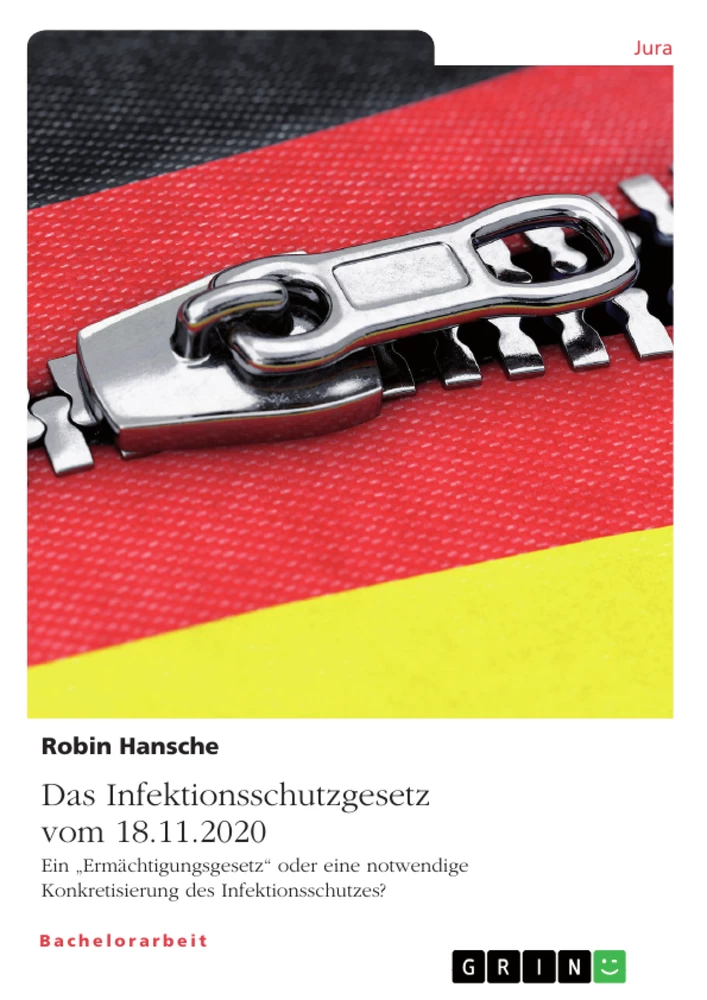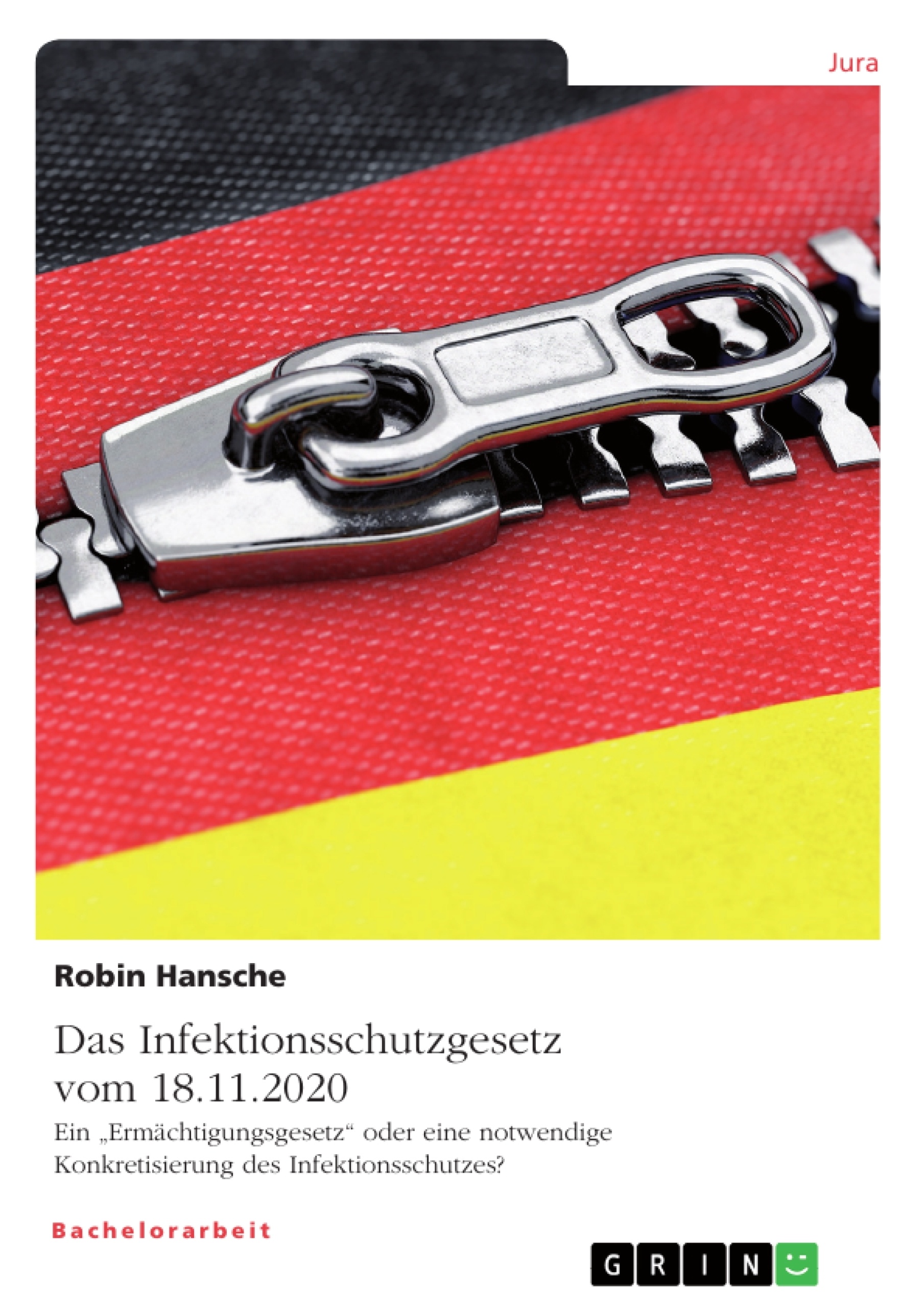Ende 2019 gab es erste Meldungen über eine neuartige Lungenerkrankung, welche sich in China ausbreitete. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, was diese neue Erkrankung für weitreichende Folgen haben und wie sehr sie die Menschheit spalten würde. Diese sich zu einer weltweiten Pandemie ausbreitende Krankheit führte zu Änderungen der infektionsschutzrechtlichen Gesetze. Insbesondere einer dieser Änderungen wurden schwerwiegende Vorwürfe entgegengebracht, nämlich die des Vergleichs des Infektionsschutzgesetzes vom 18.11.2020 mit dem Ermächtigungsgesetz vom 24.03.1933.
Ein solcher Vergleich wiegt insbesondere aufgrund der historischen Bedeutung schwer, denn das Ermächtigungsgesetz brachte Adolf Hitler an die Macht und errichtete ein absolutistisches Regime, in welchem er als Diktator allein regierte. Wenn nun heute der Vergleich eines Gesetzes mit dem Ermächtigungsgesetz angestellt wird, bedeutet dies zeitgleich, dass ein Vergleich mit der Machtergreifung Hitlers gezogen wird. Dies sind unser demokratisches Grundverständnis schwer erschütternde Vorwürfe, welche aufgrund der Tragweite der resultierenden Folgen, sollten diese zutreffen, einer genaueren Betrachtung bedürfen.
Diese Arbeit soll diesen Vergleich aufgreifen, ihn juristisch analysieren und bzgl. seiner Umsetzbarkeit überprüfen. Dabei werden die Lage, welche zu dieser Gesetzesänderung geführt hat und die Vorwürfe, welche dieser entgegengebracht werden, dargestellt. Die weitreichende Bedeutung eines solchen Vergleiches soll unter Darstellung der historischen Fakten belegt werden. Der Schwerpunkt dieser Arbeit beruht auf der Möglichkeit, dass das Infektionsschutzgesetz als Weg zu einem absolutistischen Regime genutzt werden könnte, wobei die einzelnen Optionen aufgezeigt, analysiert und deren Durchführbarkeit betrachtet werden. Abschließen wird diese Arbeit mit der Frage, ob diese Änderungen zur Konkretisierung des Infektionsschutzes notwendig waren und ob dies damit erreicht wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Jahr 2020 – Im Zeichen von „Corona“
- Die Ausbreitung des Virus
- Schutzmaßnahmen
- Kritische Stimmen
- Ermächtigungsgesetze in der Weimarer Republik
- Der Begriff des Ermächtigungsgesetzes
- Die Ermächtigungsgesetze vor 1933
- Besonderheiten des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich
- Bedeutung der Verwendung des Begriffs „Ermächtigungsgesetz“
- Zwischeneinschätzung
- Das Infektionsschutzgesetz als Weg zum Absolutismus
- Die grundsätzliche Möglichkeit der Grundrechtseinschränkung
- Gesetzesvorbehalt
- Parlamentsvorbehalt
- Verhältnismäßigkeit
- Verbot des einschränkenden Einzelfallgesetzes
- Zitiergebot
- Wesensgehaltsgarantie
- Bestimmtheitsgebot
- Anwendbarkeit des IfSG auf die Corona-Pandemie
- Grundrechtseinschränkungen im Infektionsschutzgesetz
- Grundrechtseinschränkungen durch Rechtsverordnungen
- Erlass von Rechtsverordnungen ohne Zustimmung des Bundesrates
- Erlass von Rechtsverordnungen durch die Landesregierungen
- Absolutismus durch Verfassungsänderung
- Die demokratische Grundordnung
- Schutzmechanismen des Grundgesetzes
- Zwischeneinschätzung
- Die grundsätzliche Möglichkeit der Grundrechtseinschränkung
- Die Notwendigkeit der Konkretisierung des Infektionsschutzes
- Der Parlamentsvorbehalt im IfSG
- Zitiergebot
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Parallelen zwischen dem Infektionsschutzgesetz und dem Ermächtigungsgesetz der Weimarer Republik. Ziel ist es, zu analysieren, ob das Infektionsschutzgesetz im Kontext der Corona-Pandemie eine ähnliche Gefahr für die Demokratie birgt wie das Ermächtigungsgesetz für die Weimarer Republik. Hierzu werden die historischen und rechtlichen Hintergründe der Ermächtigungsgesetze beleuchtet und die Voraussetzungen für Grundrechtseinschränkungen im deutschen Rechtssystem beleuchtet.
- Vergleich des Infektionsschutzgesetzes mit dem Ermächtigungsgesetz der Weimarer Republik
- Grundrechteinschränkungen im Kontext der Corona-Pandemie
- Schutzmechanismen des Grundgesetzes
- Die Bedeutung des Parlamentsvorbehalts und des Zitiergebots
- Die Rolle der Gewaltenteilung im Infektionsschutzrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen für die deutsche Gesellschaft dar. Sie führt in die Thematik der Grundrechtseinschränkungen im Infektionsschutzgesetz ein und skizziert die Zielsetzung der Arbeit.
Kapitel 2 beleuchtet die Ausbreitung des Virus und die ergriffenen Schutzmaßnahmen in Deutschland. Es zeigt auf, wie die Einschränkungen von Grundrechten durch die Corona-Pandemie notwendig wurden.
Kapitel 3 setzt sich mit der Kritik am Infektionsschutzgesetz und den daraus resultierenden Debatten auseinander.
Kapitel 4 bietet einen historischen Kontext und beleuchtet die Ermächtigungsgesetze der Weimarer Republik. Es analysiert die Besonderheiten des „Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich“ und seine Bedeutung für die Machtergreifung der Nationalsozialisten.
Kapitel 5 untersucht die rechtlichen Grundlagen für Grundrechtseinschränkungen und die Anwendbarkeit des Infektionsschutzgesetzes auf die Corona-Pandemie. Es beleuchtet die verschiedenen Schutzmechanismen des Grundgesetzes und analysiert die Gewaltenteilung im Kontext des Infektionsschutzrechts.
Kapitel 6 befasst sich mit der Notwendigkeit der Konkretisierung des Infektionsschutzes und analysiert die Bedeutung des Parlamentsvorbehalts und des Zitiergebots.
Schlüsselwörter
Infektionsschutzgesetz, Ermächtigungsgesetz, Weimarer Republik, Grundrechte, Corona-Pandemie, Grundrechtseinschränkungen, Parlamentsvorbehalt, Zitiergebot, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Schutzmechanismen des Grundgesetzes
- Quote paper
- Robin Hansche (Author), 2021, Das Infektionsschutzgesetz vom 18.11.2020. Ein „Ermächtigungsgesetz“ oder eine notwendige Konkretisierung des Infektionsschutzes?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1042631