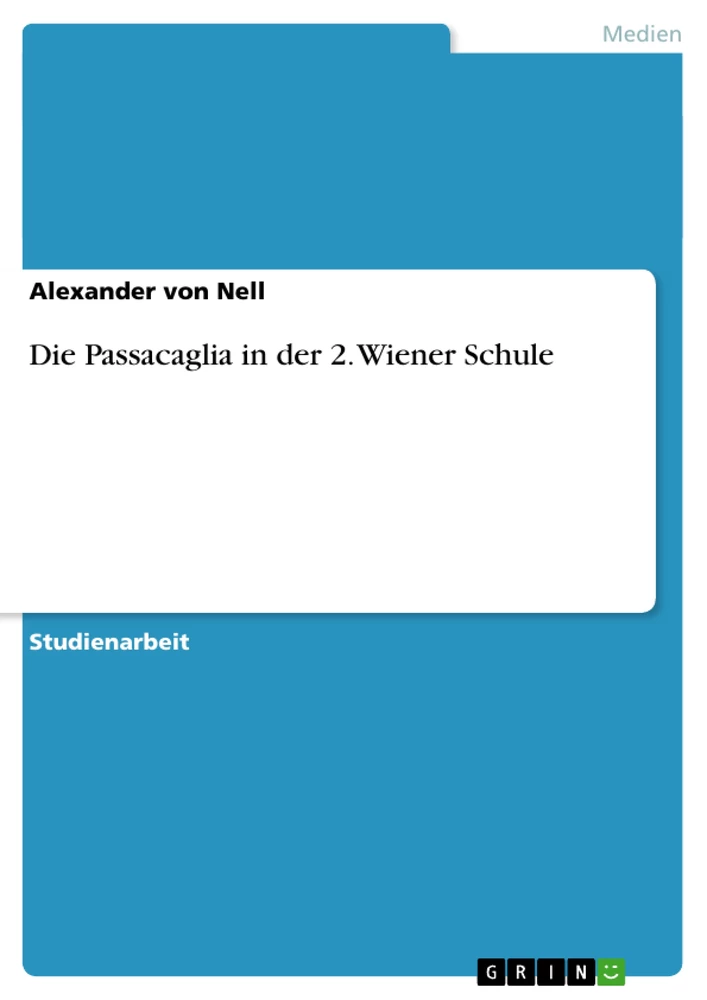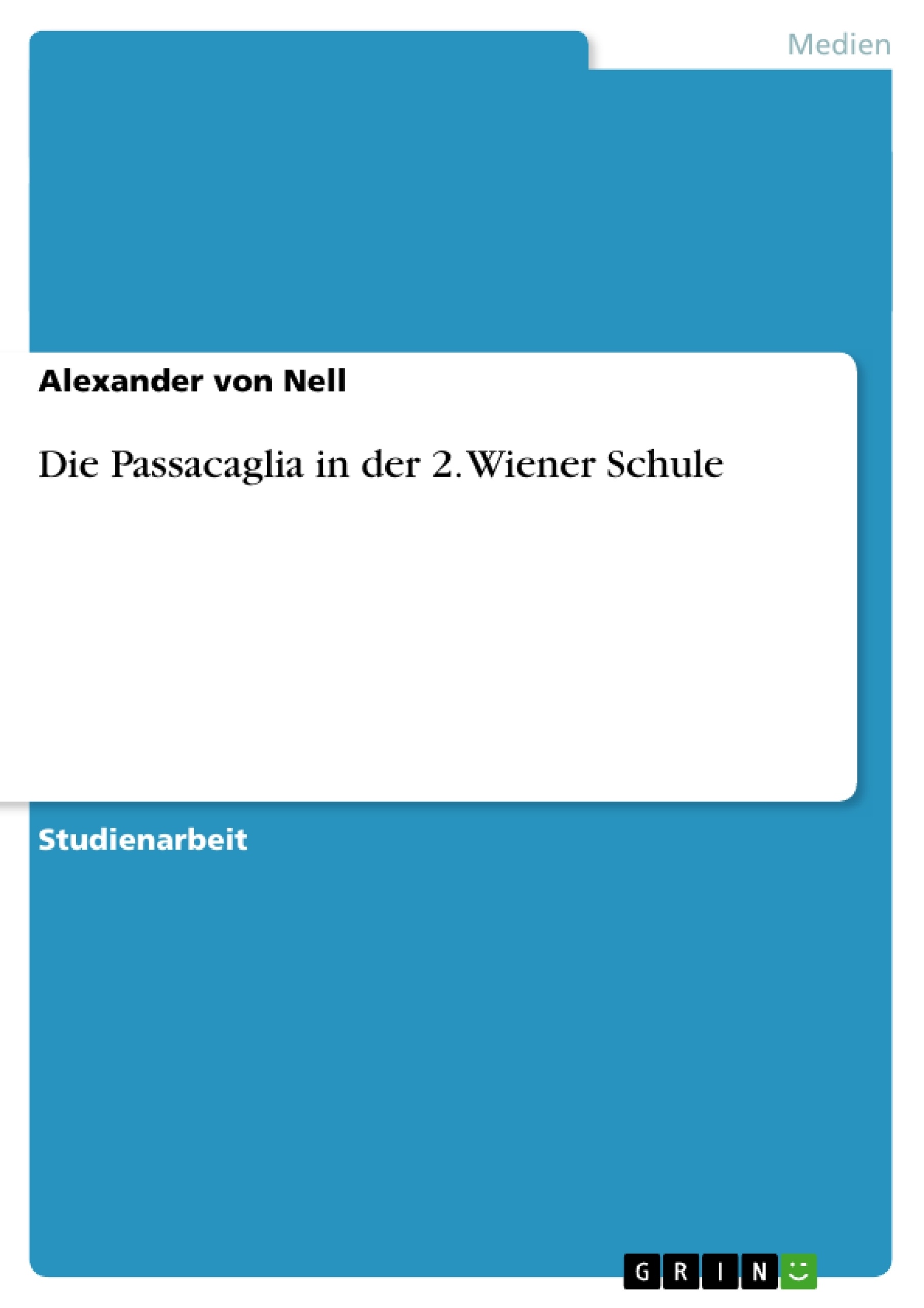Was, wenn die vermeintliche Revolution in der Musik des frühen 20. Jahrhunderts in Wirklichkeit eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Tradition war? Diese Frage steht im Zentrum einer faszinierenden Analyse der Werke der zweiten Wiener Schule – Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern. Entdecken Sie, wie diese Komponisten, oft als radikale Neuerer dargestellt, in ihren Kompositionen auf historische Formen wie die Passacaglia zurückgriffen, um ihren eigenen musikalischen Ausdruck zu finden. Anhand detaillierter Untersuchungen von Weberns Passacaglia für Orchester op. 1, Schönbergs "Nacht" aus Pierrot lunaire und Bergs Wozzeck-Szene wird enthüllt, wie diese Werke nicht nur als Experimentierfeld für neue Klangwelten dienten, sondern auch als Brücke zu einer reichen musikalischen Vergangenheit. Die Analyse beleuchtet die Bedeutung von Zahlensymbolik, die Rolle der Passacaglia-Tradition und die subtilen neoklassizistischen Tendenzen, die in diesen scheinbar avantgardistischen Kompositionen verborgen liegen. Es wird untersucht, ob die Verwendung alter Formen lediglich ein stilistisches Mittel war oder eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung der Dodekaphonie. Tauchen Sie ein in die Welt der Wiener Schule und erleben Sie, wie Geschichte und Fortschritt, Konvention und Innovation in einer einzigartigen musikalischen Synthese verschmelzen, um eine neue Perspektive auf die Musik des 20. Jahrhunderts zu eröffnen. Erfahren Sie, wie Schönberg, Berg und Webern die Tradition nutzten, um etwas radikal Neues zu schaffen, und entdecken Sie die verborgenen Verbindungen zwischen Bach, Brahms und der Moderne. Diese tiefgründige Analyse bietet neue Einblicke in das Geschichts- und Traditionsverständnis dieser Komponisten und fordert dazu heraus, die gängigen Vorstellungen über musikalische Revolutionen zu überdenken. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die verborgenen Strukturen und symbolischen Botschaften, die das Herzstück der Musik der zweiten Wiener Schule bilden, und entdecken Sie, wie diese Meister die Vergangenheit nutzten, um die Zukunft der Musik zu gestalten. Diese Studie ist ein Muss für alle, die sich für Musikgeschichte, musikalische Analyse und die komplexen Beziehungen zwischen Tradition und Innovation interessieren.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel I Geschichts- und Traditionsverständnis der Komponisten
Kapitel I.1 Schönberg
Kapitel I.2 Webern
Kapitel I.3 Zahlensymbolik als Verbindung zur älteren Musiktradition
Kapitel I.4 Die Passacaglia
Kapitel II Analysen
Kapitel II.1 Passacaglia op.1 für großes Orchester von Anton Webern
Kapitel II.2. Pierrot lunaire, No. 8, “Nacht” von Arnold Schönberg
Kapitel II.3 Wozzeck Doktorszene I/4 von Alban Berg
Kapitel III Neoklassizistische Tendenzen?
Literaturverzeichnis
Einleitung
Hanns Eisler schrieb in der Festschrift zum 50. Geburtstag Arnold Schönbergs: “Heute ist uns klar: er schuf sich ein neues Material um in der Fülle und Geschlossenheit der Klassiker zu musizieren. Er ist der wahre Konservative: er schuf sich sogar eine Revolu- tion, um Reaktionär sein zu können.”1 Die These Eislers erscheint auf den ersten Blick überspitzt. Dennoch soll es Aufgabe dieser Arbeit sein, festzustellen, ob und in wie weit die “konservativen Revolutionäre” der zweiten Wiener Schule, Arnold Schönberg (1874 - 1951), Alban Berg (1885 - 1935) und Anton Webern (1883 - 1945) in den alten For- men Strukturmodelle sahen, die es ermöglichten, die “Neue Musik” jenseits der Textebe- ne zu gliedern. Auch wenn A. Schönberg in seinem “Interview mit mir selbst” von 1928 betont, daß diese Formen prinzipiell keine alten seien: “[...] ich hoffe man wird in einiger Zeit sehen, daß diese Variationen formell etwas Neues sind [...] Was an den alten Formen alt ist, ist bloß der Name”2 scheint es, als ob selbst das Aufgreifen von Bezeichnungen einer vergangenen musikalischen Epoche die Verwurzelung in einer bestimmten musika- lischen Tradition manifestiert.
Dies soll an drei Passacaglien der Komponisten gezeigt werden: an der Passacaglia für Orchester op. 1 von Anton Webern, an Alban Bergs Wozzeck, I. Akt 4. Szene: “Studierstube des Doktors” und an Arnold Schönbergs Pierrot lunaire, daraus: Nr. 8: “Nacht”. Die ausgewählten Stücke nehmen keine Sonderstellung im Œ uvre der Komponisten ein. Sie sind weder die einzigen Passacaglien, noch die einzigen Werke, denen ein musikgeschichtlich alter Name oder Form zugrunde liegt.3 In der Arbeit wird zu beweisen sein, daß es sich im Gegensatz zu dem oben genannten Zitat Schönbergs nicht nur um alte Namen, sondern auch um alte Modelle handelt.
Der Frage, ob das Aufgreifen älterer Formen ausreichend ist, um die Wiener Schule, wie Stravinskij, eine “neo - classical school”4 zu nennen, oder ob es eine Notwendigkeit war, ohne die die Dodekaphonie nicht entstehen konnte, möchte ich nachgehen. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil stehen die grundlegenden Überle- gungen zum Geschichts- und Traditionsverständnis der Komponisten Schönberg und Webern im Vordergrund, im zweiten Teil die Auseinandersetzung mit den drei Werken unter dem Aspekt der Passacagliatradition. Ein abschließender dritter Teil beschäftigt sich mit der Frage der neoklassizistischen Strömungen, die in diesen Werken zu erken- nen sind.
Kapitel I Geschichts- und Traditionsverständnis der drei Komponisten
Schönberg und Webern sind ihrer Auffassung von Geschichte nach Kinder ihrer Zeit. Der Gedanke, daß alle geschichtliche, auch musikgeschichtliche Entwicklung auf ein bestimmtes Ziel zustrebt, war ein zeitimmanentes Phänomen, das diese Komponisten vor allem von Guido Adler übernahmen. So scheint es nicht verwunderlich, daß A. Webern in seiner Vortragsreihe: “Wege zur Neuen Musik” schreibt: “[...] Und nun hat sich der Prozeß vollzogen, daß die Musik von Stufe zu Stufe dieses zusammengesetzte Material fortschreitend ausgenützt hat[...]”5.
Diese Ansichtsweise erklärt - zumindest teilweise - die Abneigung Schönbergs, die er in seinen “Chorsatiren” den Komponisten entgegenbringt, die seiner Ansicht nach “zurück zu...” streben6. Sie können oder wollen die stringente Entwicklung der Musik nicht fort- führen.
Über Alban Brgs Einstellung zur Geschichte und Tradition Stellung zu nehmen, ist wesentlich schwerer. Die ästhetischen Vorstellungen eines Künstlers, der von sich selber sagt, er sei kein “grauer Theoretiker”, sind nicht einfach über Texte zu erfassen, sondern müssen durch die Betrachtung seiner Musik gewonnen werden.7
Kapitel I.1. Arnold Schönberg
“Meine Lehrmeister waren in erster Linie Bach und Mozart, in zweiter Beethoven, Brahms und Wagner [...] ich habe auch von Schubert vieles gelernt und auch von Mahler Strauss und Reger”8. Diese Äußerung Schönbergs veranschaulicht seine spezielle Sicht- weise der Musikgeschichte. Zum einen fehlen in der Reihe seiner Vorbilder Komponis- ten aus nicht deutschsprachigen Ländern, zu anderem fällt auf, daß er sowohl Brahms als auch Wagner zu seinen Lehrmeistern zählt, obwohl die Polarisierung zwischen den “Neudeutschen” und den “Konservativen” zu Beginn des Jahrhunderts noch unvermin- dert anhielt. Warum Schönberg sich nicht an dieser Konfrontation beteiligt hat, läßt sich vielleicht durch eine andere Äußerung klären: “...Ich habe mich gegen keinen verschlos- sen und konnte deshalb von mir sagen: Meine Originalität kommt daher, daß ich alles Gute, das ich je gesehen habe, sofort nachgeahmt habe.”9 Durch dieses Zitat wird außer- dem klar deutlich, daß Schönberg sich in der Nachfolge einer Reihe von deutschen Ton- künstlern sieht, die er nachahmt, um zu einer eigenen Kompositionsweise zu finden.10
Schönbergs Geschichtsverständnis - auch das der Musikgeschichte - ist evolutionär. Das bedeutet nicht nur, daß eine stringente Entwicklung zu etwas Besserem geschieht, sondern auch, daß nur die exakte Kenntnis der Kompositionsweise der alten Meister diese Entwicklung voranbringen kann. Für Schönberg findet diese Entwicklung ihren Endpunkt in der Gleichberechtigung aller zwölf Töne der chromatischen Skala, sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Ebene einer Komposition.
Kapitel I.2. Anton Webern
Webern stellt seine Geschichtsphilosophie in der Vortragsreihe “Wege zur Neuen Musik”11 vor. Er legt der evolutionären Entwicklung von Musik ein Naturgesetz zu Grunde, das einem Pendel gleich von einem Extrem zum anderen tendiert und letztlich zu einem Ausgleich strebt. Als Gegensatzpaare beschreibt Webern Homophonie und Polyphonie sowie Melodik und Harmonik.
Weberns Interesse an der alten Musik zeigt sich deutlich an seiner Dissertation, die er über den Choralis Constatinus von Heinrich Isaac schrieb, aber auch an seiner starken Affinität zu der Schule der Niederländer des sechzehnten Jahrhunderts. In seinen Vorträ- gen nennt er diese immer wieder beispielhaft für mathematisch-abstrakte Komposition. Johann Sebastian Bach ist sein absolutes Vorbild, das schon alle Musikentwicklung vor- gezeichnet hat. So sagt er in seinen Vorträgen: “[...]Übrigens hat auch Bach schon so geschrieben - Bach hat eben alles komponiert, sich mit allem befaßt, was etwas zu denken gibt.”12
Die Musikentwicklung sieht Webern als eine Metamorphose, wobei er sich an den na- turwissenschaftlichen Erkenntnisse Goethes orientiert. Auch die Idee einer geschichtli- chen “Pendelbewegung” als grundlegendes Naturgesetz stammt aus Goethes “Die Meta- morphose der Pflanzen”. “[...] und wir werden auf diese abwechselnde Wirkung der Zu- sammenziehung und Ausdehnung, wodurch die Natur endlich ans Ziel gelangt, immer aufmerksamer gemacht.”13
Ebenso wie sein Lehrer Schönberg ist Webern davon überzeugt, daß das Alte nicht von etwas Neuem abgelöst wird, sondern durch das Neue befruchtet wird. So sagt er in seiner Vortragsreihe “Der Weg zur Komposition in zwölf Tönen”: “[..]Auch die alten Niederländer waren sich über den Weg nicht klar bewußt, und zum Schluß ist aus dieser Entwicklung die ‚Harmonielehre‘ von Schönberg herausgekommen!”14.
Kapitel I.3 Zahlensymbolik als Verbindung zur älteren Musiktradition
Die hier zu besprechenden Kompositionen A. Schönbergs und A. Bergs weisen eine starke geometrische Prägung auf, die sich auf die Zahlensymbolik der älteren Musik beziehen könnte. So ist der “Pierrot lunaire” aus drei mal sieben Melodramen aufgebaut, was zu einer Gesamtsumme von 21 Stücken führt. Ebenso weist das 7-taktige PassacagliaThema in der Doktorszene von Bergs Wozzeck 21 Variationen auf, die meist ebenfalls siebentaktig sind oder im 7/4 Takt stehen.
Daß Alban Berg eine starke Affinität zur Zahlensymbolik an den Tag legte, kann unter anderem dadurch bewiesen werden, daß er die Zahl 23 als seine “Schicksalszahl” be- zeichnete15. Arnold Schönberg hingegen äußerte sich in einem Brief an Wassily Kan- dinsky: “Vielleicht dem Stoff, dem Inhalt (Girauds ‚Pierrot lunaire‘) nach kein Herzens- bedürfnis. Wohl aber der Form nach...”16. Die streng geometrische Struktur der Gedicht- vorlage (zwei Quartette und ein Quintett und eine refrainartige Textzeile, die in jeder Strophe wiederkehrt) scheint ein willkommener Ansatzpunkt für die Komposition gewe- sen zu sein.17
Die Mitglieder der Wiener Schule, die den strukturierenden Rahmen der Tonalität verlas- sen hatten, suchten nach einer Gliederungsmöglichkeit ihrer Werke. Alte Variationsfor- men wie die Passacaglia schienen ihnen angemessen zu sein, um einen “Außenhalt” zu schaffen, durch den die Kompositionen sinnvoll zu fassen waren. Gleichzeitig boten die- se Formen durch die ihnen immanente Struktur zahlreiche Möglichkeiten, um mit Zahlen zu spielen.
Alle Zahlen, die in den zu besprechenden Werken Bergs und Schönbergs eine hervorra- gende Rolle spielen, hatten sowohl für die Niederländische Schule des 15. Jahrhunderts, als auch für Johann Sebastian Bach eine besondere, hauptsächlich religiös motivierte Bedeutung18:
Die Drei verkörperte in der mittelalterlichen Zahlensymbolik die Trinität von Gottvater, Sohn und heiligem Geist. Die Sieben galt als eine magisch, mystische Dimension, der sowohl heilige wie böse Kräfte zugeordnet wurden. Gleichzeitig existierte die Einteilung in sieben “freie Künste” und von unserem Sonnensystem waren sieben Planeten bekannt. Die 21 entsteht aus der Multiplikation von 3 und 7, oder aus der Addition der Zahlen 1 bis 6, was sie als eine übergeordnete Zahl erscheinen läßt, die wichtige Charaktere ihrer Multiplikatoren beinhaltet. Durch die Addition der Zahlen 1 bis 6 stellt sie außerdem die Summe der Augen eines Würfels da, der bis ins 18. Jahrhundert hinein eine große Bedeu- tung für die Komposition hatte19.
Ob den Komponisten des 20. Jahrhunderts alle diese Dimensionen bewußt waren, bleibt Spekulation. Die grundlegenden Symbole jedoch müßten ihnen bekannt gewesen sein.
Kapitel I.4 Die Passacaglia
Das Wort Passacaglia stammt aus dem Spanischen und bedeutete ursprünglich “auf der Straße herumgehen”. Es handelte sich im 17. Jahrhundert also um einen übergeordneten Begriff für Gassenhauer.20
Im 17. Jahrhundert entstand die Passacaglia zusammen mit der Ciaconna und der Folia als ein Tanzbaß, der über bestimmte feststehende Formeln verfügte. Auf diesen entstanden ostinate Variationen von zwei bis vier Takten Länge.
Durch die Möglichkeiten der wiederkehrenden Variation war es möglich Instrumentalmusik musikimmanent zu gliedern und nicht wie zuvor auf die Struktur der Vokalmusik, also Strophen oder Versgliederung angewiesen zu sein.
Anfangs unterscheiden sich Ciaconne und Passacaglia durch die große bzw. kleine Terz über dem Grundton und sind so eine Vorwegnahme des Dur / Moll Dualismus21. Aber im späten 17. Jahrhundert schwinden die Unterschiede fast vollständig. Man kann höchstens sagen, daß die Passacaglia tendenziell in getragenem Tempo und Moll, die Ciaconne meist in schnellem Tempo und Dur steht.
Buxtehude führte die Passacaglia in die deutsche Orgelmusik ein. Er kombiniert sie mit der Fuge zu einem neuen musikalischen Gebilde, was unter anderem auch von Johann Sebastian Bach übernommen wurde. Bach gilt dann als Identifikationsstifter sowohl für Passacagliakompositionen Brahms‘ als auch Regers.
Im Verlauf des frühen 20. Jahrhunderts haben sich zahlreiche Komponisten mit dieser Form auseinandergesetzt. Sei es aus dem Versuch heraus, eine alte Form mit neuem Le- ben zu füllen, wie es Hindemith oder Britten taten, oder, wie die Mitglieder der zweiten Wiener Schule, um mit Hilfe einer alten Form mit neuen Strukturen zu experimentieren.
Kapitel II Analysen
Kapitel II.1 Passacaglia op.1 für großes Orchester von Anton Webern
Die Passacaglia op. 1 bezeichnete Webern selbst als sein “Gesellenstück”, denn es war das letzte Werk, das er unter der direkten Aufsicht seines Lehrers Schönberg schrieb. Die groß orchestrierte Komposition, die den umfangreichsten Satz seines Œ uvres bildet, be- inhaltet zwei wesentliche Strukturmerkmale22. Erstens die von Brahms inspirierte Ver- wendung des Ostinatobasses23 und zweitens die Durchführung mehrerer Themen im Sin- ne der “entwickelnden Variation”, die aus diesem Passacagliathema entstehen.
Anton Webern hat anläßlich des Düsseldorfer Tonkünstlerfestes von 1921 in der “All- gemeinen Musik-Zeitung” eine knappe Analyse seines op.1 veröffentlicht.24 In dieser machte er vor allem deutlich, daß alle verwendeten Motive sich aus dem 7-tönigen Hauptthema und einem in der ersten Variation gebrachten Gegenthema entwickeln.
Das zuerst von den Streichern in pizzicato vorgestellte Thema mit den Tönen von d-Moll ist abgesehen von dem leiterfremden Ton as ein fast barockes Passacagliathema. Dieses äußert sich einerseits durch das langsame Tempo und die Achttaktigkeit, andererseits durch die sequenzierenden Halbtonschritte, den verminderten Septsprung und die reguläre Kadenz mit Quintfall25. Das Gegenthema und dessen Entwicklung wird durch den Ton as und die starke Chromatik geprägt.
Webern selbst gliedert das Stück in 23 Variationen und eine Coda.26 Tempi- und/oder Dynamikwechsel kennzeichnen den Anfang der durchgängig achttaktigen Variationen und strukturieren die Coda. Die Variationen werden in elf Moll-, vier Dur- und anschließend acht Mollvariationen aufgeteilt.
In den ersten vier Variationen (T 9 - 41) wird das Hauptthema streng durchgehalten und wandert dabei durch die verschiedenen Instrumentengruppen. Anschließend wandelt es sich immer stärker und die thematische Arbeit wird von verschiedenen Motiven übernommen, die aus dem Gegenthema und dem Hauptthema entwickelt worden sind. Das Gegenthema erscheint in der ersten Variation in der Flöte.
Notenbsp
Zusätzlich können noch zwei wesentliche Nebenmotive festgestellt werden: Das Motiv a, das in den Variationen 2 bis 5 dominiert, ist laut Webern27 eine Umwandlung des Gegenthemas. Abgesehen von einer ähnlichen Sequenzstruktur und der Synkopierung ist jedoch keine Übereinstimmung festzustellen. Aus dem Hauptthema ist das zweite Motiv b klar herzuleiten, daß zuerst in der 6. Variation erscheint.
Notenbeispiel
Der verminderte Septsprung des Hauptthemas ist zur großen Sept geweitet, der Sekundgang erweitert. Im Verlauf der nächsten Variationen überlagern sich diese Motive zusammen mit dem Haupt- und dem Gegenthema.
Webern sieht die Variationen 9 - 11 als eine Überleitung zu dem D-Dur Teil der in Vari- ation 12 (Takt 97) erreicht wird. In den Variationen 12 - 15 erscheint das Hauptthema in seiner Durgestalt sehr deutlich. In der ersten Dur - Variation erscheint es über einer ein- fachen Begleitfigur. Für die Variationen 13 - 15 tritt das Motiv a in einer Umformung als triolische Begleitung zu dem Hauptthema.
Die ersten fünfzehn Variationen lassen sich unter einem Spannungsbogen zusammenfassen, in dem eine kontinuierliche Steigerung bis zur 7. und eine ebensolche Entspannung bis zur fünfzehnten Variation festgestellt werden kann.
Die acht letzten Variationen in Moll arbeiten auf den Höhepunkt hin, der in der 23. Vari- ation erreicht wird. Diese ist eine Abwandlung der 8. Variation. Es schließt sich eine Co- da (T. 193 - 269) an, die etwa ein Drittel des Stückes ausmacht und in der zuerst durch- führungsartig ein Thema aus der 13. Variation verarbeitet ist. Dieses steigert sich zu ei- ner veränderten Version der 7. Variation (T. 228 - 239). Schließlich wird ein abgewan- deltes Motiv aus der 8. Variation (T. 65ff, Holzbläser), bei dem der Sprung der großen Sept auf eine Quinte reduziert ist (T. 239ff Holzbläser) eingeführt. Damit wird die Kom- position zu einem immer ruhigerem Ende gebracht, an dem nur noch Posaunen und Harfe in ppp einen d-Moll Akkord intonieren.
Tempi- und Dynamikwechsel am Anfang jeder Variation und jeder neuen Motivik in der Coda gliedern den Satz. Außerdem bildet die streng durchgeführte Siebentaktigkeit der einzelnen Variationen eine Gliederungsmöglichkeit.
Weberns Passacaglia beinhaltet dieselben kompositorischen Hintergründe, die auch Schönberg und Berg zu ihren Passacagliakompositionen bewegt haben könnten.: “Aus einem Hauptgedanken alles Weitere entwickeln!”28
Kapitel II.2. Pierrot lunaire, No. 8, “Nacht” von Arnold Schönberg
Schönbergs “Pierrot lunaire” gehört zu den anerkanntesten und meistgespielten Werken dieses Komponisten. Er ist in einer Zeit der geistigen Orientierung entstanden, in der Schönbergs Hauptaugenmerk auf der Komposition eines Oratoriums lag. In dem bereits zitierten Brief an Kandinsky schrieb er zu seiner Komposition am “Pierrot”: “[...] Jeden- falls für mich bemerkenswert als Vorstudie zu einer anderen Arbeit[...] Balzacs ‚Seraphi- tia‘ [...] ich will‘s nicht szenisch machen. Nicht so sehr Theater[...] sondern mehr Orato- rium, das sicht- und hörbar wird.”29
Insgesamt ist Schönbergs Ästhetik in dieser Periode stark vom Wiener Jugendstil ge- prägt.30 Der Jugendstil sah sich als eine Gegenbewegung zu der als überkommen emp- fundenen Romantik, was sich in der bildenden Kunst vor allem durch den Rückbezug auf antike oder mittelalterliche Techniken und Motive einerseits und die Adaption orientalischer Motive andererseits niederschlug31.
Gleichfalls kann in der Wiener Secession die Reduktion der Ornamentik auf geometrisch klare Elemente beobachtet werden. Auch das läßt sich in Schönbergs “Pierrot” wiederfinden. Zweifellos ist festzustellen, daß die von Schönberg ausgewählten Gedichte in der Tradition des “fin de siècle” wurzeln.
Es liegt nahe, daß A. Schönberg, der eng mit Adolf Loos (1870 - 1933) befreundet war, solche Gedanken auf die Musik übertrug. Wobei es weder A. Loos noch Schönberg darum ging, eine historisierende Fassade zu erschaffen, sondern durch den Rückgriff in der Form, gänzlich Neues zu entwickeln.32
Der “Pierrot lunaire” ist klar strukturiert. 21 Gedichte mit je drei Strophen sind zu drei Gruppen zusammengefaßt, die jeweils aus sieben Gedichten bestehen. Jedes der Gedichte hat die gleiche Struktur: zwei Quartetten folgt ein Quintett. Der Anfangsvers erscheint im zweiten Quartett als dritter und im Quintett als letzter Vers.
Schönberg greift im Titel von vier Melodramen auf alte musikalische Formen zurück. Nummer 5 ist mit “Valse de Chopin”, Nummer 19 mit “Serenade” überschrieben. Num- mer 8 “Nacht” trägt den Untertitel “Passacaglia”, Nummer 20 “Heimfahrt” den Untertitel “Barcarolle”.
Roland Tenschert betont in einer Analyse von 1925: “Es handelt sich hier natürlich nicht um eine Passacaglia im alten Sinne, um ein Stück mit ostinater Baßmelodie, sondern Schönberg will mit dieser Benennung offenbar sagen, daß in dem Stück eine äußerste Ökonomie der verwendeten Mittel angestrebt werden soll”.33 Dieses Zitat ist kongruent mit der Aussage Weberns, die zum Abschluß des letzten Kapitels zitiert wurde. “Nacht” ist dreiteilig. Die Einteilung folgt der Struktur des Gedichtes, jeder Strophe wird ein neuer musikalischer Abschnitt zugeordnet.
In Teil A (T. 1 - 10) mit der Tempoangabe “Gehende Viertel (ca. 88)” wird zu Beginn die Intervallfolge kleine Terz aufwärts, große Terz abwärts als Hauptmotiv a sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung vorgestellt und ist das ganze Stück hindurch prominent. Gleich zu Beginn erscheint a in vertikaler Anordnung fünf Mal innerhalb zwei Takten, teilweise verschränkt. Die ersten beiden Einsätze erfolgen auf dem zweiten Ton des vorangehenden Motivs. Die vierte Wiederholung nutzt den dritten Ton des vo- rangegangenen und der letzte die Oktave des ersten Motivs. Das erste Mal in der horizontalen Ebene wird a von der Baßklarinette vorgeführt (T. 4).
Verfolgt man die Einsätze der Stimmen in Takt 1 und Takt 2, so entsteht ein verminderter Septakkord. Das Intervall der verminderten Sept und das Hauptmotiv a werden für das ganze Stück bestimmend.
In Teil A, der durchweg p - ppp gehalten ist, tritt zu dem meist unverschleiert erschei- nendem Hauptmotiv eine absteigende chromatische Linie, die sich unmittelbar aus dem Hauptmotiv ergibt, wenn man nur den ersten und letzten Ton berücksichtigt. Die erste Strophe (T. 4 - 10) besteht aus einem vierstimmigen Kanon, an dem die Rezita- tion nicht teilnimmt.34 Das Material des Kanons ist das dreitönige Hauptmotiv, gefolgt von einem chromatischen Abgang unterschiedlicher Länge. Zusätzlich wird in Baßklari- nette (T. 8) und anschließend in der linken Hand des Klaviers (T. 9) dreimal hintereinan- der eine diminuierte Form von a in Achteln gebracht. Diese Gruppe hat die Eigenart, daß jeweils der erste Ton jedes Motivs wieder das Motiv a ergibt. Am Ende der Strophe reali- siert auch die Rezitation das Hauptmotiv. Zuvor war in dieser Stimme die chromatische Linie vorherrschend.
In Teil B (T. 11 - 16) mit der Tempoangabe “Etwas rascher” wird die Dynamik von ppp (T. 13) bis zu einem fff - Ausbruch (T. 16) geweitet. Gleich zu Beginn erscheint a in doppelter Ausführung. In der Baßklarinette diminuiert und chromatisch absteigend, In der linken Hand des Klaviers in Originalgestalt. Ein dreistimmiger Kanon über vier Tak- te, realisiert von Klarinette, Cello und linker Hand des Klaviers setzt mit dem Cello ab T. 12 ein. Auch die Dreiergruppe mit doppelter Hauptmotivrealisierung erscheint wieder (T. 12/13). Die Wiederholung der ersten Verszeile ist ähnlich realisiert, wie in Teil A. Teil C (T. 17 - 26) steht im “I. Tempo”, jedoch verwendet Schönberg in diesem Teil fast durchweg kleinere Notenwerte als in A. Das erste motivische Material wird kanonartig von Cello und Baßklarinette in Takt 17 vorgestellt, begleitet von a in der rechten Hand des Klaviers. Takt 19 bringt im Klavier a in der Krebsumkehrung und simultan in Origi- nalgestalt in Achtelsechstolen, was eine erneute Steigerung des Tempos gegenüber Teil B bedeutet. Das gleiche wird in Takt 21 kanonartig im Klavier wiederholt. Das Cello verwendet den chromatischen Fall und die Baßklarinette a und Krebsumkehrung von a. Die Rezitation nutzt im Wesentlichen die chromatische Skala. Takt 24 stellt in einer Apotheose sowohl a als auch die chromatischen Gänge vor. In diesem Takt erscheint a sieben Mal in seiner Grundgestalt, der chromatische Abgang über drei Töne fünf Mal. So endet das Stück, in dem alle motivischen Elemente auf kleinstem Raum zusammengeführt werden.
Der Duktus von “Nacht” läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: Von Strophe zu Strophe verkleinern sich die Notenwerte, verkürzen sich die Kanonpartien und verkleinern sich die beteiligten Instrumentengruppen.
Schönberg gelingt es in diesem Stück, das Teil eines der wichtigen Experimente auf dem Weg zur “Komposition mit zwölf aufeinander bezogenen Tönen” ist, eine musikalische Struktur zu schaffen, die auf keinerlei harmonische Gliederung angewiesen ist, sondern auf der Beziehung der Töne zueinander beruht.
Kapitel II.3 Wozzeck “Doktorszene” I/4 von Alban Berg
Alban Bergs erste Oper “Wozzeck” op. 7, die 1925 uraufgeführt wurde, faßt 15 Szenen aus dem von Georg Büchner (1813 - 1837) fragmentarisch überlieferten Text in 3 Akte zu jeweils fünf Szenen zusammen, die er den klassischen Regeln des Dramas folgend in Exposition, Peripetie und Katastrophe anordnet. Während der erste Akt aus fünf lose zusammenhängenden Charakterstücken besteht, kann der zweite Akt als eine Symphonie in fünf Sätzen bezeichnet werden. Der dritte Akt, der die Katastrophe beschreibt, besteht aus sechs Inventionen.
Im ersten Akt werden in den Szenen jeweils eine Person in ihrer Beziehung zum Protagonisten dargestellt. In der vierten Szene ist es der Doktor, der an Wozzeck nahrungsphysiologische Experimente durchführt.
Diese Szene, der ein Passacagliathema zugrunde liegt, steht im Wesentlichen unter dem Motto der idée fixe35. Willi Reich berichtet darüber: “Lange nach der Komposition des Wozzeck wollte sich Berg einmal über den Ursprung des Wortes ‚Passacaglia‘ informie- ren. [...] [Er] fand einen Hinweis auf den synonymen Ausdruck ‚Folia‘. Dort las er zu seiner großen Befriedigung: ‚Die Folia (etymologisch von Tollheit, Verrücktheit, fixe Idee) ist offenbar eine älteste Form des Ostinato.‘”36 Auch wenn Berg diese Information nicht vorab hatte, scheint er sie im Wortsinn umgesetzt zu haben. Sowohl das Streben des Doktors nach Ruhm, als auch die Visionen Wozzecks kann man als “fixe Ideen” be- zeichnen, die sich in einer Variationsform am besten demonstrieren lassen.
Die Passacaglia ist dreiteilig, wobei der erste (T. 488 - 530) und letzte (T. 562 - 645) Teil von der Figur des Doktors, der mittlere (T. 531 - 561) von Wozzeck dominiert wird.
Es ist augenscheinlich, daß in dieser Szene die Zahl 7 eine bedeutende Rolle einnimmt. Das Thema ist siebentaktig, ebenso wie 14 (2 X 7) der 21 (3 X 7) Variationen. Drei wei- tere Variationen stehen im 7/4 Takt, die Variation 18 umfaßt 14 (2 X 7) Takte. Die drei letzten Variationen die nicht in das Schema passen, sind der Ruhmekstase des Doktors gewidmet. Sowohl die Diminution des Themas auf einen Takt an den Stellen großer In- trovertiertheit, als auch seine Augmentation am Ende des Stückes sind musikimmanent zu deuten.37
Alban Berg hat sich in seinem Wozzeck-Vortrag nicht explizit zu dieser Gliederung geäußert. Aber zu der Doppelfuge in III/1, in der die Zahl 7 auch eine wesentliche Rolle spielt: “[...] Die Strenge der Architektur (ich gebrauche hier absichtlich diese Wort) hat es mit sich gebracht, daß dieses zweiteilige aus Vorder-Satz und Nach-Satz bestehende Thema sieben Takte hat, daß es siebenmal variiert wiederkehrt, [...] Es wäre naheliegend sich über das Mathematische diese Form lustig zu machen.”38
Es ist fragwürdig, ob für Berg hier wie auch in der Passacaglia wirklich nur die “Strenge der Architektur” ausschlaggebend waren oder ob ein Komponist, der zahlreiche cryptographische Strukturen in seinen Werken verwendet hat, nicht doch eine zusätzliche Aussage intendiert.39
Die musikalische Struktur der Passacaglia wird von der “fixen Idee” des 12 tönigen Themas40 bestimmt. Mit dem historischen Vorbild hat es seine breite Anlage gemein. Dominiert wird es von dem Tritonus. Dieses Thema ist harmonisch entworfen. Das tonale Zentrum ist Es, das D am Ende hat Leittonfunktion.41
Der Ostinatobaß dominiert alle 21 Variationen in jeder möglichen Erscheinungsform. In der Umkehrung, akkordisch zusammengefaßt, kanonisch gesetzt, in den verschiedensten Lagen und Instrumenten, bis in der Ekstase des Doktors in der letzten Variation “dieses im Verlauf der Passacaglia mehr verborgene Baßthema - wieder in erhöhter Deutlichkeit - choralmäßig harmonisiert - wieder[kehrt]”42.
Zu dem Baßthema treten in den einzelnen Variationen Leitmotive, die in der ganzen O- per zu finden sind: so das Klage - Motiv “Ach, Marie!”, die soldatische Antwortweise und die Posaune als Leitinstrument Wozzecks.
Im ersten Teil stellt sich der Doktor, der als Baßbuffo besetzt ist und seine Wurzeln in der Commedia dell‘arte hat, als der gelehrte Tor vor43. Das zeigt sich auch in den musi- kalischen Strukturen. Beispielsweise in seiner Abhandlung über die menschliche Frei- heit, die paradoxerweise in der Repetition eines einzelnen Tones mündet (Takt 501), oder in der Betonung des Namens Wozzeck immer auf die zweite Silbe. Des weiteren gibt es in der Musik des Doktors zahlreiche Stellen, die ganztönig sind, oder Terz- und Quart- schichtungen aufweisen. Ein Zitat Bergs stellt diese Mittel in ein besonderes Licht: “[...] Ich glaube, es [den Niveauunterschied zwischen Volks- und Kunst-Musik darzustellen] ist mir dadurch gelungen, daß ich alles, was musikalisch in die Sphäre des Volkstümli- chen reicht, mit einer [...] leicht faßbaren Primitivität erfüllte. Als da sind: Bevorzugung von symmetrischem Bau der Perioden und Sätze, Heranziehung von Terzen- und na- mentlich Quarten-Harmonik, ja von einer Harmonik in der die Ganztonskala und die rei- ne Quart eine große Rolle spielen.”44 Betrachtet man die Rolle des Doktors unter diesem Aspekt, erscheint der klassische Typ des “gelehrten Tors” aus der commedia dell’arte gefestigt.
Gleiches gilt auch für den von Wozzeck dominierten Mittelteil, in dem die eigentlich zu erwartenden Mittel, den Menschen aus dem Volk zu beschreiben ausbleiben, so daß Wozzeck das genaue Gegenbild zum Doktor abgibt: den ungebildeten Weisen.
Kapitel III Neoklassizistische Tendenzen?
Die Form der Passacaglia scheint, wie andere alte Formen auch, für die zweite Wiener Schule eminent wichtig gewesen zu sein. Die Gründe dafür sollen hier noch einmal zu- sammengetragen werden. Durch die vorgegebene Form, an die sich aber keineswegs sklavisch gehalten wurde, fiel es leichter eine strukturelle Grundlage jenseits der Funk- tionsharmonik zu finden. Auch wenn sich Schönberg gegen die, von ihm als Vorwurf empfundene Aussage wehrt, er würde alte Formen verwenden45, kann er den Einfluß solcher Strukturmodelle nicht leugnen. Gleichzeitig hebt er jedoch immer wieder hervor, daß Neue Musik nur durch das Studium alter Meister zu erreichen sei und verstrickt sich dadurch in Widersprüche, wahrscheinlich auch um sich klar von dem verhaßten “zurück zu...” abzugrenzen.
Das wirft nun die Frage auf, warum ihm dies so zuwider war. Der Jugendstil, dem die zweite Wiener Schule nahestand, richtete sich gegen die ihm vorangegangene Epoche der Romantik. Um einen neuen “Zustand der Unschuld” zu erreichen, war es eine einfache Methode die direkte Vergangenheit zu negieren und auf ältere Vorbilder zurückzugreifen. Das Ziel hieße in dem Fall: eine neue (Musik)geschichtsschreibung, in der die Romantik keinen Platz hat, sich ein stringenter Bogen von Bach zu Schönberg spannt, so wie es Webern versucht hat in seinen Vorträgen zu entwickeln.
Allerdings gehen die Arbeiten Saties, der den Neograecismus in die Musik eingeführt hat, in die selbe Richtung mit einem vollständig anderem musikalischen Ergebnis. Und auch Busonis Streben nach einer neuen Klassizität erscheint in einem ähnlichen Licht. Das Spiel mit musikgeschichtlich älteren Formen ist keine Entwicklung, die sich erst im 20. Jahrhundert entwickelt hat. Gerade das 19. Jahrhundert, ist reich an Versuchen der Neu- und Uminstrumentierung älterer Musik46.
Wenn Schönberg in seinem Aufsatz: Neue Musik, alte Musik, Stil und Gedanke” die Frage stellt: “Was ist Neue Musik?” und der Leser als Antwort erhält: “Offensichtlich muß das Musik sein, die[...] sich in allem Wesentlichen von früher komponierter Musik unterscheidet [...] Es gibt kein großes Kunstwerk, das nicht der Menschheit eine neue Botschaft vermittelt”47 wird klar, warum er nicht “zurück zu...” streben will. Gleichzeitig ist durch die Betrachtung seiner Musik und der seiner Schüler klargeworden, daß sie auch nicht zu denen gehören, die “zurück zu...” streben. Es bleibt lediglich unklar, ob die, die Schönberg abfällig als Neoklassizisten bezeichnete nicht genauso wenig eine reaktio- näre Position einnehmen und somit der Begriff des Neoklassizismus - je nach Blickwin- kel - vollständig aufgeweicht wird.
Der neuere Versuch den Begriff des Neoklassizismus weitgehend wertneutral auf nahezu alle Kompositionen des beginnenden 20. Jahrhunderts zu übertragen, mag seinen Ursprung darin haben, daß das evolutionäre Geschichtsbild nach wie vor ein sehr prominentes ist und dadurch der Versuch gemacht wird, die eklektizistischen Strömungen der Postmoderne zu begründen.
Literaturverzeichnis:
- Bailey, Kathryn: Formal organization and structural imagery in Schoenberg's Pierrot lunaire. In: Studies in music, Canada, Band II (1977) S. 93 - 107.
- Beinhorn, Gabriele: Die Groteske in der Musik: Arnold Schönbergs Pierrot lunaire, Freiburg 1988.
- Berg, Alban: Wozzeck- Vortrag, in: Csampai, Attiloa und Holland, Dietmar: Alban Bergs Wozzeck, Texte, Materialien, Kommentare, Reinbeck bei Hamburg 1985, S. 159ff.
- Bischof, Rainer: Versuch über die philosophischen Grundlagen von Alban Berg. In: Alban Berg Studien II, hrsg. von Franz Grasberger und Rudolf Stephan, Wien 1981, S. 209ff.
- Blume, Friedrich (Hrsg.): Musik in Geschichte und Gegenwart, Artikel: Passacaglia, Band 10, Kassel 1962.
- Cserépy, Zoltan: Zur visionären Klangwelt der Passacaglia in Alban Bergs Wozzeck, in: Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft, Band VIII-IX (1988-89) S. 81ff.
- Jost, Dominik: Literarischer Jugendstil, Stuttgart 1969.
- Kee, Piet: Zahl und Symbolik in Passacaglia und Ciaconna, in: Musik und Kirche 59 (1988), S. 231ff.
- Klein, Heribert, Im Konzertsaal gehört, Anton von Webern: Passacaglia op. 1, in: Neue Zeitschrift für Musik, Februar 1986, S. 30f.
- König, Werner: Tonalitätsstrukturen in Alban Bergs Oper “Wozzeck”, Tut- zing 1974.
- Kolneder, Walter: Anton Webern, Rodenkirchen 1961.
- Loos, Adolf: Die potemkische Stadt, in: Ver Sacrum I, 1898, S. 15ff.
- Perle, George: The operas of Alban Berg, Volume One Wozzeck, Berkeley 1980.
- Redlich, H. F.: Alban Berg, Versuch einer Würdigung, Wien 1957.
- Scherliess, Volker: Neoklassizismus: Dialog mit der Geschichte, Kassel 1998.
- Stalden, Peter: Berg‘s Cryptography, in: Alban Berg Studien II, hrsg. von Franz Grasberger und Rudolf Stephan, Wien 1981, S. 171ff.
- Stephan, Rudolf: Schönberg und der Klassizismus, in: Kongress-Bericht Ber- lin 1974, S. 3ff.
- Stravinskij, Igor: Gespräche, (1959/60). In: Memories and commentaries by I. Stravinskij and R. Craft, 1981, S 122f).
- Tenschert, Roland: Eine Passacaglia von Arnold Schönberg, in: Die Musik 17, 1925, S. 590ff.
- Vojtech, Ivan (Hrsg.), Arnold Schönberg, Stil und Gedanke, Aufsätze zur Musik, Frankfurt 1976, S. 240ff.
- Webern, Anton: Wege zur neuen Musik, hrsg. von Willi Reich, Wien 1960.
Zeitschriften:
- Musikblätter des Anbruchs, Band 6, Wien 1924, S. 313 ff.
- Österreichische Musikzeitschrift, 27. Jahrgang, Heft 3 (Sonderband Anton Webern), 1972, S. 123f.
[...]
1 Musikblätter des Anbruchs, Band 6, Wien 1924, S. 313.
2 Vergl.: Schönberg, Arnold: Interview, S. 242.
3 Einige Stücke des Pierrot sind mit alten Tanzformen überschrieben, Das 4. der Altenberg- Lieder von Berg ist eine Passacaglia, Webern schrieb mehrere Kanons und Kantaten.
4 In: Stravinskij, Igor: Gespräche, S. 125.
5 Webern, Anton: Wege zur neuen Musik, S. 16.
6 Schönberg schreibt in seinem Vorwort zu den “Chorsatiren”: “2. ziele ich auf die, die vorgeben, >zurück zu...< zu streben”. Zit. nach Scherliess, Volker: Neoklassizismus, S. 258.
7 Brief an Watznauer vom Oktober 1906: “Aber - wie gesagt - ich bin kein grauer Theoretiker!...” zit. nach: Bischof, Rainer: Versuch, S. 213.
8 Stephan, Rudolf: Schönberg und der Klassizismus.
9 Stephan, Rudolf: Schönberg und der Klassizismus.
10 Auch seine Unterrichsmethode, nämlich das Komponieren von alten Musikgattungen spricht für diese These.
11 Eine zweiteilige Vortragsreihe mit den Titeln: “Der Weg zur Komposition in zwölf Tönen” und “Der Weg zur Neuen Musik”. Gehalten vom 22.01.1932 - 02.03.1932 und vom 20.02.1933 - 10.04.1933.
12 Webern, Anton: Wege zur Neuen Musik, S. 37.
13 zit. nach: Johann Wolfgang von Goethe, Werke Band 13, S. 79.
14 Zit. nach: Webern, Anton: Wege zur neuen Musik, S. 60.
15 Vergl.: Stalden, Peter: Bergs Cryptography, S. 209ff. Kee, Piet: Zahl und Symbolik, S. 176.
16 Zit. nach: Beinhorn, Gabriele: Das Groteske, S. 128.
17 Vergl. Bailey, Kathryn: Formal organisation, S. 93.
18 Vergl.: Bailey Cathryn: Formal Organisation, S. 171f.
19 Vergl.: Kee, Piet: Zahl und Symbolik, S. 245.
20 Vergl. Mgg, Band 10, S. 869.
21 Vergl.: Handbuch musikalischer Gattungen, S. 266.
22 Vergl.: Kolneder, Walter, Anton Webern, S. 17.
23 Ebda., S. 19.
24 Vergl.: ÖMZ, 27.Jahrgang, Heft 3, 1972, S. 123f.
25 Vergl.: Klein, Heribert, im Konzertsaal gehört, NZfM, Feb. 1986, S. 30.
26 Vergl.: ÖMZ, 27. Jahrgang, Heft 3, 1972, S. 124.
27 Ebda.
28 Webern, Anton: Wege zur neuen Musik, S 36.
29 Vergl.: Beinhorn, Gabriele: Das Groteske S. 128
30 Zur Definition siehe: Jost, Dominik: Literarischer Jugendstil, S. 1f.
31 Vergl. u.a.: Beinhorn, Gabriele: Das Groteske, S. 100.
32 Vergl.: für Loos: Die potemkische Stadt, für Schönberg: Vorwort zu den Chorsatiren.
33 Zit. nach: Tenschert, Roland: Eine Passacaglia, S. 590.
34 Vergl.: Bailey, Cathryn: Formal Organization, S. 102.
35 Vergl.: Cserépy, Zoltan: Zur visionären Klangwelt, S. 82.
36 Vergl.: Ebda.
37 Vergl.: Ebda. S. 86.
38 Vergl.: Berg, Alban: Wozzeck- Vortrag, S. 173.
39 Vergl.: Perle, George: The operas, S. 128.
40 H. F. Redlich weist auf die Verwandtschaft mit der Passacaglia op. 4, Nr. 5 hin, die er als Vorstudie bezeichnet. Vergl.: Redlich, H.F.: Wozzeck, S. 128.
41 Vergl.: König, Werner: Tonalitätsstrukturen, S. 64.
42 Vergl.: Berg, Alban: Wozzeck - Vortrag, S. 169.
43 Vergl.: Scherliess, Volker: Neoklassizismus, S. 260.
44 Vergl.: Berg, Alban: Wozzeck - Vortrag, S. 167.
45 Vergl.: Schönberg, Arnold: Interview mit mir selbst, Zitat siehe S. 1.
46 Vergl.: Scherliess, Volker: Neoklassizismus, S. 15.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Geschichts- und Traditionsverständnis der Komponisten der zweiten Wiener Schule (Schönberg, Berg, Webern) und deren Verwendung alter Formen wie der Passacaglia, um neue musikalische Strukturen zu schaffen. Sie analysiert Werke von Webern, Schönberg und Berg im Hinblick auf neoklassizistische Tendenzen.
Welche Komponisten werden hauptsächlich in dieser Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern, die als die wichtigsten Vertreter der zweiten Wiener Schule gelten.
Welche Werke werden konkret analysiert?
Die Arbeit analysiert Anton Weberns Passacaglia für Orchester op. 1, Arnold Schönbergs Pierrot lunaire, No. 8, “Nacht” und Alban Bergs Wozzeck, Doktorszene I/4.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass Schönberg, Berg und Webern in alten musikalischen Formen Strukturmodelle sahen, die es ihnen ermöglichten, die "Neue Musik" jenseits der Textebene zu gliedern, und dass diese Formen mehr als nur alte Namen, sondern auch alte Modelle darstellen.
Welche Rolle spielt die Zahlensymbolik in den untersuchten Werken?
Die Arbeit geht auf die Zahlensymbolik in den Kompositionen von Schönberg und Berg ein, insbesondere im Zusammenhang mit den Zahlen 3, 7 und 21, die eine religiös motivierte Bedeutung in der Musikgeschichte haben.
Was ist eine Passacaglia und welche Bedeutung hat sie in dieser Arbeit?
Die Passacaglia ist eine musikalische Form, die im 17. Jahrhundert entstand und durch einen wiederkehrenden Bass (Ostinato) gekennzeichnet ist. In dieser Arbeit wird untersucht, wie die Komponisten der zweiten Wiener Schule die Passacaglia nutzten, um ihren Werken Struktur und Zusammenhang zu geben.
Was sind Neoklassizistische Tendenzen in der Musik der zweiten Wiener Schule?
Die Arbeit untersucht, ob das Aufgreifen älterer Formen durch die Wiener Schule als neoklassizistisch bezeichnet werden kann und ob es eine Notwendigkeit für die Entwicklung der Dodekaphonie war.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Erstens die grundlegenden Überlegungen zum Geschichts- und Traditionsverständnis der Komponisten Schönberg und Webern, im zweiten Teil die Auseinandersetzung mit den drei Werken unter dem Aspekt der Passacagliatradition. Ein abschließender dritter Teil beschäftigt sich mit der Frage der neoklassizistischen Strömungen.
Welche Komponisten werden als Arnold Schönbergs Lehrmeister genannt?
Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner, Schubert, Mahler, Strauss und Reger
Was wird über Alban Bergs Wozzeck, Doktorszene I/4 in dieser Arbeit festgestellt?
Die Doktorszene ist eine Passacaglia, in der das Thema (12 tönige) und Variationen das Leitmotiv der idée fixe darstellen. Die Zahl 7 spielt eine wichtige Rolle in der Szene.
- Quote paper
- Alexander von Nell (Author), 2001, Die Passacaglia in der 2. Wiener Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104245