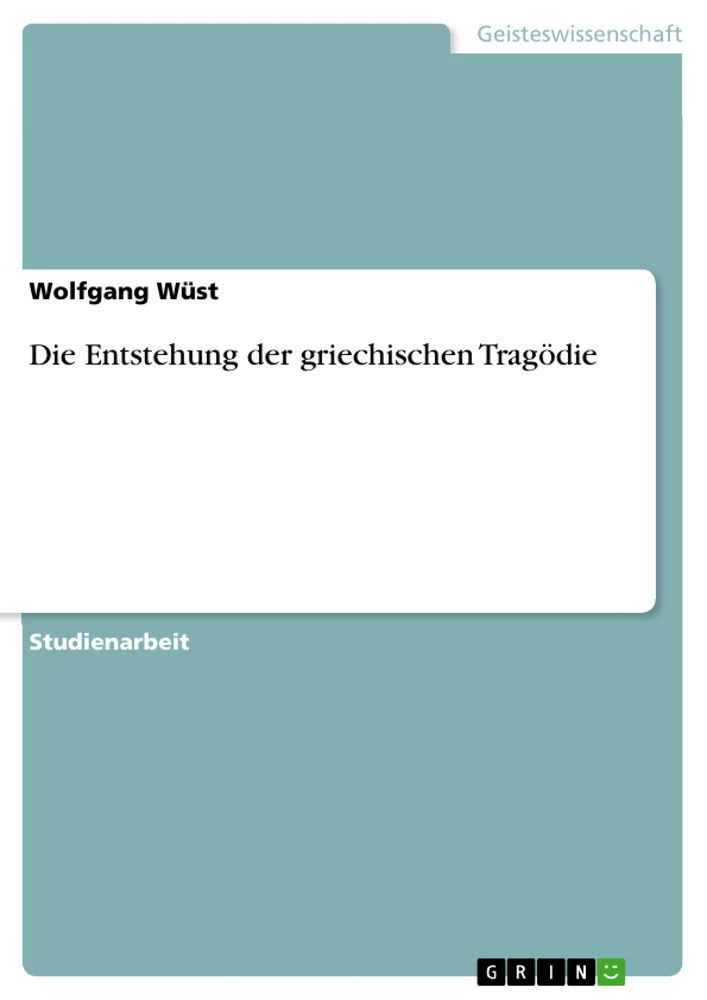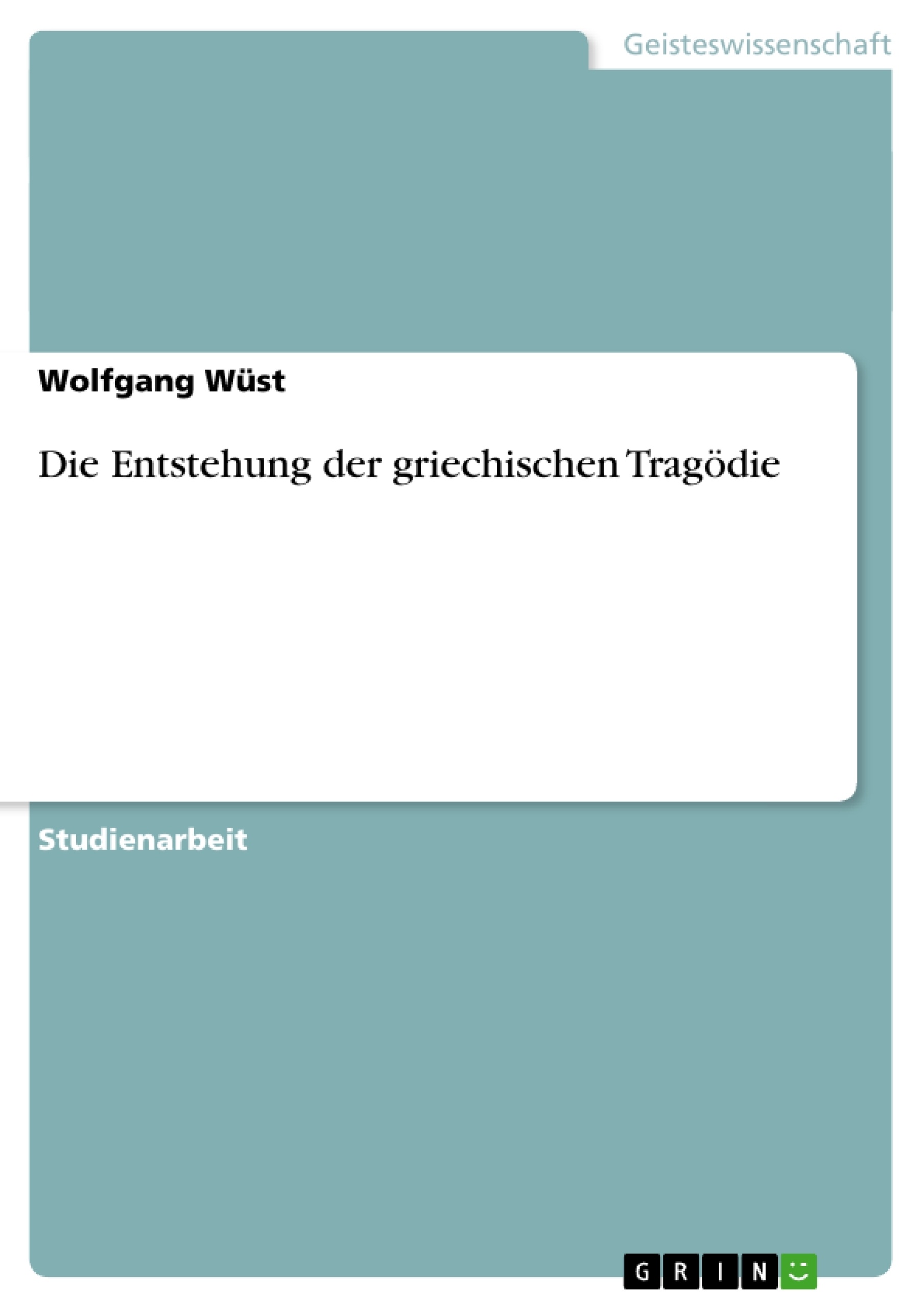Die Entstehung der griechischen Tragödie
Teil 1:Entstehung, Rezeptionskomponenten, Wirkungsziel
1.1 Entstehung
Will man die Entstehung der Tragödie (aus dem Dionysos-Kult und der
griechischen Festgeschichte) betrachten, so muss man sich darüber im klaren sein, dass aus der damaligen Zeit, speziell aus dem Zeitraum indem sich die Tragödie aus ihrer frühen Form entwickelte, kaum originale Quellen überliefert sind. Auch aus der Blütezeit der Tragödie sind nur Fragmente erhalten. Allein Aischylos soll
circa 80 Stücke aufgeführt haben, von denen nur sieben heute noch bekannt sind. Die nachfolgende Geschichte ihrer Entstehung erhebt also keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit, sie kann vielmehr nur den Versuch einer Rekonstruktion darstellen.
In einem Satz gesagt, ist die Tragödie ein Theaterstück, das im Wechsel von Chor und Schauspielern aufgeführt wird.
Die Ursprünge der griechischen Tragödie liegen im Dionysos-Kult begründet. Dionysos, der Gott der Fruchtbarkeit und des Weines (vermutlich schon vor 1200 v. Chr. In Griechenland bekannt) wurde schon in den frühen Mythen mit tanzenden Frauen in Verbindung gebracht.
Das Tanzen der Frauen um Dionysos wird im Griechischen mit dem Verb
`mainesthai´ beschrieben. Dieses Verb bedeutet jedoch nicht `tanzen´ in seinem eigentlichen Sinn, sondern es beschreibt vielmehr ein ekstatisches, rauschhaftes Tanzen.
„In Scharen, Thiasoi, geteilt, streiften die Frauen, Thyrsen schwingend und Fackeln tragend, umher, sie drehten sich im wirbelndem Tanz, bis sie erschöpft zu Boden stürzten [...] In höchste Erregung versetzt ergriffen sie ein Tier, das ihnen in den Weg kam, zerrissen es in Stücke und verschlangen diese.“ (M. Nilsson1, zit. nach Latacz, Einführung in die griech. Tragödie, S. 32)
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1: Entstehung, Rezeptionskomponenten, Wirkungsziel
- 1.1 Entstehung
- 1.2 Die Rezeptionskomponenten
- Ortsgebundenheit
- Anlassgebundenheit
- Wettbewerbsgebundenheit
- Mittelgebundenheit
- 1.3 Wirkungsziel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit rekonstruiert die Entstehung der griechischen Tragödie, beleuchtet die Rezeptionsbedingungen ihrer Aufführungen und analysiert ihr Wirkungsziel. Sie untersucht den Weg der Tragödie vom dionysischen Kult zur hochentwickelten Kunstform, wobei die Rolle von Improvisation, Wettbewerb und gesellschaftlichem Kontext hervorgehoben wird.
- Die Entwicklung der griechischen Tragödie aus dem Dionysos-Kult.
- Die Rezeptionsbedingungen der griechischen Tragödien (Orts-, Anlass-, Wettbewerbs- und Mittelgebundenheit).
- Die Wirkungsweise der Tragödie auf das Publikum (Katharsis, Eleos, Phobos).
- Der Einfluss der politischen und gesellschaftlichen Situation auf die Tragödie.
- Die Rolle von Gesang, Tanz und Sprache in der Tragödie.
Zusammenfassung der Kapitel
Teil 1: Entstehung, Rezeptionskomponenten, Wirkungsziel: Dieser Teil der Arbeit befasst sich umfassend mit der Genese der griechischen Tragödie, beginnend bei ihren Ursprüngen im dionysischen Kult mit seinen ekstatischen Ritualen und improvisierten Dithyramben. Die Institutionalisierung des Kults und die Entwicklung von Festen wie den Anthesterien, Lenäen und städtischen Dionysien werden detailliert beschrieben, wobei die allmähliche Transformation von rituellen Handlungen zu theatralischen Aufführungen nachgezeichnet wird. Die Rolle von Aristoteles' Poetik in der Beschreibung der Entwicklung, insbesondere der graduellen Zunahme der Schauspieler und der Abnahme des Chores, wird ebenfalls beleuchtet. Der Wandel vom Satyrspiel zur Tragödie, die Entwicklung des Versmaßes und die etymologische Analyse des Wortes „Tragödie“ runden die Betrachtung der Entstehung ab.
1.1 Entstehung: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung der griechischen Tragödie aus dem Dionysos-Kult, wobei die Herausforderungen der Rekonstruktion aufgrund des Mangels an originalen Quellen hervorgehoben werden. Es beschreibt die ekstatischen Elemente des Kults, die Rolle von Tanz, Masken und Dithyramben, und die Institutionalisierung des Kults als Reaktion auf die Bedrohung der öffentlichen Ordnung durch das Ausbrechen aus der Normalität. Die Entwicklung von verschiedenen Dionysosfesten und deren Einfluss auf die Entstehung der Tragödie wird detailliert dargestellt, einschließlich der Übernahme von Elementen aus ländlichen Fruchtbarkeitsfesten. Die Bedeutung von Improvisation im Kontext der Dithyramben und deren Entwicklung zur formaleren Struktur der Tragödie wird im Detail erläutert. Die Perspektive Aristoteles' auf die Entwicklung der Tragödie als organischer Prozess wird ebenfalls diskutiert.
1.2 Die Rezeptionskomponenten: Dieses Kapitel analysiert die Rezeptionsbedingungen, unter denen griechische Tragödien aufgeführt wurden. Es konzentriert sich auf vier Hauptaspekte: die Ortsgebundenheit (die Architektur des Theaters und die daraus resultierenden Anforderungen an Länge und Struktur der Stücke), die Anlassgebundenheit (die Aufführungen im Rahmen der Dionysosfeste und die daraus resultierende Einmaligkeit der Aufführungen und der Fokus auf mythische Stoffe), die Wettbewerbsgebundenheit (die Tragödienwettbewerbe als Agon und deren Einfluss auf die Qualität und den gesellschaftlichen Bezug der Stücke) und die Mittelgebundenheit (die gleichen Ressourcen für alle Teilnehmer und deren Einfluss auf die Inszenierung). Jedes dieser Elemente wird detailliert erklärt und mit Beispielen illustriert, um den Einfluss der Rezeptionsbedingungen auf die Gestaltung der Tragödien aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Griechische Tragödie, Dionysos-Kult, Dithyramben, Katharsis, Eleos, Phobos, Aristoteles, Poetik, Rezeption, Agon, Tetralogie, Trilogie, Satyrspiel, Ortsgebundenheit, Anlassgebundenheit, Wettbewerbsgebundenheit, Mittelgebundenheit, Aischylos, Volksversammlung, Areopag.
Häufig gestellte Fragen zur griechischen Tragödie
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die griechische Tragödie. Er behandelt Entstehung, Rezeptionsbedingungen, Wirkungsziel und zentrale Themen. Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text untersucht die Entwicklung der griechischen Tragödie aus dem dionysischen Kult, die Rezeptionsbedingungen ihrer Aufführungen (Orts-, Anlass-, Wettbewerbs- und Mittelgebundenheit), die Wirkungsweise auf das Publikum (Katharsis, Eleos, Phobos), den Einfluss der politischen und gesellschaftlichen Situation und die Rolle von Gesang, Tanz und Sprache.
Wie wird die Entstehung der griechischen Tragödie dargestellt?
Die Entstehung wird detailliert vom dionysischen Kult mit seinen ekstatischen Ritualen und improvisierten Dithyramben bis zur hochentwickelten Kunstform nachgezeichnet. Die Rolle von Improvisation, Wettbewerb und gesellschaftlichem Kontext wird hervorgehoben. Die Institutionalisierung des Kults und die Entwicklung von Festen wie den Anthesterien, Lenäen und städtischen Dionysien werden beschrieben, sowie der Wandel vom Satyrspiel zur Tragödie.
Welche Rezeptionsbedingungen werden analysiert?
Der Text analysiert die Ortsgebundenheit (Theaterarchitektur), die Anlassgebundenheit (Dionysosfeste), die Wettbewerbsgebundenheit (Tragödienwettbewerbe als Agon) und die Mittelgebundenheit (gleiche Ressourcen für alle Teilnehmer). Der Einfluss dieser Bedingungen auf die Gestaltung der Tragödien wird detailliert erläutert und mit Beispielen illustriert.
Welche Wirkungsweise der Tragödie auf das Publikum wird beschrieben?
Der Text beschreibt die Wirkungsweise der Tragödie auf das Publikum unter Bezugnahme auf die Begriffe Katharsis, Eleos und Phobos.
Welche Rolle spielt Aristoteles?
Aristoteles' Poetik und seine Perspektive auf die Entwicklung der Tragödie als organischer Prozess werden im Text berücksichtigt und diskutiert, insbesondere bezüglich der Entwicklung der Anzahl der Schauspieler und der Rolle des Chores.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Griechische Tragödie, Dionysos-Kult, Dithyramben, Katharsis, Eleos, Phobos, Aristoteles, Poetik, Rezeption, Agon, Tetralogie, Trilogie, Satyrspiel, Ortsgebundenheit, Anlassgebundenheit, Wettbewerbsgebundenheit, Mittelgebundenheit, Aischylos, Volksversammlung, Areopag.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text ist in mindestens einen Hauptteil gegliedert, der sich mit der Entstehung, den Rezeptionskomponenten und dem Wirkungsziel der griechischen Tragödie befasst. Dieser Hauptteil enthält Unterkapitel, die sich detaillierter mit der Entstehung und den Rezeptionsbedingungen auseinandersetzen.
- Quote paper
- Wolfgang Wüst (Author), 2001, Die Entstehung der griechischen Tragödie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104153