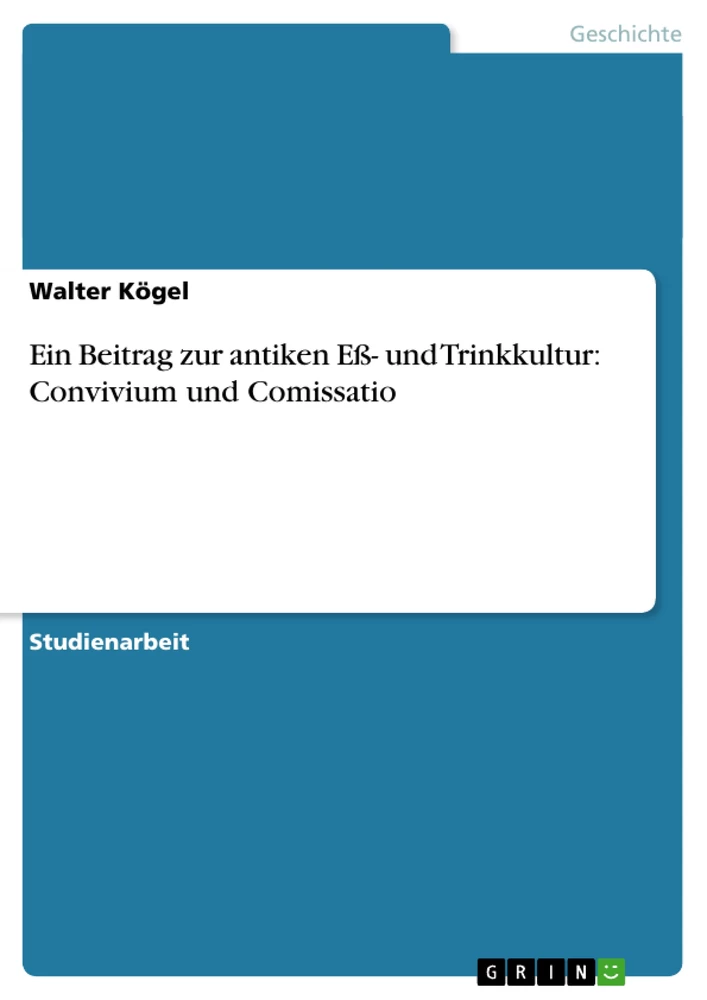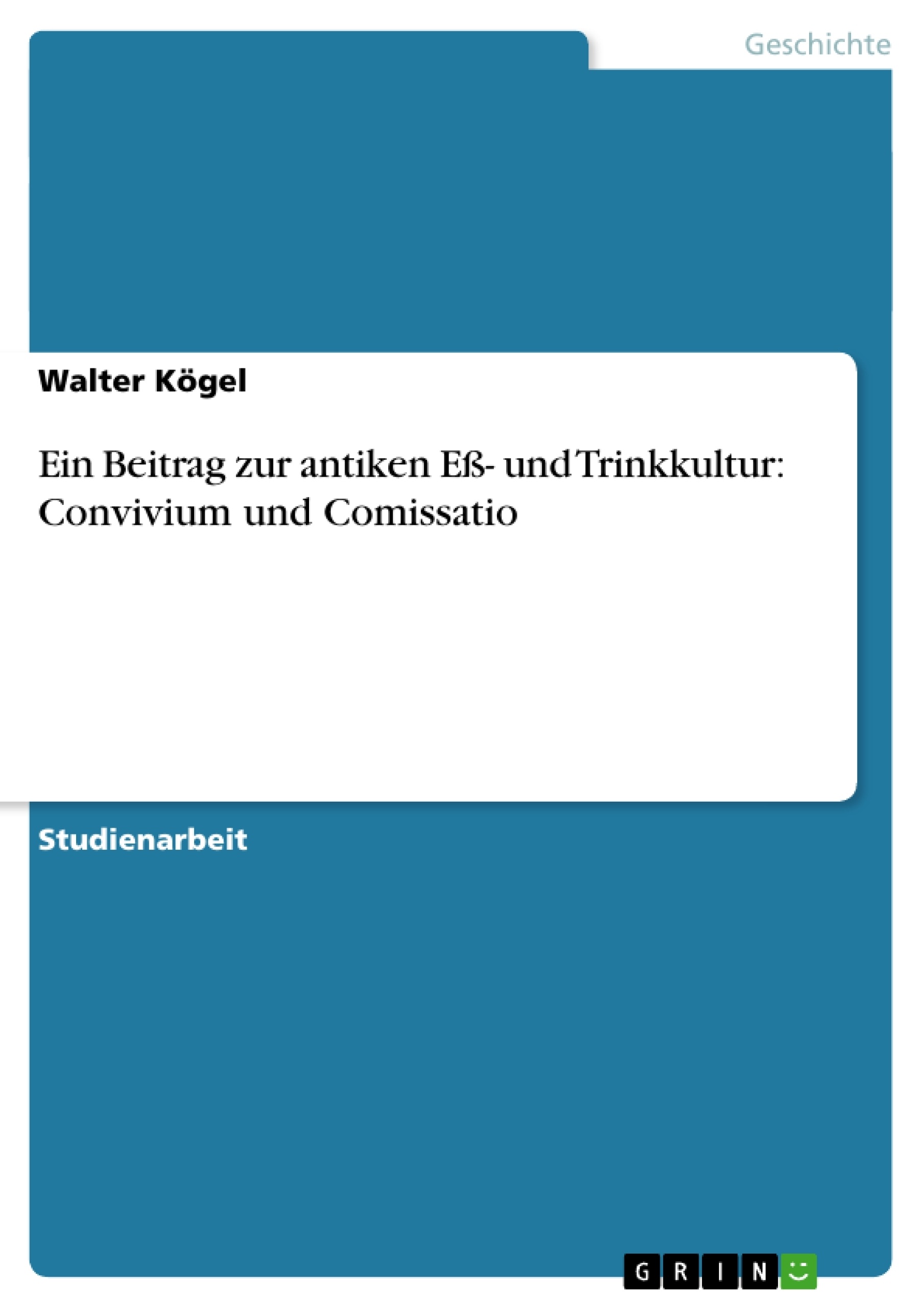Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
1. Das Convivium
2. Die Comissatio
3. Die Teilnahme von Frauen
4. Zwei „case studies“: Der römische Aufsteiger Trimalchio und das Hochzeitsmahl des Lucian
5. Die soziale Ausdifferenzierung des Gastmahles
Schluß
Quellenverzeichnis
Sekundärliteratur
Einleitung
Die folgende Untersuchung beschäftigt sich mit den verschiedenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen eines antiken Mahles. Bevor das Convivium und die Comissatio näher beleuchtet werden, wollen wir kurz den Kulturunterschied zwischen Römern und Griechen verdeutlichen. Anschließend werden die einzelnen Teilnehmer eines Gastmahles vorgestellt und anhand berühmter Gastmähler eine Verortung der sozialen Differenz dieses gesellschaftlichen Ereignisses versucht.
Völlerei, Tafelluxus, Gefräßigkeit und Flucht in den Freßwahn - die alles sind Strategien zur Wirklichkeitsbewältigung, die so alt erscheinen wie die Menschheit selbst. Doch kulturgeschichtlich dauerte es seine Zeit, bis diesen Strategien ihre gesellschaftliche Funktion zukam, die Eß- und Trinkkultur mußte zunächst einmal erst erfunden werden. Schlimm war es bei den Griechen gewesen, den reinsten Barbaren hinsichtlich des Lebensgenusses. Hatte der attische Erfindungsgeist doch nicht einmal für eine simple „Trikline“, ein antikes Lotterbett (s.u.), gereicht! Der Bauer gleich dem Städter: Im Sitzen wurde das karge Mahl verzehrt, zumeist im engen Kreise der Familie. Spitzenweine waren den meisten Griechen unbekannt, der Haltbarkeit wegen wurde wahlweise Gips, Ton, Marmor, Kalk oder Harz beigemischt - ohne jede Rücksicht auf den Geschmack. Weinvergiftungen waren keine Seltenheit, im Wein war eben nicht nur Wahrheit. Die moderne Geschichtswissenschaft kennt heute die Ursache des fehlenden Tafelluxus: Im Sitzen ließ es sich nicht ausgiebig speisen, erst die römische Liege, die schon erwähnte Trikline, brachte den kulturellen Fortschritt mit sich. Auch sonst ging es karg zu im alten Hellas. Gemeinsam biß der Vater wie die Mutter in das sandige Haferbrot, während die kleinen Kinder abseits an einen eigenen Platz verwiesen wurden. Immerhin blieben sie in Sichtweite. Dagegen verwies man den hauseigenen Sklaven zum Essen in die Küche hinter den Ofen, um sich des Anblicks seines derben Kauens zu entledigen.
Ganz anders dagegen die Römer. Ein echter römischer Honoratius, der sich mit einem kurzen Snack niemals begnügt hätte, unterteilte sein Mahl in Convivium und Comissatio, um doppelt genießen zu können. Und da die häusliche Cena mit Frau, Sohn und Tochter allein sein Geselligkeitsbedürfnis kaum befriedigt hätte, galt ein Essen unter neun Personen als unvollständig. War die Zahl der Musen (Klio, Kalliope, Melpomene, Thalia, Urania, Erato, Eutepe, Terpsichore und Polyhymnia) erreicht, konnte es losgehen, alle drei Triklinen waren besetzt bzw. belegt. Doch auch bei diesem kleinen Kreise konnte es nicht bleiben, nachdem die entwicklungsgeschichtlich höchst bedeutende Stufe des römischen Kaiserreichs erklommen war: Das Massenmahl wurde erfunden. Für den Kaiser Nero - ein subtiler Garant in Sachen distinguierter Kultivierung der Nahrungsaufnahme - wurden schon einmal 30 Tische zusammengestellt, um die 270 Schergen des Kaiserhofes adäquat verköstigen zu können. Und die Gastmähler des Kaisers Claudius - ebenfalls kein Kostverächter - durften nicht unter 600 Teilnehmer fallen (Suet. Claud. 32,1), ohne den Charakter des Privaten zu bekommen, obwohl sie mit einer Großveranstaltung eines revolutionären Religionsführers im fernen Palästina nicht konkurrieren konnten: Angeblich soll Jesus Christus beim Gastmahl zu Betsaida 5.000 Hungernde verköstigt haben (vgl. Lk. IX,10-17; Mt. XIV,13-21; Mk. VI,31-44 und Joh. VI,6-13).
Eine Selbstverständlichkeit, daß es auf Grund der veränderten Speisegewohnheiten zu baulichen Maßnahmen kommen mußte: Das republikanische Atrium wurde endlich überwunden, das Triklinium - eine Art antike Freßhalle - wurde fortan zum Mittelpunkt jeder kaiserlichen Villa in und um Rom. Auch neue Tischmoden kamen auf und sorgten für Gesprächsstoff: Die „Mensa Citrea“ entsprach mit ihrem schmalen Bein, den zierlichen Füßen in Form von drei Tierklauen und der geschwungenen runden Tischplatte dem neuen Lebensgefühl der Leichtigkeit mehr als die schweren niedrigen Tische, an denen noch der Agrarromantiker Cato und der Tugendprediger Cicero zu speisen pflegten.
1. Das Convivium
Als Beitrag zur Eß- und Trinkforschung, einem vielversprechenden neuen Zweig der Altertumswissenschaften, kann nun, dank intensiven Quellenstudiums und einer exorbitanten Feldforschung ein authentischer Blick auf das Hauptereignis geworfen werden: Das Mahl als solches. Betritt der antike Gast das Haus seines Gastgebers - stets mit dem richtigen Bein voran, den nur das rechte Bein bringt Glück ins Haus - kommt ihm sogleich der sog. „Nomenclator“ entgegen. An ihn muß der Gast sich halten, da nicht wenige Römer infolge des täglichen Alkoholgenusses nicht mehr wußten, wie sie hießen. Um der Verwirrung der Namenlosigkeit vorzubeugen, hatte der Nomenclator eine wichtige soziale Aufgabe, indem er den Gästen die angemessenen Plätze zuwies. Sobald man sich auf dem richtigen Platz niederlegte, konnte der mitgebrachte Sklave in die Küche geschickt werden (Sen. De benef. 3,27,1). Zuweilen beließ man ihn auch hinter der Trikline, zumal, wenn nicht gerade Staatsgeheimnise und ähnliche Privata der Oberschicht behandelt wurden. Ohne Begleitung ging ein Aristokrat jedoch niemals auf die schon damals gefährlichen römischen Straßen, und in Ermangelung eines Stadtplans oder prägnanter Straßennamen oblag es dem Diener, für einen sicheren Abgang zu sorgen.
Nun, nach der Ankunft aller Gäste, gesellten sich seltsame Vögel, sog. „rara avis“, zu der versammelten Gesellschaft: Die Umbrae treffen ein. Schatten sind sie, keiner eigenen Existenz mächtig, Abhängige fremder Personen, denen sie nachlaufen und nach dem Munde reden. Als Gäste der eigentlichen Gäste mußten sie dem Hausherren extra zuvor angemeldet werden, oder dieser versah seine Einladung mit dem speziellen Vermerk: „Schatten erlaubt“ (Hor. Epist. 1,5,30). Jetzt hätte eigentlich aufgetragen werden können, wenn als dritte im Bunde nicht noch die Clientes aufmarschiert wären. Als freie Einwohner Roms waren sie zwar besser gestellt als die Umbrae, konnten aber kein eigenes Einkommen aufweisen und waren daher auf Durchfütterung angewiesen. Mit künstlerischen Darbietungen verschiedenster Genres gelangten einige zu freilich recht zweifelhaftem Ruhm, wie zeitweise Martial, der als Dichter die künstlerische Leitung berühmter Gastmähler inne hatte. Ihre tatsächliche Funktion erschöpfte sich keineswegs darin, die Freizügigkeit ihres Gastgebers öffentlich zur Schau zu stellen, wovon die ältere sozialgeschichtlich geprägte Forschung irrtümlich noch ausging. Bedeutsamer war dem eben auch immer ökologisch denkenden Römer schon damals die Frage der verträglichen Abfallbeseitigung. So gelang es, die Clientes an einem Sondertisch neben der feinen Gesellschaft mit Essensresten zu bewirten. Dank der den Südländern eigenen Großzügigkeit wuchs die Zahl der Clientes mehr und mehr an, es galt schließlich während der Kaiserzeit als schick, als Parasit oder Mitesser durchs Leben zu wandeln. Endlich kann es losgehen, der „Triclinarius“ betritt die Bühne des Geschehens und beginnt, den Tisch mit Eßplatten, Gläsern und Messern zu bedecken. Damit dem Triclinarius auch kein Fehler unterläuft - denn die Kunst der gekonnten Bewirtung ist ein subtiles und ausdifferenziertes Fach, an dem schon bedeutende Persönlichkeiten ihr Scheitern eingestehen mußten - gab es sicherheitshalber noch den „Triklinarchus“. Dieser sorgte für den zeitlichen Ablauf der Speisen und war der Ansprechpartner für etwaige Sonderwünsche, denn einige Vegetarier konnten sich selbst im fleischigen Rom hartnäckig halten. War die erste Speise zubereitet - nach alter Sitte bäuerlicher Herkunft ein frisches Ei -, trug der Koch dieses Ei auf einer Silberplatte in den Speiseraum und sprach ein paar Worte zu Art und Weise der vorgezauberten Köstlichkeit. Während hinter der Bühne ausschließlich Sklaven und Sklavinnen schufteten, war der Koch oftmals ein Freigelassener. In seiner Stellung unangefochten repräsentierte er das Haus seines Herren nach außen und stand im Ruf eines Künstlers. In vielen populären antiken Theaterstücken wurde er zu einer wichtigen Figur, das Sujet „Kochkomödie“ war zeitweise äußerst beliebt. Er war es, dem die Feinheiten der Küche oblagen, seine Ideen waren es, die die römische Küche zu einer Institution machten und der wir heute gedenken. Dem Koch auf den Fersen folgte der „Scissor“. Mit einem scharfen Messer schnippelte der Meister der Schere aus den noch ungeteilten Schweinen, Ochsen und Flugtieren kleine mundgerechte Häppchen, die je nach Mundgröße und Gebißstärke des einzelnen Gastes variierten. Wie man sich denken kann, eine verantwortungsvolle Aufgabe. Denn in Fällen, in denen ein Gast an solchen Häppchen erstickte, hatte der Scissor die Orkusreise ebenfalls anzutreten. Einem gut ausgebildeten Scissor wäre ein solcher faux pas jedoch kaum passiert, hatte er doch eigens die Fleischschneideschule erfolgreich durchlaufen, wo er sich an geeigneten Holzmodellen übte, bis am Tag der Prüfung mehrere Tiere in höchst unterschiedlicher Weise künstlerisch zu zerlegen waren. Schwein, Fisch, Hammel, Pferd, absonderlichstes Federvieh: Alles kam unters Messer. Nicht jedoch Rinder, die als „Kameraden des Ackers“ verschont blieben. Kein Wunder, daß nur die härtesten und tüchtigsten Männer eine solche Kaderschmiede überstanden. Hatte man aber sein Zertifikat in der Tasche, war der Erwerb gesichert, und Meister der Küche wie beispielsweise der Syrier Tnypherus waren stadtbekannt und hatten ihren Preis.
2. Die Comissatio
Schnell verflog die Zeit, die für die ersten zwölf Gänge benötigt wurde, da man möglichst schnell zur Comissatio übergehen wollte. Die wörtliche Übersetzung lautet etwa „nächtliches Umherschwärmen“, da nun noch einmal verspätete Gäste ausnahmsweise Zutritt bekamen. Die Comissatio ist der feuchtfröhliche Umtrunk nach dem Essen, das trotz des oben geschilderten Aufwandes lediglich als Vorspiel zu dem nun folgenden Hauptakt zu verstehen ist. Denn mit der Comissatio begann für den Römer das wahre Leben, die Mühen des schon damals sorgenreichen Tages wurden mit einem Male (Mahle) hinweggespült. Damit auch jeder richtig mittut und keiner kneift, wurde ein Komment aufgestellt, das in eigenartiger Hierarchie die tatsächlichen sozialen Beziehungen ironisch reflektierte. Der Name „Mos Graecus“ erinnerte noch einmal an die griechische Gleichheit aller Teilnehmer und verwarf jede Rücksicht auf Rang und Herkunft. Jetzt wählte man in freier Abstimmung unter Verzicht des Fraktionszwangs in echt demokratischer Gesinnung den Oberzecher, dem der schillernde Name „Magister Bibendi“ oder „Arbiter Bibendi“ verliehen wurde. Es versteht sich von selbst, daß nur geübte Trinker eine reelle Chance hatten, sich in der Wahl durchzusetzen. Einmal gewählt, hatten sich jedoch alle übrigen Anwesende seinen Anweisungen zu unterwerfen. Den Wein zu mischen gehörte noch zu seinen harmlosesten Aufgaben. In die Amphore wurde Honig und Wasser dem Wein im Verhältnis drei zu eins beigegeben, um das bittere Gemisch überhaupt herunterzubekommen. Doch gewitzt holte man sich Rat bei den Medizinern: Diese empfahlen, gegen den Brummschädel den Kopf mit Kräutern zu salben und ihn mit einer Binde fest abzuschnüren. Daraus entwickelte sich der Lorbeerkranz, der allgemein zur Krone der Bacchianten wurde. Im Laufe eines Abends konnte dann infolge der Alkoholisierung und der einhergehenden Sinnesverstumpfung nach gewisser Zeit auf die Herstellung des süßen - aber teueren - Mulsum verzichtet werden: Der Wein wurde nun unvermischt getrunken. Neben der Bestimmung des Mischverhältnisses zählte die Festlegung der Menge zu den vornehmen Aufgaben des „Magister Bibendi“. Die Schalen, die der einzelne zu schlucken hatte, wurden unterschiedlich bemessen, je nach Laune des Oberzechers und der allgemeinen Stimmungslage. Wie man unschwer zu erkennen vermag, kam es schnell zu einigen peinlichen Vorkommnissen. So wurde das demokratische Prinzip ergänzt durch die Wiedereinführung des monarchischen-kaiserlichen Prinzips: Ein „Rex Bibendi“, meist der Hausherr selbst, beaufsichtigte nun den demokratisch legitimierten Oberzecher und beendete gegebenenfalls die gesamte Veranstaltung durch Hinauswurf. Da es auch schon damals Kneipen gab, mußte manche feuchte Zusammenkunft in den verrufenen Garküchen fortgesetzt werden. Für nicht wenige Zecher wurde die Taberne allerdings zur Endstation, sprichwörtlich wurde die Weissagung: „Amici, meum est propositum in taberna mori“, zu deutsch etwa: „Freunde, mein letztes Prost wird in der Taberne sein“.
3. Die Teilnahme von Frauen
Was ist aus den Frauen geworden? Unterwarf sich das schwache Geschlecht dem rüden Gebaren ihrer Männer? Auch bei noch so fortschrittlicher Entwicklung des Frauenrechts in der römischen Republik war die Stufe einer echten und zukunftsfähigen Gleichberechtigung noch nicht ganz erklommen. Frauen blieben auch in Rom lieber sitzen, die liegende Stellung verschmähten sie. Aber immerhin: War ihre Teilnahme beim Familienmahl bei den Griechen noch umstritten und Gegenstand einiger scharfsinniger Bemerkungen, so sahen die Römer ihre Anwesenheit bei Tische recht gerne (schwerwiegende Einwände gegen den Sittenverfall jedoch bei Suet. Calig. 24,1).
Die republikanischen Orgien allerdings fanden ganz ohne Anwesenheit der Ehefrauen statt, erst die Kaiserzeit brachte auch hier entscheidende Veränderungen. Wie war es dazu gekommen? Wenige unserer Zeitgenossen, die heute ahnungslos im Kreise der Familie zusammensitzen, wissen, was sie den Prostituierten zu verdanken haben! Sie waren es, die als die ersten Frauen die Ofenbank verließen und sich ihren rechtmäßigen Platz an der Seite des Mannes auch bei Orgien erkämpften (Suet. Calig. 24,1). Unter dem Vorwand der „künstlerischen Darbietung“ verschafften sich Frauen mit höchst zweifelhaftem Ruf Zugang zum Feste zunächst als Tänzerinnen, Deklamatorinnen oder Sängerinnen. Ihrem Beispiel folgten zögernd die Ehefrauen, bis ihre Teilnahme im Laufe der Zeit eine Selbstverständlichkeit wurde, die man(n) nicht mehr missen wollte. Selbst in hohen Adelskreisen war ein Gelage ohne die Konsularsfrauen nunmehr eine recht fade Sache, denn die Römer hatten erkannt, daß die rechte Würze des Ehebruchs darin bestand, von der eigenen Frau beobachtet zu werden (so argumentiert Tac. Ann. 16ff.). Da war der Schritt nicht weit, sich das Mahl selbst durch die Anwesenheit kleiner Mädchen oder Knaben zu versüßen (Liv. 39, 43,3). Das demokratische Prinzip bei der Comissatio trieb auch hier seine Blüten, nachdem auf das aktive Wahlrecht der Frauen das passive Wahlrecht folgte. Endlich ist nun eine Regina Bibendi möglich wie die unsterbliche Postumia, deren Trinkfreude manchen gestandenen Römer in arge Bedrängnis gebracht haben soll (Catull, Gedichte, 45). Solche weibliche Unterhaltung wurde ergänzt durch Einschübe der Clientes, die nun zu Hochform aufliefen: Pantomime, Akrobatik, Schauspiel, sportliche Einlagen oder dichterische Lesungen - es gab keine künstlerischen Ausdrucksweise, die sich nicht zur Untermalung der Comissatio geeignet hätte. Selbst vor Gladiatorenkämpfen im Eßzimmer wurde nicht zurückgeschreckt, eine regelrechte Manie um 300 v. Chr. (Liv. 9, 40,17).
4. Zwei „case studies“: Der römische Aufsteiger Trimalchio und das Hochzeitsmahl des Lucian
Große Persönlichkeiten römischer Gaumenfreude sind unvergeßlich in das Kochbuch der Geschichte verewigt: Wir denken an Trimalchio, den König der Dekadenz, wir denken an Lucullus, den Kaiser der Verfeinerungen und wir denken an Apicius, den Märtyrer der Genußsucht. Die crème della crème der römischen Aristokratie nahm an ihren Veranstaltungen teil, eines ihrer gelungenen Festessen war ein Tagesgespräch für Wochen. Dagegen hat sich aus der griechischen Gastronomie keine Persönlichkeit in unser kulturelles Bewußtsein verewigen können. Es soll nun anhand zweier „case studies“ der kulturelle Fortschritt von den Griechen zu den Römern hinsichtlich des Gastmahles aufgezeigt werden.
Der Grieche Lucian von Samosata wollte seine Mitmenschen mit einem Mahl, das im Hause des Aristänetus stattfand, erfreuen. Anlaß war die Hochzeit seiner Tochter Kleanthis mit dem Bankierssohn Eukritus, der die vielversprechende Laufbahn eines Philosophen eingeschlagen hatte und dem es sogleich solidarisch gelang, weitere Philosophen dem gedeckten Tische zuzuführen. Besonders die Epikureer, die den philosophischen Überbau zu dem Essen lieferten, ließen sich nicht zweimal bitten. Ihr Vertreter Hermon war zudem noch Dioskurenpriester, da das theologische Amt schon in antiken Zeiten enge Bindung zum kulinarischen Fach aufwies. Aber auch andere Denkrichtungen lassen sich unter den Gästen ausmachen: Wir lernen den Stoiker Zenothemis kennen, der eine aufregende Schrift nach der anderen verfaßte, wir machen Bekanntschaft mit Diphilus. Der wurde von seinen Freunden Labyrinthus genannt, wegen seiner undurchschaubaren verwinkelten philosophischen Gedankengänge. Kaum der Erwähnung wert, daß sich ein solcher Labyrinthus natürlich bestens als Hauslehrer eignete und den Zögling Zeno für die Philosophie begeisterte. Für nichts kann man sich ein Leben lang begeistern, als für das, was man nicht versteht. Die Gesellschaft wird komplett mit dem Platoniker Jon, dem Grammatiker Histiaus und dem Dauerredner Dioysodorus. Der Zyniker Alcidames, der seiner Philosophie gemäß außerhalb der menschlichen Ordnung lebte, saß als einziger nicht bei Tische, sondern ging während des gesamten Essens im Raum auf und ab, ein Ausdruck seiner gelebten Philosophie. Nachdem ein Zwerg, der für Belustigung und Ablenkung sorgte, abtrat, brachen die unterschiedlichen Ansichten der Philosophen auf: Über die Sitzordnung konnte man sich nicht einig werden. Die Schuld muß dem Stoiker gegeben werden, der es nicht ertrug, unterhalb eines Epikureers platziert zu sein. Der Stoiker zettelte einen Streit an, indem er dem Epikureer die fettere Gans vom Teller wegzog, so daß der idyllisch begonnene Hochzeitstag in einer wüsten Massenschlägerei endete (Luc. Conv., S.131-149).
Der Römer Trimalchio dagegen war beileibe kein degenerierter Asiat, wie ihn die zu streng urteilende Wissenschaft gerne sehen möchte. Als ehemaliger Sklave kannte er die Sorgen des unfreien Volkes genauestens und ließ daher bei der Unterdrückung der eigenen Sklaven alles beim Alten. Als Mitglied des von Kaiser Augustus geschaffenen Sechserrates vertrat er, im Interesse der Freigelassenen, nicht allzuviele Sklaven freizulassen. Sein sagenhaftes Vermögen, mit denen seine Gastmäler finanziert wurden, war durch ehrlichen Großkapitalismus zustande gekommen. Er war als „Saplutus“ gefürchtet und geachtet. Trimalchio setzte es durch, den Sechserrat in seiner Villa tagen zu lassen, und scheute dafür weder Aufwand noch Kosten, um sein Amt würdig zu repräsentieren. In seinem Haus verkehrten neben Echion, einen Fabrikanten von Feuerwehrrequisiten, und dem Juristen Agamemnon auch die Ehefrauen der Gäste. Diese besondere Erlaubnis, die nicht unwesentlich dem Einfluß Fortunas, der Gattin Trimalchios, zu verdanken war, war eine ganz neuartige Erscheinung in der antiken Eßgeschichte. Da saßen nun auf einer Bank, in unmittelbarer Nähe der Männer, die Ehefrauen, „wo sie sich küßten, ihre Köpfe zusammensteckten und Übermütigkeiten trieben“ (Petr. Sat. 67, 11-67). Unterhaltung gewährleistete der zu seiner Zeit berühmte Schauspieler Syrus, einige Akrobaten und absonderliche Riesen und Zwerge, die bei keinem Convivium fehlen durften. Ebenso unverzichtbar waren die Homeristen, die Epigonen Homers, welche so bekannte Stücke wie „Diomedes“ oder „Ganymedes“ eigens als lyrischen Beitrag zum kulinarischen Beisammensein aufführten. Ihnen gelang es, schauspielerische Dramaturgie und den Ablauf des Mahles in Einklang zu bringen, ein Höhepunkt antiker Dichtkunst war geboren. Langwierige und tiefschürfende Beiträge waren dagegen eher ins Hintertreffen geraten, der Sinn stand glücklicherweise nach Leichtem und Bekömmlichem. Das Mahl endete meist mit einem gemeinschaftlichen Rülpsen, da es nach Rat der antiken Philosophen als letztes Wort aller Weisheit galt, der menschlichen Natur zu folgen.
5. Die soziale Ausdifferenzierung des Gastmahles
Keineswegs war es so, wie schon angedeutet wurde, daß in geselligem Beisammensein alle gesellschaftlichen Schranken fielen. Das Gegenteil muß festgestellt werden: Jeder Platz hatte seine Bedeutung, alles war zeichenhaft besetzt, für jede erdenkliche Eventualität hatte das Sitzreglement vorgesorgt. Drei Triklinen zu jeweils drei Plätzen waren zu besetzen: „Imus Lectus“, „Medius Lectus“ und „Summus Lectus“. Das letzte war kein Hochbett, sondern diejenige Trikline, die neben dem mittigen Medius Lectus rechts stand. Auf der gegenüberliegenden linken Seite befand sich der Lectus Imus, und komplett war das Hufeisen, das es damals freilich noch nicht gab. Jeder der Plätze hatte Vor- und Nachteile: Lag man an einem der beiden Enden des Hufeisens, so hatte man zwar den „Fulcrum“ genannten Ehrenplatz inne, war aber immer in Gefahr, von den von vorne bedienenden Sklaven besudelt zu werden. Am sichersten war man nach allgemeiner Ansicht auf dem mittleren Lectus. Hier war die Bedienung in angemessener Entfernung und alle Gespräche konnten gleich gut verfolgt werden. Andererseits machte der Gang zum „stillen Ort“ auf diesem Platz die meisten Schwierigkeiten, so daß ein echter Römer sich auch hier Mittel der Abhilfe besorgte, indem er sich mittels einen nahestehenden Eimer Erleichterung verschaffte.
Der höchste Ehrenplatz befand sich auf dieser Trikline, nämlich auf dem dritten Platz. Dieser wurde als „Locus Consularis“ bezeichnet, obwohl nicht immer ein Konsular auf ihm zu liegen pflegte. Schwierigkeiten, die das Stattfinden des Gastmals in Frage stellen konnten, entstanden, wenn zwei Konsulare auftauchten oder gar keiner. Im letzteren Falle mußte der ranghöchste Anwesende ermittelt werden, was keine einfache Sache gewesen war. Man beließ es dabei, den Konsularsplatz freizuhalten, da es auch zu beträchtlichen Schwierigkeiten gekommen war, einen besetzten Platz wieder freizumachen, wenn zu später Stunde doch noch ein Konsular hereingeschneit war. Den freien Sitzplatz haben sich übrigens die Urchristen abgeschaut, die bei nächtlichen Katakobenspeisungen stets einen Sitz für den eventuell noch kommenden Herrn freizuhalten pflegten. Waren nun jedoch zwei Konsulare bei Tische, so machte man den zweiten Ehrenplatz frei, nämlich den ersten Platz des Imus Lectus. Dieser Platz war dem Hausherrn vorbehalten, der bei so hohen Gästen gerne etwas zur Seite rutschte. Die Anwesenheit dreier Konsulare konnte ausgeschlossen werden, da es stetes nur zwei Amtsinnhaber gab.
Schluß
Was man aß, war in der Antike unwichtig, ja vernachlässigenswert, denn der Erfolg oder Mißerfolg eines Gastmahles zeigte sich ausschließlich in der gelungenen Abfolge des Speisezeremoniells und in der Präsenz bestimmter Gäste - oder dem Fehlen bestimmter Gäste. All diese Rangstreitigkeiten und soziale Ausdifferenzierungen haben dazu beigetragen, daß die römische Gesellschaft um spätestens 500 in eine ernstzunehmende Sinnkrise geriet. Erst die gleichberechtigte germanische Rittertafel nach dem Modell König Artus leitete hier nicht nur ein neues Kapitel der Eßkultur ein, sondern auch das Ende der Römer. Fragen wir kritisch „was blieb?“, so müssen wir konstatieren, daß sich wenige Elemente der antiken Geselligkeit in unsere moderne Zeit hinüberretten konnten. Aus dem „Symposion“ - dem griechischen Gastmahl - wurde eine rhetorische trockene Veranstaltung, und aus der Exkursion - was wörtlich aus dem Lateinischen mit „Saufgelage“ zu übersetzen ist - wurde ein wissenschaftlicher Ausflug.
Quellenverzeichnis:
Catull: Gedichte. Hg. von Rudolf Helm. Berlin 1963 (Schriften und Quellen der alten Welt, Bd.XII).
Horaz: Satiren und Episteln. Hg. von Otto Schönberger. Berlin 1991 (2).
Livius: Römische Geschichte. Hg. von Hans Jürgen Hiller. München 1983.
Lucian: Werke. Hg. von Theodor Fischer. Berlin 1900 (Langenscheidtsche Bibliothek sämtlicher griechischer und römischer Klassiker in neueren deutschen Muster-Übersetzungen, Bd.XXXV).
Seneca: Moral Essays. London 1964 (2) (The Loeb Classical Library, Bd.CCCX).
Suetonius . London 1950 (5) (The Loeb Classical Library, Bd.XXX,1).
Petronius : Cena Trimalchionis. Gastmahl bei Trimalchio. Hgg. von Konrad Müller, Wilhelm Ehlers. München 1988 (3).
Tacitus : Annales. Hg. von E. Heller. München 1982.
Sekundärliteratur:
Alföldi-Rosenbaum, Elisabeth: Das Kochbuch der Römer. Rezepte aus der "Kochkunst" des Apicius. Stuttgart 1970.
Baltrusch, Ernst: Regimen morum. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit. München 1988 (Vestiga, Bd.XLI).
Blanck, Horst: Einführung in das Privatleben der Griechen und Römer. Darmstadt 1976.
Bockisch, Gabriele: Essen und Trinken im alten Rom. In: Altertum, Bd.XXXIV, 1988, S.87-95.
Hagenow, Gerd: Aus dem Weingarten der Antike. Mainz 1982.
Kirchner, Karl Hermann: Die sakrale Bedeutung des Weines im Altertum. Gießen 1910.
Kleberg, Tönnes: In den Wirtshäusern und Weinstuben des antiken Rom. Darmstadt 1963 (Lebendiges Altertum. Populäre Schriftenreihe für Altertumswissenschaft, Bd.XII).
Lauffer, Siegfried: Diokletians Preisedikt. Berlin 1971 (Texte und Kommentare, Bd.V).
Marquardt, Joachim; Mau, August: Das Privatleben der Römer. Bdd.II. Leipzig 1886 (2). ND Darmstadt 1975.
Staesche , Monika: Das Privatleben der römischen Kaiser in der Spätantike. Studien zur Personen- und Kulturgeschichte der späten Kaiserzeit. Bern 1998 (Serie: Europäische Hochschulschriften, Reihe 3, Bd.DCCLXXXIV).
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text über antike Gastmähler?
Der Text ist eine umfassende Untersuchung antiker römischer Gastmähler, insbesondere des Conviviums und der Comissatio. Er beleuchtet die Teilnehmer, Rituale, soziale Bedeutung und kulturellen Unterschiede im Vergleich zu griechischen Gastmählern.
Was sind Convivium und Comissatio?
Das Convivium war das Hauptmahl, ein geselliges Essen mit Gästen. Die Comissatio war der feuchtfröhliche Umtrunk nach dem Essen, oft mit verspäteten Gästen und unter der Leitung eines "Magister Bibendi".
Welche Rolle spielten Frauen bei römischen Gastmählern?
Ursprünglich waren Frauen bei Gastmählern weniger präsent, besonders bei den republikanischen Orgien. Die Kaiserzeit brachte jedoch Veränderungen, wobei Prostituierte und später auch Ehefrauen zunehmend an den Festen teilnahmen.
Wer waren die "Umbrae" und "Clientes"?
Die "Umbrae" (Schatten) waren abhängige Personen ohne eigene Existenz, die den Gästen nachliefen. Die "Clientes" waren freie Einwohner Roms ohne eigenes Einkommen, die auf die Durchfütterung angewiesen waren und oft mit Essensresten bewirtet wurden.
Welche Rolle spielten Köche und "Scissores"?
Der Koch war oft ein Freigelassener und repräsentierte das Haus seines Herren. Der "Scissor" war ein Fleischschneider, der mundgerechte Häppchen aus großen Fleischstücken schnitt.
Was war die Bedeutung des "Magister Bibendi"?
Der "Magister Bibendi" (Oberzecher) wurde demokratisch gewählt und legte die Regeln für den Umtrunk fest, einschließlich des Mischverhältnisses von Wein und der Menge, die jeder trinken musste.
Wie war die soziale Hierarchie bei Gastmählern geregelt?
Die Sitzordnung war streng geregelt, wobei jeder Platz (Imus Lectus, Medius Lectus, Summus Lectus) eine bestimmte Bedeutung hatte. Der "Locus Consularis" war der höchste Ehrenplatz.
Welche "case studies" werden im Text behandelt?
Der Text vergleicht das Hochzeitsmahl des Lucian (griechisch) mit den Gastmählern des römischen Aufsteigers Trimalchio, um den kulturellen Fortschritt zu veranschaulichen.
Wer waren Trimalchio, Lucullus und Apicius?
Trimalchio war ein König der Dekadenz, Lucullus ein Kaiser der Verfeinerungen und Apicius ein Märtyrer der Genußsucht, allesamt bekannte Persönlichkeiten römischer Gaumenfreude.
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen griechischen und römischen Gastmählern laut diesem Text?
Die Römer legten Wert auf opulentere Gastmähler mit aufwendigen Zeremonien, während die Griechen anfangs bescheidener waren. Der Text argumentiert, dass römische Gastmähler eine größere soziale Ausdifferenzierung und eine stärkere Einbeziehung von Frauen aufwiesen.
Welche Quellen und Sekundärliteratur werden im Text verwendet?
Der Text bezieht sich auf eine Vielzahl antiker Autoren wie Catull, Horaz, Livius, Lucian, Seneca, Suetonius, Petronius und Tacitus. Zudem werden verschiedene Werke moderner Historiker und Altertumswissenschaftler zitiert.
- Quote paper
- Walter Kögel (Author), 1992, Ein Beitrag zur antiken Eß- und Trinkkultur: Convivium und Comissatio, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104093