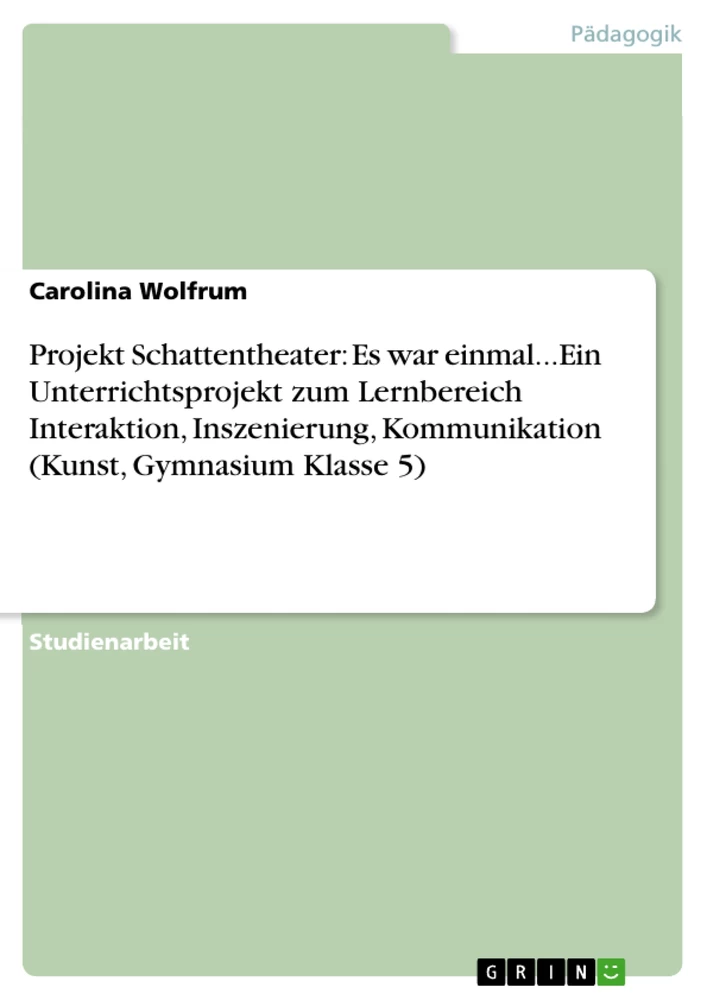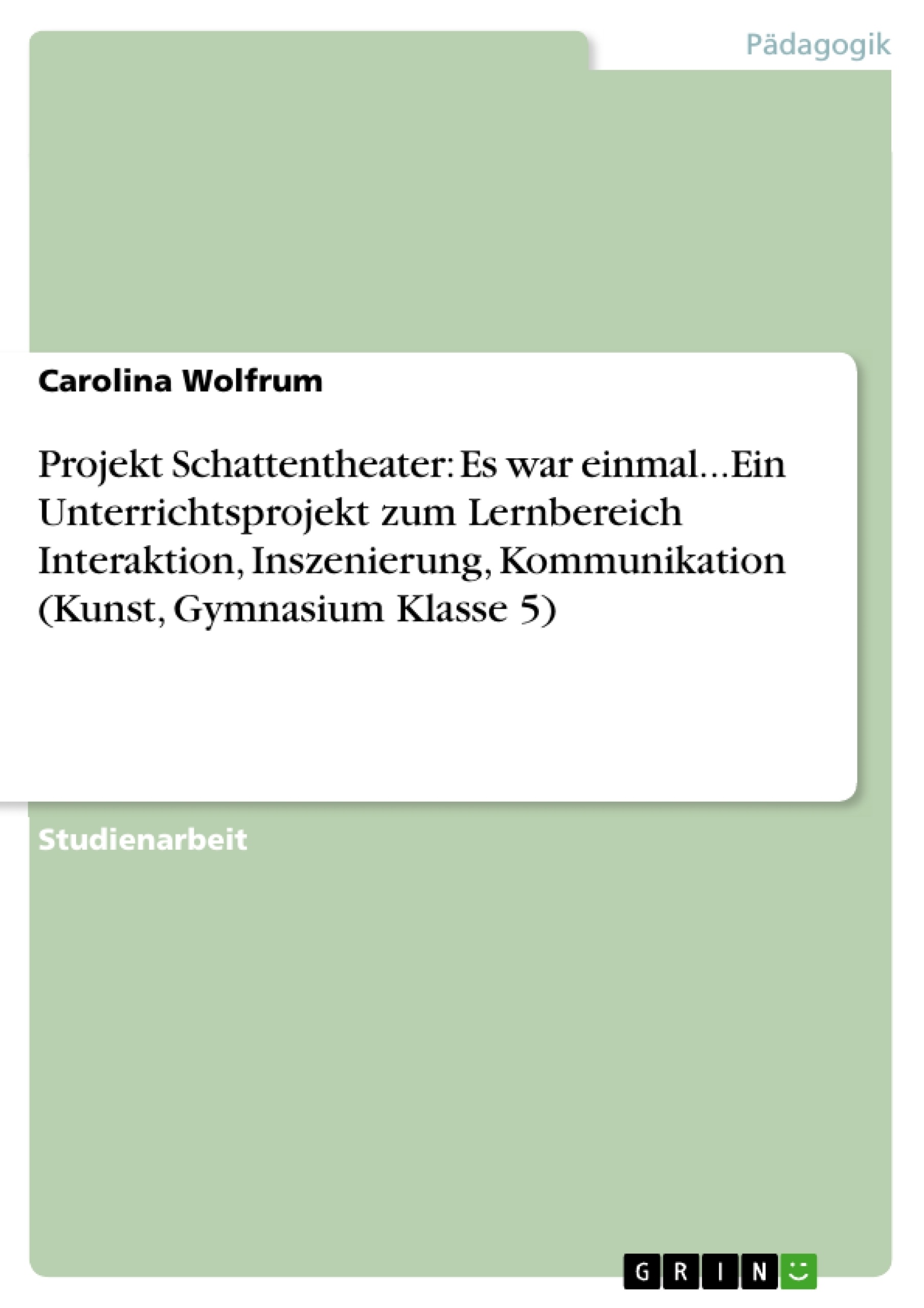In dieser Arbeit wird eine Einsatzmöglichkeit des Schattentheaters in der Schule in Form eines fächerübergreifenden Gruppenprojektes vorgestellt. Dabei soll den folgenden Fragen nachgegangen werden: Welche Vor- und Nachteile ergeben sich für das Fach Kunst durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit? Was können die Schülerinnen und Schüler (im Folgenden SuS) durch das Gruppenprojekt „Schattentheater“ lernen? Und ist ein solches Projekt dieser Größenordnung überhaupt mit den Einschränkungen der COVID-19-Pandemie sinnvoll umsetzbar?
Bevor ein Versuch der Beantwortung dieser Fragen unternommen wird, soll sowohl ein kurzer Einblick in die Tradition des Schattenspiels als auch das durchgeführte Unterrichtsprojekt inklusive didaktischer Vorüberlegungen gewährt und entwicklungspsychologische Aspekte vorgestellt werden.
Das Spiel mit Licht und Schatten fasziniert die Menschen schon seit Beginn ihrer Geschichte. Sei es durch das flackernde Lagerfeuerlicht, welches unheimliche Schatten an der Wand erscheinen lässt, durch die magische Laterne im Kinderzimmer oder durch an die Wand gezauberte Handschattenfiguren. Der Schatten deutet das Abbild einer Figur an, ohne alles zu verraten. Somit lässt er Raum für Fantasie und Interpretation. In Platons Höhlengleichnis erhält der Schatten die Bedeutung des Trugbildes einer Wirklichkeit, welche zu komplex ist, als dass sie von den Menschen verstanden werden könnte.
Das Spiel mit Material und Licht zog auch mich von Kindesbeinen an in seinen Bann und fand im Zuge meiner Ausbildung zur Bühnenmalerin im Theater ihren Höhepunkt. Denn das Zusammenspiel dieser beiden untrennbaren Gegensätze machen sich die Bühnen dieser Welt zunutze – im Besonderen das sogenannte Schattenspiel oder auch Schattentheater. Dieses geht auf eine über zweitausendjährige alte Tradition aus dem asiatischen Raum zurück und erfreut sich auch heute noch der aktiven Anwendung. Es fasziniert nicht nur die Beobachter, sondern fördert bei den aktiv Beteiligten zahlreiche Kompetenzen durch den Prozess des Entdeckens, Ausprobierens und Experimentierens. Gerade in sozialpädagogischen Bereichen ist diese Darstellungsform deshalb von enormem Interesse. Nicht umsonst ist das traditionelle Schattentheater von der UNESCO in der Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit sowie auch im Lehrplan der bayerischen Gymnasien aufgenommen worden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein kurzer Blick in die Geschichte des Schattenspiels
- Entwicklungspsychologische Aspekte
- Didaktische Vorüberlegungen
- Fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsziele sowie Kompetenzen
- Einbettung des Themas in Fachlehrplan und Unterrichtssituation
- Allgemeine Unterrichtsziele
- Schattenspiel als fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt
- Vorbereitung & Organisation des interdisziplinären Konzepts
- Erste Unterrichtseinheit: Hinführung und experimentelle Schattenspiele
- Zweite Unterrichtseinheit: Die eigene Geschichte entwickeln
- Dritte Unterrichtseinheit: Der Stabschattenfigurenbau
- Unterrichtsverlauf während des Lockdowns
- Evaluation und Reflexion
- Analyse von Einzelbeispielen
- Auswertung der Umfrageergebnisse
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Durchführung eines fächerübergreifenden Unterrichtsprojektes zum Schattentheater in der 5. Jahrgangsstufe eines Gymnasiums. Es werden didaktische Überlegungen, die Relevanz des Schattentheaters für die Entwicklungspsychologie der SuS und die Umsetzbarkeit des Projektes unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie beleuchtet.
- Die didaktischen Möglichkeiten des Schattentheaters im Kunstunterricht
- Entwicklungspsychologische Aspekte der SuS in der 5. Jahrgangsstufe
- Fächerübergreifende Kompetenzen und Bildungs- und Erziehungsziele
- Umsetzbarkeit eines Projekts unter Lockdown-Bedingungen
- Evaluation und Reflexion des Projektes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert das Sprichwort „Wo Licht ist, ist auch Schatten“ und erläutert die Bedeutung des Schattenspiels im Kontext der Geschichte und der Pädagogik. Sie stellt die Forschungsfragen der Arbeit vor.
Kapitel 2 bietet einen kurzen Einblick in die Geschichte des Schattenspiels, beginnend in Asien bis hin zur Verbreitung in Europa und Deutschland. Es werden die verschiedenen Arten von Schattentheater und deren Besonderheiten vorgestellt.
Kapitel 3 analysiert die entwicklungspsychologischen Aspekte des Schattentheaters für Kinder in der 5. Jahrgangsstufe und verdeutlicht die didaktischen Vorteile dieser Spielform.
Kapitel 4 beschreibt die Planung und Durchführung des fächerübergreifenden Projektes „Schattentheater“ in Zusammenarbeit mit den Fächern Deutsch und Musik. Es werden die einzelnen Unterrichtseinheiten vorgestellt, die Umsetzung im Distanzunterricht erläutert und die Ergebnisse der Projektarbeit analysiert.
Kapitel 5 reflektiert die Ergebnisse des Projektes und beantwortet die eingangs gestellten Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Schattentheater, fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt, Interaktion, Inszenierung, Kommunikation, Entwicklungspsychologie, Bildungs- und Erziehungsziele, Kompetenzen, Distanzunterricht, COVID-19-Pandemie, Evaluation, Reflexion.
- Arbeit zitieren
- Carolina Wolfrum (Autor:in), 2021, Projekt Schattentheater: Es war einmal...Ein Unterrichtsprojekt zum Lernbereich Interaktion, Inszenierung, Kommunikation (Kunst, Gymnasium Klasse 5), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1040701