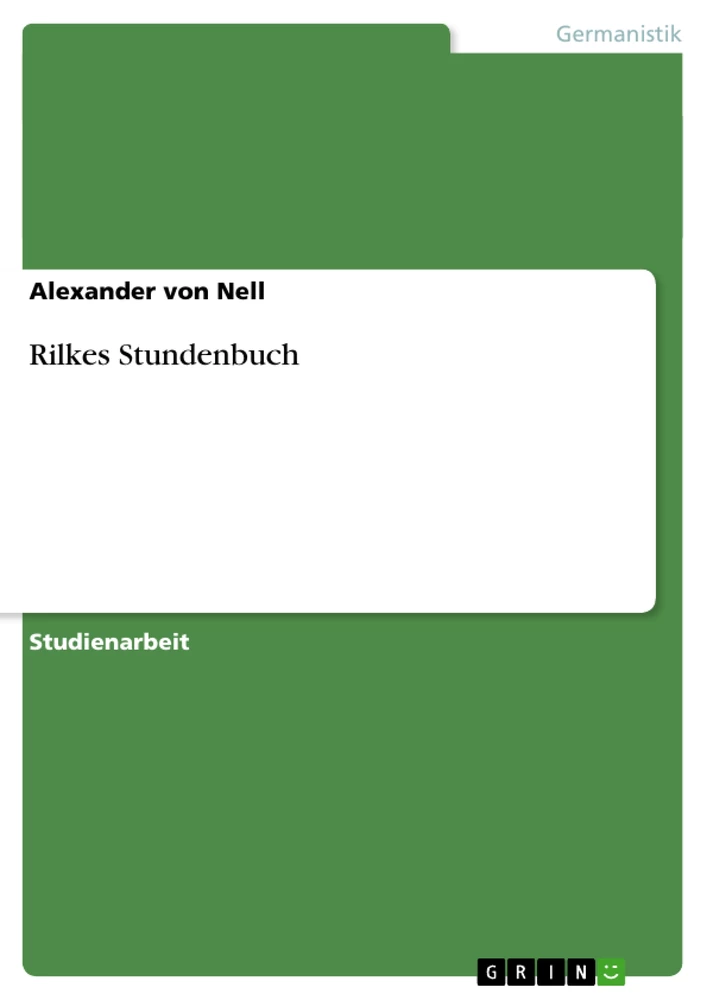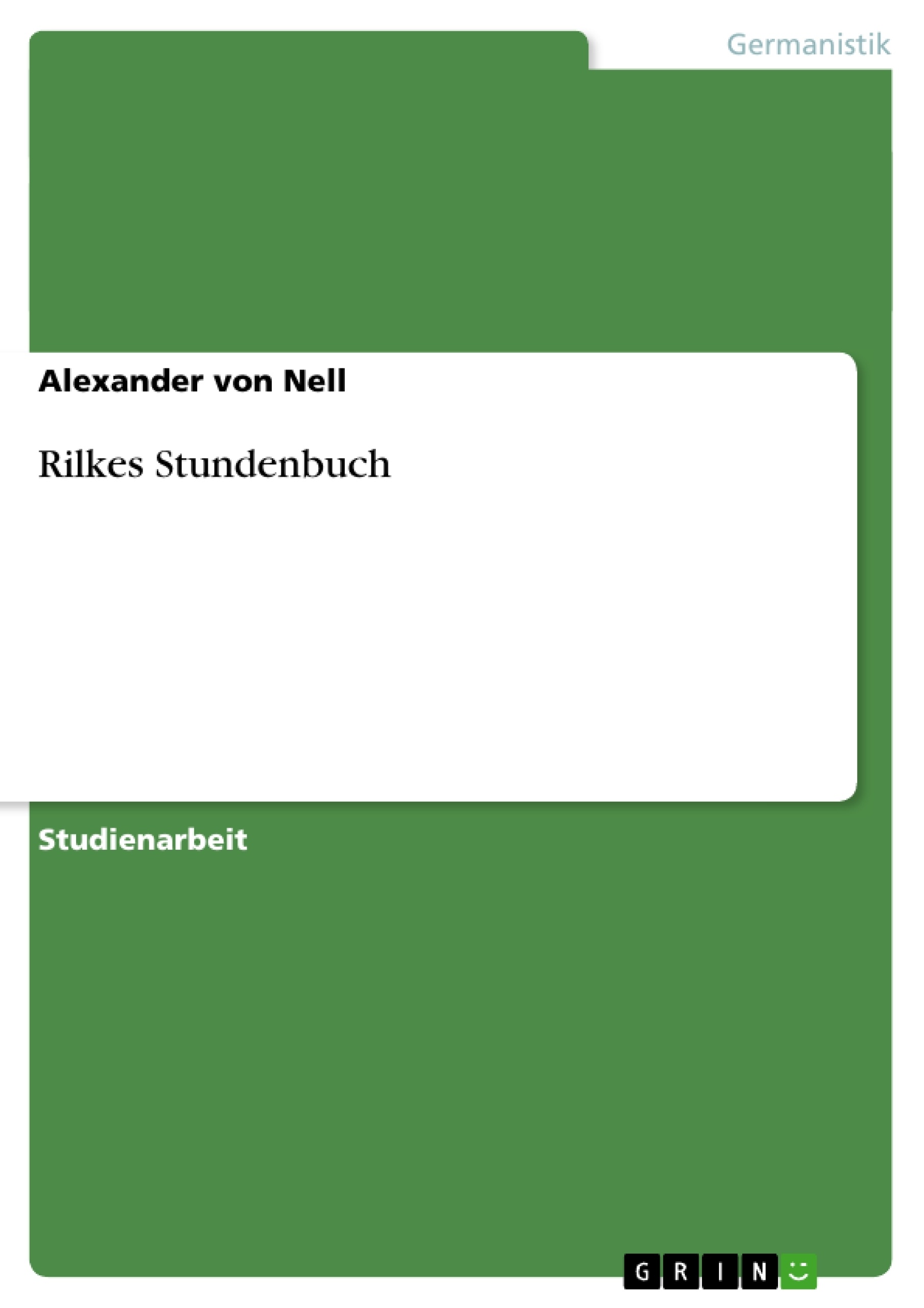Was bedeutet es, Gott im Spiegel der Kunst zu suchen? Rainer Maria Rilkes "Stunden-Buch" ist mehr als eine Sammlung von Gedichten; es ist eine intime Auseinandersetzung mit dem Göttlichen, ein lyrisches Gebet, das die Grenzen zwischen Schöpfer und Geschöpf verwischt. In diesem faszinierenden Werk, das aus drei Teilen besteht – "Das Buch vom mönchischen Leben", "Das Buch von der Pilgerschaft" und "Das Buch von der Armut und vom Tode" – begibt sich der Leser auf eine spirituelle Reise, die von Russland über Worpswede bis nach Paris führt. Rilke, beeinflusst von der Kunst des Jugendstils und der Tradition der mittelalterlichen Stundenbücher, erschafft ein einzigartiges Gottesbild, das von Dunkelheit und Stille geprägt ist, im Gegensatz zum Licht und Lärm Luzifers. Doch diese ungewöhnliche Perspektive verändert sich im Laufe der Sammlung, als sich das lyrische Ich von der "monistischen Naivität" entfernt und eine zunehmende Distanz zu Gott erfährt. Die apokalyptischen Vorstellungen des zweiten Buches weichen einer messianischen Vision im dritten, in der Franz von Assisi die Rolle eines greifbaren Ideals übernimmt. Diese Arbeit beleuchtet Rilkes lyrische Machart, seine kühnen Gottesprädikationen und die symbiotische Beziehung zwischen Künstler und Werk. Es ist eine Einladung, sich im Sinne des Künstlertums einen individuellen Gott oder eine eigene Religion zu erschaffen, jenseits traditioneller Dogmen und Konventionen. Rilkes "Stunden-Buch" ist somit ein zeitloses Zeugnis der menschlichen Suche nach Sinn und Spiritualität, ein inspirierendes Werk für alle, die sich nach einer tieferen Verbindung zum Göttlichen sehnen. Die ergreifende Poesie Rilkes, durchdrungen von innovativen Bildern und vielschichtigen Metaphern, eröffnet dem Leser einen neuen Zugang zu religiösen und philosophischen Fragen. Es handelt sich um eine spannende Analyse der Gottesbilder und -prädikationen, die das intensive Verhältnis des lyrischen Ichs zu Gott und dessen wandelnde Gestalt im Verlauf der drei Bücher eindrücklich darstellt. Ein essentielles Werk für Liebhaber der Lyrik, der Religionsphilosophie und der feinsinnigen Kunstinterpretation. Erleben Sie die kraftvolle Sprache Rilkes und lassen Sie sich von seiner tiefgründigen Suche nach dem Göttlichen berühren.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel I: Biographischer Hintergrund / Schaffensumfeld
Kapitel II: Rilkes Gottesbild
Kapitel II.1.i.: “Das Buch vom mönchischen Leben”
Kapitel II.1.ii.: Licht und Dunkelheit, Luzifer und Gott
Kapitel II.2.: “Das Buch von der Pilgerschaft”
Kapitel II.3.: “Das Buch von der Armut und vom Tode”
Kapitel III.: Erläuterung der lyrischen Machart
Kapitel III.1.: Anhand eines Gedichts aus dem ersten Buch
Kapitel III.2: Gottesprädikationen und -bilder in “Das Buch vom mönchischem Leben
Fazit
Literaturliste
“ Die Religion ist die Kunst der Nichtschaffenden. Im Ge- bete werden sie produktiv...Der Nichtkünstler muß eine Religion - im tiefinneren Sinn - besitzen, und sei es auch nur eine, die auf gemeinsamem und historischem Verein- baren beruht. Atheist sein in seinem Sinne ist Barbar sein. ” 1
Einleitung
“Das Stunden-Buch” von Rainer Maria Rilke (1875 - 1926) ist im Frühwerk des Lyri- kers viel beachtet. Durch die bewußt gewählte sprachliche Nähe zum Gebet kommt es in der literaturwissenscha ftlichen Betrachtung dieser Lyriksammlung häufig zu Arbeits- ergebnissen, die E. Heller als “Seelenschmöcken” bezeichnet.2 Diese entstehen dadurch, daß das Hauptaugenmerk auf den Erlebnishintergrund und die Leseerfahrungen des jun- gen Rilke gerichtet wird, ohne die lyrische Stil-Verfahren zu beachten. Vor allem ist “Das Stunden-Buch” der Versuch, sich von der reinen “Stimmungslyrik” zu lösen und eine neue Art der Lyrik zu erschaffen, die später von der Wissenschaft als “Dingge- dicht” bezeichnet wird und in der Sammlung “Neue Gedichte” (1907/1908 entstanden) ihren Höhepunkt findet.3 Durch die schon angesprochene Nähe zum Gebet knüpft der Autor an die romantische “Kunstreligion” an, die ihren Niederschlag zum Beispiel in Wackenroders “Herzensergießungen” zeigt. Auf dieser Folie kann Rilke den romant i- schen Dichtern folgend mit einem sprachlich neuen Typus von Gedichten experimentie- ren.
Inhalt der Arbeit soll es nicht sein, die verschiedenen von Rilke virtuos verwendeten Stilmittel, zu untersuchen. Vielmehr werde ich anhand der Gottesbilder und - prädikationen im “Stundenbuch” die Beziehung des lyrischen Ichs zu Gott und deren Veränderung durch die drei Bücher beleuchten.
Kapitel I: Biographischer Hintergrund, Schaffensumfeld
Rainer Maria Rilke beginnt sein dreiteiliges Werk “Das Stunden-Buch” am 20.09.1899. Zu diesem Zeitpunkt ist er gerade von der ersten Rußlandreise mit Lou Andreas-Salomé zurückgekehrt und nach Berlin gezogen.
Die erste Schaffensperiode an diesem Zyklus, in der “Das Buch vom mönchischen Leben” entsteht, endet am 14.10.1899. Zwei weitere kurze, zeitlich weit auseinander liegende, Arbeitsabschnitte folgen. Vom 18.09.1901 bis zum 25.09.1901 entsteht in Worpswede der zweite Teil: “Das Buch von der Pilgerschaft”. Kurz nach seinem ersten Parisaufenthalt schreibt Rilke vom 13.04.1903 bis zum 20.04.1903 in Viareggio “Das Buch von der Armut und vom Tode”.
Jeder Teil des Stundenbuchs zeigt eine individuelle Ausprägung, die unter anderem auf die zeitlich naheliegenden Erfahrungen zurückzuführen ist. So ist der Protagonist des ersten Teils ein russischer Mönch.4 Der zweite Teil beschäftigt sich ausgiebig mit Land- schaftsbeschreibungen und Gedanken über die “bürgerliche” Existenz, die Rilke durch seine Heirat mit Clara Westhoff in Westerwede zu gründen versuchte. Anfang des Jah- res 1901 befand sich Rilke, durch die Lebensbedingungen in Worpswede und seine neugewonnen Ansichten über das Arbeitsethos, in der “Zwischenland-Krise”5, deren Nachwirkungen im zweiten Buch noch spürbar sind. Der letzte Teil verarbeitet mit einer weitausholenden Huldigung der Armen die Erfahrung des Elends in der Großstadt Pa- ris.6
Im Titel der Lyriksammlung bezieht Rilke sich auf die mittelalterliche Tradition der “Livre d’heures”,7 Laienbetbücher, die nicht von der Kirche autorisiert, aber geduldet wurden. Vor allem im franko- flämischen Raum kam es zu einer hohen Blüte der Stundenbücher, die zum Teil prächtig ausgemalt waren.
Durch seine Mutter erhielt Rilke eine streng katholische Erziehung und besuchte eine von Pia risten geführte Schule. Als Erwachsener bezeichnet er die Bibel als eines von zwei Büchern, die er immer mit sich führt.8 So ist es nicht weiter verwunderlich, daß sich Rilke christlicher Symbolik und Bilder bedient, nur die Art und Weise ist erstaun- lich.
Um die Jahrhundertwende ist Rilke sehr produktiv. Er arbeitet an dem Beginn des “Stundenbuchs”, stellt die erste Ausgabe der Sammlung “Das Buch der Bilder” fertig, schreibt die später in der “Inselbibliothek” als Nr. 1 veröffentlichte Erzählung “Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke”, mehrere Prosawerke und seinen letzten dramatischen Versuch, “Das tägliche Leben”. Allerdings erscheinen nur wenige Werke zu dieser Zeit im Druck.9
Erstmals veröffentlicht wird “Das Stunden-Buch” 1905, zwei Jahre nach der Fertigstellung des letzten Teils. Sowohl die la ngjährige Beschäftigung mit diesem Werk, als auch die Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt zeugen davon, daß Rilke diesem Zyklus eine große Bedeutung beigemessen hat.10
Kapitel II: Rilkes Gottesbild
Kapitel II.1.1.: “Das Buch vom mönchischem Leben”
Zur Entstehungszeit des “Stundenbuchs” ist Rilke auf der Suche nach dem einzigen Prinzip, auf dem die Welt gegründet ist. Dieses Streben ist um die Jahrhundertwende sowohl in der darstellenden Kunst, als auch in der Literatur weitverbreitet.11 Er bezeic h- net dieses Prinzip als Gott und richtet Gebete an ihn,12 die in der jüdisch-christlichen Tradition zu stehen scheinen. Jedoch greift er jenseits des Sprachhabitus nicht auf diese Tradition zurück. Vielmehr erschafft er ein monistisches Weltbild, in dem er die göttli- che Sphäre sehr eng mit der menschlichen, durch Verwendung identischer Prädikatio- nen und Metaphern für beide Ebenen, verbindet. Bewußt verschleiert er die Bezüge durch unklare Verwendung von Pronomen. Beispielhaft sei dies am Gedicht Nr. 59 er- läutert:13
“Gott spricht zu jedem nur eh er ihn macht
dann geht er schweigend mit ihm aus der Nacht.
Aber die Worte, eh jeder beginnt,
diese wolkigen Worte sind: ”
Scheinen die Pronomen zunächst logisch verteilt und aufschlüsselbar, ist den “Worten” nicht eindeutig ein Sprecher zugeordnet. Wenn man auch im Nachhinein den Sprecher als Gott identifizieren kann, ist keine interpretatorische Sicherheit gegeben. Gott und Mensch/lyrisches Ich werden so dicht aneinandergeführt, daß deutlich wird, daß zw i- schen dem lyrischen Ich und Gott ein enges, fast symbiotisches Verhältnis besteht. Dies wird bestärkt, in dem der Malermönch Gott selten in der dritten Person, sondern fast ausschließlich mit dem vertraulichen “Du” anredet. Erscheint Gott traditionskonform als übermächtig, stellt sich der Betende als nicht mehr beachtenswert da.14
Häufig verläßt Rilke jedoch dieses Schema. Er geht soweit, daß sich der Betende fragt (Gedicht Nr. 36):
“Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?
Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?)
Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?)
Bin dein Gewand und dein Gewerbe
Mit mir verlierst du deinen Sinn. ”
Gott und Mensch treten hier in eine Wechselbeziehung, in der der eine ohne den anderen nicht sein kann.
Im ersten Buch weist Rilke seinem Gott verschiedene Prädikationen und Metaphern zu. Der positiv belegte Gott ist dunkel und still.15 Das im Allgemeinen negativ konnotierte Wesen - Luzifer - verbindet Rilke mit Helligkeit und Lärm.16 In dieser Gegenüberstel- lung wird ein Stilmittel deutlich, das Rilke häufig verwendet. Er arbeitet mit den Erwar- tungen des Rezipienten, die er dann in das Gegenteil verkehrt. Mit Luzifer ist in der christlichen Tradition die Dunkelheit verbunden,17 mit Gott die Helligkeit.
Beachtet man, daß Rilke einen Künstler sprechen läßt, so drängt sich ein Zitat von No- valis auf:
“ Dichter und Priester waren im Anfang eins, und nur spä- tere Zeiten haben sie getrennt. Der echte Dichter ist aber immer Priester, sowie der echte Priester immer Dichter geblieben. Und sollte nicht die Zukunft den alten Zustand wieder herbeiführen?[...] ” . 18
Diese Maxime scheint Rilke mit seinem dichtenden Malermönch erfüllt zu haben. Je- doch ist sein Mönch nicht Priester einer universalen, sondern seiner individuellen Reli- gion.
Im ersten Teil seines Werkes entwirft Rilke einen Gott, der die grenzenlose Gegenwart verkörpert.19 Gleichzeitig stellt er diesen Gott als einen “reifenden” dar, der durch die Arbeit des Menschen an ihm vollendet werden soll. Durch diesen Griff schafft er ein großes Paradoxon, das nicht zu lösen ist, da die Arbeit des zeitlich determinierten Men- schen an einem zeitlosen Gott nicht fruchten kann. Wahrscheinlich findet, auch um die- sen Widerspruch zu lösen, eine Metamorphose Gottes im zweiten Buch statt.
Kapitel II.1.2.: Licht und Dunkelheit, Luzifer und Gott
Das Gottesbild des ersten Buches erklärt sich unter anderem aus der schon angespro- chenen Gegenüberstellung von Gott und Luzifer. Rilke verwendet Luzifer im ursprüng- lichen Sinne, als Fürst des Lichts (siehe Fußnote 17), spielt aber mit dem Rezipienten- bewußtsein von der Verbindung mit dem biblischen Satan. Zusätzlich ordnet Rilke ihm die Zeit zu.20
Wie in der christlichen Tradition, in der das Gegensatzpaar Gott / Satan näher durch die Adjektive gut / böse bestimmt wird, schafft Rilke auf dieser Basis eigene Prädikationen für Gott und Luzifer, die wiederum Gegensätze bilden. Diese Paare sind: Licht / Dunkel und Zeit / Gegenwart. Es fällt auf, daß eine moralische Wertung im Sinne von gut / böse nicht erwähnt ist und höchstens durch die traditionellen Assoziationen des Lesers evo- ziert wird.
In der jüdisch / christlichen Überlieferung erschuf Gott als erstes das Licht. Diesen Prozeß setzt Rilke im “Stundenbuch” in Verbindung mit der Zeit,21 wodurch eine Beziehung zu Luzifer entsteht. Gott selber ist aber nicht abhängig von der Zeit. Damit entzieht er sich dem Zugriff durch das menschliche Fassungsvermögen.
Luzifer ist im “Buch vom mönchischen Leben” Licht und wird im Licht sichtbar, das heißt, daß er auch erkennbar wird. Gott dagegen steht im Dunkel. Der Malermönch gelangt - genau wie Luzifer - höchstens an die äußersten Ränder Gottes, kann ihn aber nie sehen oder erreichen.22 Dadurch bleibt Gott unsagbar,23 Luzifer hingegen kann in klarer Form ausgedrückt werden, da er gesehen werden kann.24 Daher versucht der “helle Gott der Zeit”, um gottgleich zu werden, in die Dunkelheit zu fliehen.25
Im ersten Buch steht der unsagbare, nicht faßbare Gott, der erst aus dem engen Dialog mit dem lyrischen Ich eine Daseinsberechtigung erlangt, im Mittelpunkt. Ihm ist Luzifer als menschlich faßbare Figur gegenübergestellt. Im Gegensatz zu Gott ist dieser eigenständig und nicht von menschlichen Handlungen abhängig.
Kapitel II.2.: “Das Buch von der Pilgerschaft”
Auch wenn Rilke im zweiten Teil des “Stundenbuchs” mit den Worten: “ ich bete wie der, du Erlauchter ” 26 an den Ton und den Duktus des ersten Buches anschließt, hat sich seine Einstellung zu diesem, seinem Gott geändert. Er begründet das damit, daß er sich selbst fremd geworden ist.27 Obwohl er diese Phase in den weiteren Gedichten für überstanden erklärt, sind die weiteren Annäherungen an Gott immer durch die vorausgega n- genen Fremdheitserfahrungen des lyrischen Ichs zu sehen.
Im ersten Teil steht die Auseinandersetzung des lyrischen Ichs mit seinem Dialog- partner im Vordergrund. Nun wendet sich Rilke, weiterhin vor dem Prospekt der Gott- suche, einem ganz neuen Themenkomplex zu: dem der Radikalisierung des individue l- len Gottes, wodurch dieser nicht mehr das vertraute Gegenüber bleiben kann. Die “mo- nistische Naivität”28 weicht einer zunehmenden Distanz zu Gott, der nicht mehr die e- wige Gegenwart verkörpert.29
Rilke hat bemerkt, daß auch der Prozeß des “Sagens” der Zeit unterworfen ist und damit nicht dem göttlichen, sondern dem luziferischen Bereich zugehört. Daher wird aus der ewigen Gegenwart eine ferne Zukunft, die für den Menschen unerreichbar ist. So ent- steht eine Distanz zwischen Gott und Mensch, die sich im Werk Rilkes immer weiter verstärkt.30
Er grenzt in Gedicht Nr. 68 den ersten Teil vom zweiten dadurch ab, daß er letzteren mit Herbstmetaphorik einleitet und ihn gegenüber dem vergangenen Sommer absetzt, der das erste Buch charakterisiert.
Die beiden biblischen Topoi, die er häufig bedient, sind die Apokalypse,31 und das “Gleichnis vom verlorenen Sohn”.32 Aber auch hier, wie schon oben angesprochen, werden diese nur in Anspielungen übernommen, nicht in ihrem eigentlichen Gehalt. Das “Gleichnis vom verlorenen Sohn” bringt Rilke zu der blasphemisch anmutenden Frage, ob Gott Vater oder Sohn der Menschen sei.33
Durch die apokalyptischen Vorstellungen, die Rilke im zweiten Teil aufbaut, wird eine Furcht vor Gott deutlich, die das lyrische Ich zu einer Katharsis zwingt.34 Aber vor al- lem entwickelt sich eine Flucht vor Gott und sich selbst, eine Distanz, die nicht mehr überbrückbar ist. Auch wenn in Gedicht Nr. 70 wiederholt betont wird, daß sich nichts verändert hat: “Ich bin derselbe noch,[...] du bist immer noch die Welle,[...] Es ist nichts andres ” . Gerade dieser Versuch, verstärkt Nähe zu erzwingen, führt in die Dis- tanz und zu der großen Frage des zweiten Buches - nach der “Verwandtschaft” zu Gott. Der Themenkomplex zum verlorenen Sohn wird im Stundenbuch durch das Gedicht Nr. 70 eingeleitet: “ Ich liebe dich wie einen lieben Sohn,/ der mich verlassen hat als Kind ” 35 . Schon hier sind die Rollen vertauscht, aus “Gottvater” ist “Gottsohn” gewor- den. Anschließend stellt sich im zweiten Buch das lyrische Ich vornehmlich die Frage, warum Gott als Vater bezeichnet wird. Diese Bezeichnung gerät in Konflikt mit der in diesem Teil ausgearbeiteten Zukünftigkeit Gottes. Eine Vaterfigur kann nur Vergange- nes repräsentieren.36
Daher wird auch deutlich, warum das Prinzip des zeitlosen Gottes aus dem ersten Buch keine Gültigkeit mehr haben kann. Aus dem naiv angenommenen, existierenden ist ein “kommender” Gott geworden.
Der von Rilke entworfene Gott entspricht nicht dem von Rilke verwendeten Vaterbild: “ [...]solange der Vater lebt, sind wir eine Art Relief von ihm; sein Verlust macht uns [...] frei, ach freistehend auf allen Seiten”.37 Dadurch, daß in diesem Teil des “Stundenbuchs” ein “Gottsohn” entsteht, rückt der Mensch in die Vaterrolle, wodurch Gott zu einem Relief desselben wird.
Nach der Entwicklung dieser These geht Rilke noch einen Schritt weiter und stellt die Künstler auf eine Stufe mit Gott.38 Jedoch gelangt die Figur Gottes dadurch nicht wieder in erreichbare Nähe des lyrischen Ichs, sondern wird in mystischer Weise verklärt und in die Ferne gerückt.39
Durch die Pilgerschaft wird dem Mönch klar, daß Gott ein Hergereister ist, der nur Gast bleiben kann.40 Das wird im letzten Teil des zweiten Buches deutlich, in dem Gott erneut mit zahlreichen Metaphern41 umschrieben wird und das lyrische Ich sich Gedanken über Besitz und Individualität macht.42
Im zweiten Buch wendet sich Rilke vom “Gott des Jugendstils” ab, behält aber den lyr i- schen Umgang des Jugendstils bei (siehe dazu Kapitel III). Er hat sich Gott einverleibt und in einem weiteren Schritt den Künstler mit ihm gleichgestellt. So scheint eine Abwendung von Gott, die sich simultan zu einer Hinwendung zu dem alles überstrahlendem Bild eines Franz von Assisi vollzieht, im dritten Buch nur konsequent.
Kapitel II.3.: “Das Buch von der Armut und vom Tode”
Im letzten Teil wird die Loslösung von dem Gott der ersten beiden Büchern vollständig vollzogen. Das “Du”, welches in den beiden vorangegangenen Büchern die Anrede do- minierte, ist zu Beginn des dritten Buches der dritten Person gewichen. Umfangreiche Umschreibungen haben bis auf einige Ausnahmen43 der klaren Anrede “Herr” Platz gemacht. Die Auseinandersetzung mit dem Gottesprinzip hat ein Ende gefunden. Es wird nicht weiter versucht Gott zu beschreiben, sondern ihm wird über die Erfahrung des lyrischen Ichs berichtet. Aus den Dialogen der ersten beiden Büchern ist im dritten Teil ein Monolog geworden.
Die Tendenz des “Sohngottes” aus dem zweiten Buch wird verstärkt. Dazu kommt eine messianische Vision, die im Gegensatz zu dem christlichen Messias der Auferstehung ein “Tod-Gebärer” ist,44 den Rilke zusätzlich in Opposition zu der “Gottgebärerin” Ma- ria setzt. Dieses Motiv entwarf er schon in dem Gedicht “Das jüngste Gericht, aus den Papieren eines Mönchs”, das 1899 entstand. In diesem Epos bittet der Gottessohn sei- nen Vater, das fatale Mißverständnis des ewigen Lebens durch einen neuen Messias rückgängig zu machen.45
Im dritten Buch wird die Gottessuche durch eine Suche nach einem greifbaren, faßbaren Ideal ersetzt. Über die Gleichsetzung Gottes mit den Armen und die superlativische Beschreibung als den “tiefsten Mittellosen”46 gelangt er zu der Apotheose Franziskus von Assisi, der die Rolle eines sagbaren Gottes übernimmt.
Kapitel III: Lyrisches Stil-Verfahren
Kapitel III.1.: Anhand eines Gedichts aus dem ersten Buch
In diesem Kapitel möchte ich mich, ausgehend vom ersten Buch, mit den vielfältigen Gottesbildern und den verschiedenen Gottesprädikationen beschä ftigen und daran die lyrische Stil- Verfahren des Stundenbuchs zeigen.
Aus der darstellenden Kunst des Jugendstils hat Rilke verschiedene Motive und Effekte übernommen, die er in Sprache umzusetzen versucht. In seinen Werken, die um die Jahrhundertwende entstanden, finden sich bekannte Motive aus der bildenden Kunst dieser Zeit wieder: Parklandschaften, Seerosen, Schwäne und das idealisierte Mädche n- tum. Auch der virtuose Umgang mit der Linie als dekoratives Mittel stammen aus der bildenden Kunst. Dies sei an einem Beispiel deutlich gemacht:
“ Ich liebe dich, du sanftestes Gesetz,
an dem wir reiften, da wir mit ihm rangen;
du groß es Heimweh, das wir nicht bezwangen,
du Wald aus dem wir nie hinausgegangen,
du Lied, das wir mit jedem Schweigen sangen,
du dunkles Netz,
darin sich flüchtend die Gefühle fangen. ” 47
Der eigentliche Hauptsatz mit Subjekt, Objekt und Prädikat ist im ersten Vers vollstän- dig abgeschlossen. Die weiteren sechs Verse sind bloße Ergänzungen, die die Wichtig- keit der Aussage des Hauptsatzes übertönen. Dieser wird zu einem bloßen grammatika- lischen Moment. Durch die vielfältigen bildhaften Erklärungen in mehreren Nebensätzen soll eine besondere Stimmung, ein Gefühl, hervorgerufen werden. Sie sind ein starkes dekoratives Element in der “preziösen” Art des Jugendstils.
Zusätzlich erscheint das, in anderen Gedichten auch direkt angesprochene, Motiv der Welle in Reimschema und Versbau.48 Das Gedicht hat das Reimschema abbbbab. Nach der vollständigen Aussage des ersten Verses, beginnt Rilke durch immer gleiche Versanfänge und gleiches Reimwort eine rhythmische Steigerung, die er im sechsten Vers, der sich mit dem ersten reimt, zu dem Kamm der Welle und im letzten Vers sich überschlagend zu einem Ende führt.
Die Gott zugeordneten Metaphern enthalten häufig ungewohnte Superlative (“Du sanftestes Gesetz”).
Kapitel III.2.: Gottesprädikationen und -bilder in “Das Buch vom mönchischen Leben”
Verwendete Gottesmetaphern und -prädikationen im Verlauf des ersten Buches:49
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die in dieser Liste aufgeführten Bilder und Prädikationen veranschaulichen, daß Rilke aus zahlreichen Bereichen schöpft, um seinen Gott zu beschreiben und zu charakterisie- ren. Im vorherigen Kapitel wies ich auf die Stilmittel des Jugendstils hin, unter anderem auf die Verwendung von Bildern als Formelement. Dies kann eine Erklärung für die vielen unterschiedlichen Bereiche sein. Eine andere ist die schon in Kapitel I erläuterte “Unsagbarkeit” Gottes, die sich auch in den Prädikationen niederschlägt. So verdeut- licht Rilke auch auf der Sprachebene das “Kreisen um Gott”50, das schon auf der meta- sprachlichen Ebene erläutert wurde.
Ein weiterer Aspekt, der schon erläutert wurde, die symbiotische Austauschbarkeit der Dialogpartner der ersten beiden Bücher (Gott und Mensch), sei anhand der Baummeta- phorik auch auf der Sprachebene belegt. Den 16 Stellen, an denen Rilke im ersten Buch Gott als Baum, Wurzel oder Zweig bezeichnet, stehen fünf gegenüber, die dem lyr i- schen Ich gelten.51 In Gedicht Nr. 3 geht Rilke sogar so weit, daß beide Dialogpartner Teil ein und desselben Baumes sind,52 wobei Gott als ernährender Teil (Wurzel) des menschlichen Baumes dargestellt wird. Dadurch wird der symbiotische Charakter dieser Beziehung betont.
Fazit
Sowohl auf der Sprachebene als auch auf metasprachlichen Ebene erschafft sich Rilke seinen Gott aus der Kunst. Dadurch ist der Künstler symbiotisch mit seinem “Produkt” Gott verwachsen. Der Mönch des “Stundenbuches” bedarf keiner Religion außer seiner Kunst. Dadurch steht er in direkter Beziehung zum Anfangszitat: “ Die Religion ist die Kunst der Nichtschaffenden. Im Gebete werden sie produktiv...Der Nichtkünstler muß eine Religion - im tiefinneren Sinn - besitzen, und sei es auch nur eine, die auf gemein- samem und historischem Vereinbaren beruht. Atheist sein in seinem Sinne ist Barbar sein. ” Rilkes Gott bleibt für ihn unsagbar, im Laufe der Bücher immer radikaler nur erschaffbar in der Tat.
Die mannigfaltige, kühne Metaphorik und Sprache dient dazu, die für Rilke existentielle Frage nach dem Wesen Gottes zu verschleiern, respektive an den Leser weiterzugeben. Die Frage kann als Aufforderung verstanden werden, sich im Sinne des Künstlertums einen individuellen Gott oder eine eigene Religion zu erschaffen.
Eine emanzipatorische Entwicklung oder eine psychologische Interpretation, die “Das Stundenbuch” als Loslösung von der familiären Basis sieht,53 halte ich, auch wenn Rilke durch den Einfluß Lou Andreas-Salomés die Werke Freuds rezipiert hat,54 aufgrund der Aussage des Anfangszitats, in Zusammenhang mit dem herausgearbeiteten Prinzip - Kunst als Religion - für schwierig.
Literaturliste:
- verwendete Werke Rilkes:
- Rainer Maria Rilke: Tagebücher aus der Frühzeit, Sieber-Rilke, Ruth und Sieber, Carl (Hrsg.), Leipzig 1942.
- Rainer Maria Rilke Briefe 1914 - 1921, Sieber-Rilke, Ruth und Sieber, Carl (Hrsg.), Leipzig 1938.
- Rainer Maria Rilke: Das Stunden - Buch, Leipzig 1905.
- Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Leipzig 1910.
- Rainer Maria Rilke: Briefe an einen jungen Dichter, Leipzig 1929.
- Sekundärliteratur:
- Eckel, Winfried: Das Stunden-Buch, in: Ders., Wendung, zum Prozeß der poeti- schen Reflexion im Werk Rilkes, Würzburg 1994, S. 37 ff.
- Gerhadus, Dietfried, Das Stunden-Buch, in: Kindlers Literaturlexikon, Jens, Walter (Hrsg.), München 1974.
- Hermand, Jost: Jugendstil, ein Forschungsbericht 1918 - 1964, Stuttgart 1965.
- Holthusen, Hans Egon: Rainer Maria Rilke, mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Müller, Wolfgang und Naumann, Uwe (Hrsg.), Hamburg 1958.
- Imhof, Heinrich: Rilkes Gott, Rainer Maria Rilkes Gottesbild als Spiegelung des Unbewußten, in: Poesie und Wissenschaft, Band 22, Heidelberg 1983.
- Jost, Dominik: Literarischer Jugendstil, Stuttgart 1969.
- Leslie, Ian R.: Betrachtungen über Religion und Kunst in den Schriften von R.M. Rilke und D.H. Laurence, Berlin 1990.
- Mason, Eudo C.: Zur Entstehung und Deutung von Rilkes Stunden-Buch, in: Ders., Exzentrische Bahnen, Studien zum Dichterbewußtsein der Neuzeit, Göttingen 1963, S.181 - 204.
- Mendels, Judy und Spuler, Linus: Zur Herkunft der Symbole für Gott und Seele in Rilkes “Stundenbuch”, in: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres Gesellschaft, Band 4, Berlin 1963, S. 217 - 231.
- Novalis, (Friedrich Freiherr von Hardenberg) Schriften Band 2, Das philosophische Werk 1, Samuel, Richard (Hrsg.) Stuttgart 1960.
- Pagni, Andrea: Rilke um 1900, Ästhetik und Selbstverständnis im lyrischen Werk, in: Erlangener Beiträge zur Sprach- und Kunstwissenschaft, Rupprecht, Bernhard (Hrsg.), Band 7, Nürnberg 1984.
- Prill, Meinhard: Das Stunden-Buch, in: Kindlers Neues Literaturlexikon, Jens, Wal- ter (Hrsg.), München 1988.
- Stahl, August: Das Stunden-Buch, in: Rilke Kommentar zum lyrischen Werk, Mün- chen 1978, S. 148ff.
- Webb, Karl E.: Von Kunst zur Literatur. Rainer Maria Rilkes literarischer Jugend- stil, in: Rilke heute, Beziehungen und Wirkungen, Solbrig, Ingeborg H. und Storck, Joachim W. Frankfurt 1975, S. 37 - 48.
- Geschichte der deutschen Literatur, hrsg. von G. Fricke und M. Schreiber, Pader- born 1988.
- Der Kunst-Brockhaus, 2. Band L-Z, Wiesbaden 1983.
- Meyers großes Taschenwörterbuch, Band 12, S. 251, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 41992.
[...]
1 Rainer Maria Rilke: Toskanisches Tagebuch,. Quelle: Mason, E. C.: Zur Entstehung und Deutung von Rilkes Stunden - Buch, Göttingen 1963, S. 197.
2 Quelle: Gerhardus, Dietfried: Das Stunden-Buch, in: Kindlers Literaturlexikon, Jens, Walter (Hrsg.), München 1974.
3 Vergl. u.a.: Geschichte der deutschen Literatur, hrsg. von G. Fricke und M. Schreiber, Paderborn 1988.
4 Explizit erscheint die Herkunft des Mönches nie im Text. Jedoch läßt die Tätigkeit des Mönches - das Malen von Ikonen - darauf schließen, daß er aus einem christlich-orthodoxen Land stammt.
5 Dies wird in einem Tagebucheintrag vom 13.12.1900 deutlich: “...wenn jedem Tod (wie jedem Leben) eine bestimmte, begrenzte Frist zugemessen ist, so müssen mir die Tage wie die letzten dann gezählt und abgerechnet werden. Denn sie sind Tage unter der Erde, Tage in Feuchtigkeit und Fäulnis. Aber das ist so ein christlicher Gedanke: alles Unerträgliche in etwas Tröstliches umzustülpen [...], - und ich fühle, daß ich nicht ernsthaft daran glaube.” Aus:Rainer Maria Rilke, Tagebücher aus der Frühzeit, Leipzig 1942, S. 416.
6 Dieses wurde von Zeitgenossen wie Gottfried Benn oder Berthold Brecht stark kritisiert, da sie die soziale Problematik der Armut nicht gebührend berücksichtigt fanden.
7 “Stundenbuch [nach den Gebeten für die Tageszeiten] lat. Horarium Horam, frz. Livre d’heures. Gebetbücher für Laien, entstanden im 12. Jh. Besonders beliebt im 14. und 15. Jh. Es sind Gebetbücher, die trotz ihrer kleinen Formate besonders reich ausgestattet wurden. Sie enthielten u.a. ein Kalendarium der Heiligen, das mit Monatsbildern geschmückt sein konnte, Evangelientext und Darstellungen aus dem Leben Christi, Bußpsalmen, Totenvigilien. Höhepunkte bilden in der spätgotischen Buchmalerei die Stundenbücher des 15. Jh. im frankoflämischen Kunstkreis (Stundenbuch für den Herzog von Berry).” Aus: Der Kunst-Brockhaus, 2. Band L-Z, Wiesbaden 1983.
8 “Von allen meinen Büchern sind mir nur wenige unentbehrlich, und zwei sind sogar immer unter meinen Dingen, wo ich auch bin. Sie sind auch hier um mich: die Bibel und die Bücher des groß en dänischen Dichters Jens P. Jacobsen. ” . Aus: Rainer Maria Rilke: Briefe an einen jungen Dichter, Leipzig 1929, S. 15. Interessant ist dieses Zitat auch, da Jacobsen erklärter Atheist war.
9 Vergl.: Holthusen, Hans Egon : Rainer Maria Rilke; Hamburg 1958, S. 56.
10 Vergl.: Mason, Eudo C.: Exzentrische Bahnen, Göttingen 1963, S. 181.
11 Vergl. hierzu: Jost, Dominik: Literarischer Jugendstil, Stuttgart 1969. Hermand bezeichnet dieses in seiner Anthologie “Lyrik des Jugendstils” als “monistisches Verwobensein”.
12 Während der Entstehungszeit der später zum “Stundenbuch” zusammengefaßten Texte spricht Rilke nur von Gebeten siehe auch: Stahl, August: Rilke Kommentar zum lyrischen Werk, München 1978, S. 149.
13 Numerierung fortlaufend jeweils die großen Textanfänge.
14 Gedicht Nr. 27: “ Du bist so groß , daß ich schon nicht mehr bin ” .
15 Gedicht Nr. 3: “ [...] Mein Gott ist dunkel[...] ” . Gedicht Nr. 6: “ [...]so ists, weil ich dich selten atmen höre”.
16 Gedicht Nr. 50: “er ist der Fürst im Land des Lichts. ”; Nr. 61: “Es lärmt das Licht im Wipfel deines Baumes... ” .
17 “Luzifer [lat. Lichtbringer] in der röm. Mythologie der Morgenstern [...]. Da Jes. 14,12 einen in die Unterwelt gestürzten Engel erwähnt, der als “Sohn der Morgenröte” bezeichnet wird, und da Luk. 10,18 diesen Engelfall mit Satan verbindet, kam es zu der Identifizierung Luzifers mit Satan.” Aus: Meyers großes Taschenwörterbuch, Band 12, S. 251, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 41992.
18 Novalis: “Blütenstaub” in: Ders., Schriften Band 2, Das philosophische Werk 1, Samuel, Richard (Hrsg.), Stuttgart 1960, S. 444f.
19 Vergl.: Eckel, Winfried: Wendung, Würzburg 1994, S. 46
20 Gedicht Nr. 50 “ Er ist der helle Gott der Zeit ” .
21 Gedicht Nr. 44: “ Dein allererstes Wort war: Licht :/ da ward die Zeit[...] ”.
22 Gedicht Nr. 2: “ Ich kreise um Gott ” .
23 Hier knüpft Rilke an die jüdische Tradition an, die verbietet den Namen Gottes vollständig auszuspre- chen.
24 An dieser Stelle sei auf “Die Aufzeichnung des Malte Laurids Brigge” verwiesen. Das zentrale Thema des ersten Teils ist das neue Sehen lernen, Aufzeichnung Nr. 4 beginnt: “ Ich lerne sehen ” .
25 Gedicht Nr. 50: “ daß er, versengten Angesichts,/ nach Finsternissen fleht ” .
26 Gedicht Nr. 69.
27 Ebba.: “ Ich war mir fremd wie irgendwer ” .
28 Vergl.: Eckel, Winfried: “Das Stunden-Buch” in : Ders., Wendung, Würzburg 1984.
29 Ebda.: S. 49.
30 Vergl.: Eckel, Winfried: “Das Stunden-Buch” in : Ders., Wendung, Würzburg 1984, S. 51.
31 Offenbarung des Johannes.
32 Lukas 15,11ff. Dieses Gleichnis erscheint auch in “Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge”.
33 Diese Thematik taucht schon im “Florenzer Tagebuch” (1899) häufig auf.
34 Gedicht Nr. 69: “ Jetzt bin ich wieder aufgebaut/ aus allen Stücken meiner Schande,[...] ” .
35 Auch in diesem Gedicht ist der Bezug des Personalpronomens “mich” nicht eindeutig. (siehe Kapitel II.1.1.).
36 Gedicht Nr. 76: “ Du bist der Erbe./ Söhne sind die Erben,/ denn Väter sterben ” .
37 aus : R.M.R Briefe 1914 - 1921, Leipzig 1938, S. 394.
38 Gedicht Nr. 77: “ Die, welche bilden, sind wie du ” .
39 Diese These wird durch das fehlende vertrauliche “Du” und die Hinwendung zu Monolog gestützt.
40 Gedicht Nr. 100.
41 Gedicht Nr. 89.
42 Gedicht Nr. 96 und 100.
43 Gedicht Nr. 119.
44 Gedicht Nr. 111, vergl. Mason, Eudo C.: Exzentrische Bahnen, Göttingen 1963. S. 203.
45 Ebda.
46 Gedicht Nr. 119.
47 Gedicht Nr. 25.
48 Vergl.: Webb, Karl E.: Von Kunst und Literatur, in: Rilke heute, Band I, Stolbrig, I., Storck J. (Hrsg.), Frankfurt 1975, S. 47 ff.
49 Die Nennungen erfolgten chronologisch, nach Erscheinung im Text. Mehrfachnennungen markiert durch I. Von mir paraphrasierte Prädikationen kursiv. Hinweise auf schon verwendete Bilder in ( ). Zitate in [ ].
50 Gedicht Nr. 2.
51 Vergl.: Mendels, Judy und Spuler, Linus: Zur Herkunft der Symbole für Gott und Seele in Rilkes “Stundenbuch”, Berlin 1963, S. 266.
52 Gedicht Nr. 3: “Mein Gott ist dunkel und wie ein Gewebe/ von hundert Wurzeln, welche schweigsam trinken./ [...] mehr weiß ich nicht, weil alle meine Zweige/ tief unten ruhn[...] ” .
53 Vergl.: Imhof, Heinrich: Rilkes Gott, Heidelberg 1983.
Häufig gestellte Fragen zu Rilkes "Das Stunden-Buch"
Was ist "Das Stunden-Buch" von Rainer Maria Rilke?
"Das Stunden-Buch" ist eine dreiteilige Lyriksammlung von Rainer Maria Rilke, die zwischen 1899 und 1903 entstanden ist. Die Sammlung besteht aus "Das Buch vom mönchischen Leben", "Das Buch von der Pilgerschaft" und "Das Buch von der Armut und vom Tode".
Wann wurde "Das Stunden-Buch" veröffentlicht?
"Das Stunden-Buch" wurde erstmals 1905 veröffentlicht, zwei Jahre nach der Fertigstellung des letzten Teils.
Was sind die Hauptthemen von "Das Stunden-Buch"?
Die Hauptthemen sind die Suche nach Gott, die Beziehung zwischen Mensch und Gott, die Rolle des Künstlers, Armut, Tod und die Auseinandersetzung mit der christlichen Tradition.
Welchen biographischen Hintergrund hat "Das Stunden-Buch"?
Rilke begann "Das Stunden-Buch" nach seiner ersten Rußlandreise mit Lou Andreas-Salomé. Die einzelnen Teile entstanden unter dem Eindruck unterschiedlicher Lebensphasen und Erfahrungen, darunter die Zeit in Worpswede und sein erster Parisaufenthalt.
Wie ist Rilkes Gottesbild in "Das Stunden-Buch"?
Rilkes Gottesbild verändert sich im Laufe der drei Bücher. Im ersten Buch ist Gott dunkel, still und eng mit dem lyrischen Ich verbunden. Im zweiten Buch entfernt sich Gott und wird zukünftig. Im dritten Buch wird die Gottessuche durch die Suche nach einem greifbaren Ideal ersetzt, insbesondere durch die Figur des Franz von Assisi.
Welche Rolle spielt Luzifer in "Das Stunden-Buch"?
Rilke verwendet Luzifer im ursprünglichen Sinne als Fürst des Lichts, aber spielt auch mit der Verbindung zum biblischen Satan. Luzifer wird mit Helligkeit, Zeit und Erkennbarkeit assoziiert, während Gott im Dunkel steht und unsagbar ist.
Welche stilistischen Mittel verwendet Rilke in "Das Stunden-Buch"?
Rilke verwendet vielfältige Stilmittel, darunter Metaphern, Vergleiche, Paradoxe und Anspielungen auf die christliche Tradition. Er greift Motive des Jugendstils auf und verkehrt oft die Erwartungen des Rezipienten.
Welchen Einfluss hat die Kunst auf Rilkes Gottesbild?
Rilke erschafft seinen Gott aus der Kunst, wodurch der Künstler symbiotisch mit seinem "Produkt" Gott verwachsen ist. Der Mönch des "Stundenbuches" bedarf keiner Religion außer seiner Kunst.
Was sind die wichtigsten literarischen Einflüsse auf "Das Stunden-Buch"?
Rilke knüpft an die romantische "Kunstreligion" an und bezieht sich auf die mittelalterliche Tradition der "Livre d’heures". Er war stark von Lou Andreas-Salomé beeinflusst und kannte die Werke Freuds.
Wie ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch in "Das Stunden-Buch"?
Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist im ersten Buch eng und symbiotisch. Im Laufe der Sammlung entfernt sich Gott und wird unnahbarer. Im dritten Buch findet eine Ablösung von dem Gott der ersten beiden Bücher statt.
Welche Rolle spielt die Armut in "Das Stunden-Buch"?
Im dritten Buch wird die Armut zum Ideal erhoben. Rilke setzt Gott mit den Armen gleich und apotheosiert Franziskus von Assisi.
Welche Rolle spielt Franz von Assisi in "Das Stunden-Buch"?
Franz von Assisi nimmt die Rolle eines sagbaren Gottes ein und wird zu einem wichtigen Ideal im dritten Buch.
Wie verhält sich "Das Stunden-Buch" zur jüdisch-christlichen Tradition?
Rilke verwendet christliche Symbolik und Bilder, aber interpretiert sie auf eigene Weise und erschafft ein monistisches Weltbild.
Welche Bedeutung hat "Das Stunden-Buch" für Rilkes Gesamtwerk?
"Das Stunden-Buch" gilt als wichtiges Werk in Rilkes Frühwerk, das den Übergang von der reinen "Stimmungslyrik" zur "Dinggedicht" vorbereitet.
- Quote paper
- Alexander von Nell (Author), 2001, Rilkes Stundenbuch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104037