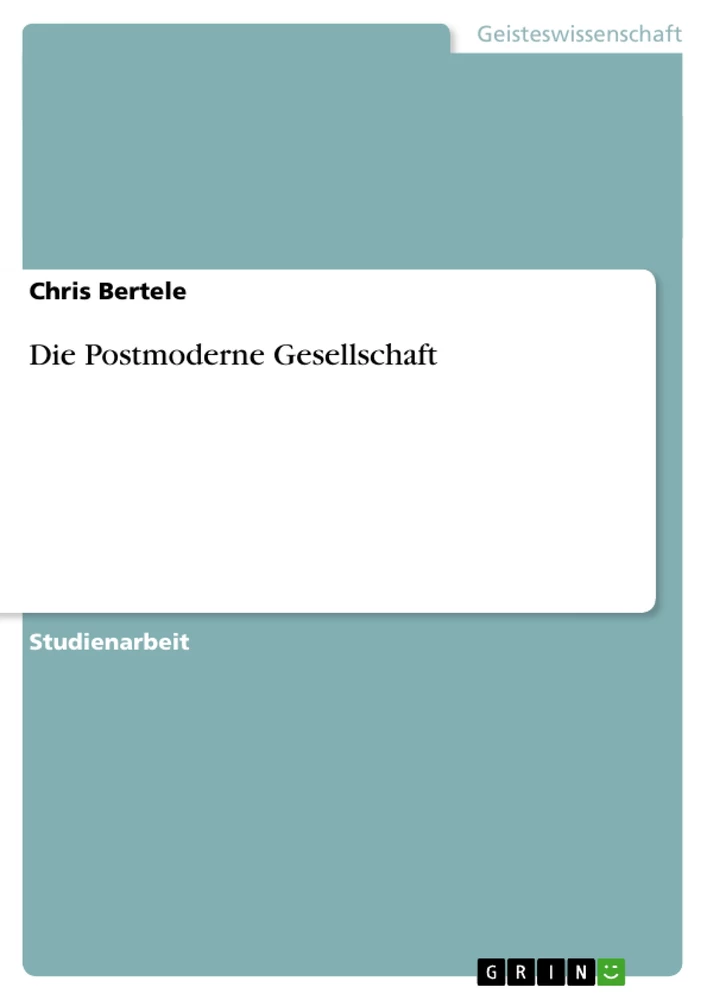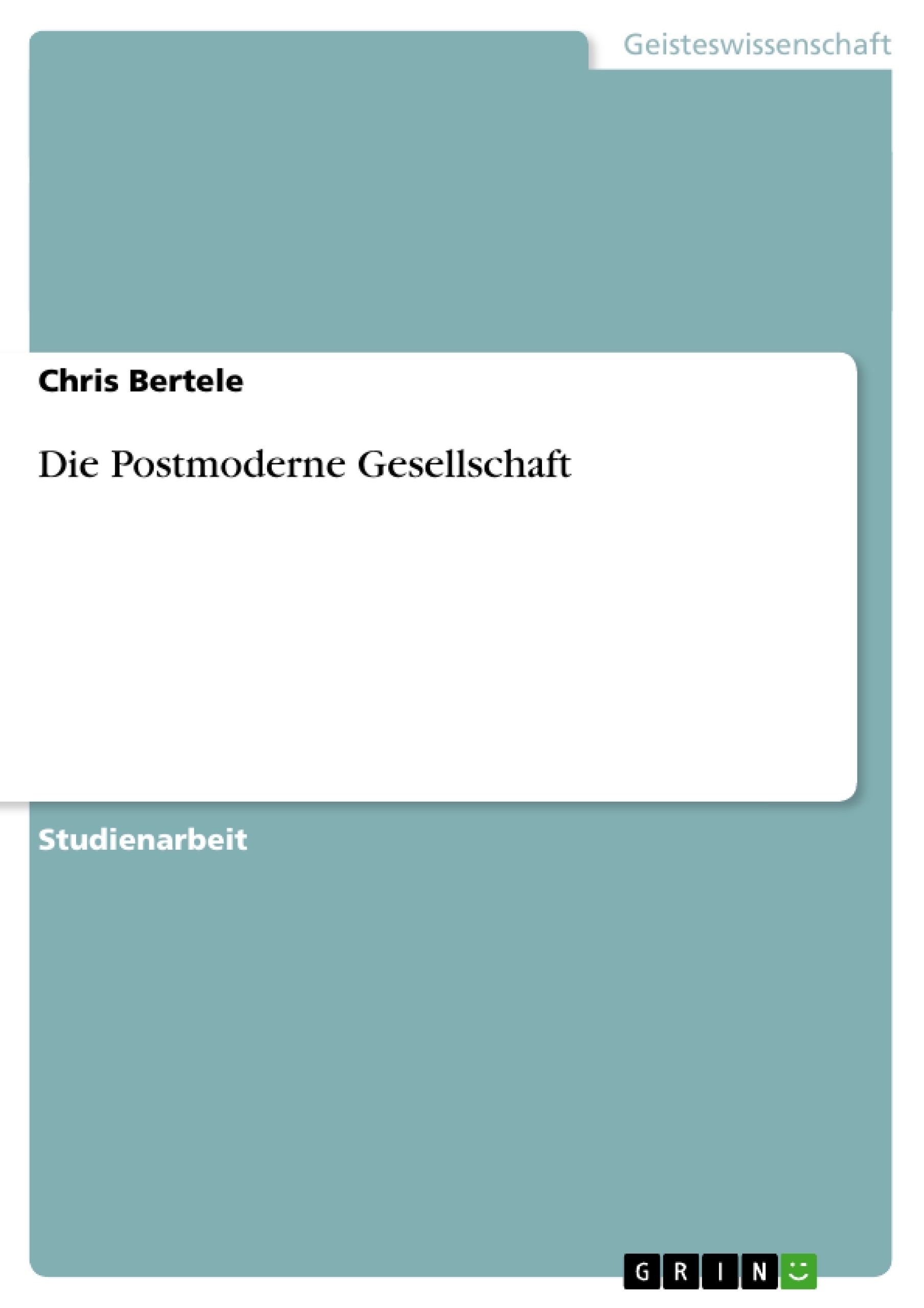In einer Welt, die von ständiger Veränderung und einem Überfluss an Wahlmöglichkeiten geprägt ist, stellt sich die Frage: Haben wir unser wahres Selbst verloren? Diese tiefgründige Analyse der postmodernen Gesellschaft untersucht die Auswirkungen des Pluralismus, der Medien und der gesellschaftlichen Institutionen auf unsere Identität. Entdecken Sie, wie die Dekonstruktion traditioneller Werte und die Omnipräsenz der Medienwirklichkeit unser Selbstbild beeinflussen und zu einem Gefühl der Entfremdung führen können. Anhand von Schlüsselkonzepten wie Individualisierung, Standardisierung und dem Verlust kultureller Bindungskräfte wird ein umfassendes Bild der Herausforderungen gezeichnet, denen sich der moderne Mensch bei der Suche nach seiner Identität stellen muss. Von Lyotards Kritik an der Vereinheitlichung bis zu Becks Modell der "neugearteten" Individualisierung werden verschiedene theoretische Ansätze beleuchtet, um die komplexen Zusammenhänge zwischen Individuum und Gesellschaft zu verstehen. Erfahren Sie, wie sich die Kindheit in der Postmoderne verändert hat und welche Auswirkungen die frühe Konfrontation mit Selbständigkeitsmustern auf die Entwicklung der Persönlichkeit hat. Ist der Verlust des Selbst ein unvermeidliches Schicksal oder birgt die postmoderne Gesellschaft auch Chancen zur Selbstverwirklichung? Dieses Buch bietet keine einfachen Antworten, sondern regt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und der Rolle der Gesellschaft an. Tauchen Sie ein in eine faszinierende Erkundung der Postmoderne, die Ihr Verständnis von Selbstfindung, Individualität und den Herausforderungen unserer Zeit nachhaltig prägen wird. Lassen Sie sich von den Analysen von Baudrillard, Mead und anderen Vordenkern inspirieren, um Ihren eigenen Weg in einer Welt zu finden, die ständig im Wandel ist. Ergründen Sie die tiefgreifenden Veränderungen in unserer Kultur und Gesellschaft, die unser Selbstverständnis prägen, und entdecken Sie neue Perspektiven für ein erfülltes Leben in der postmodernen Ära. Sind wir wirklich freier oder nur anders gefangen?
Die Postmoderne Gesellschaft
Einleitung
Beim Studium der Literatur der vergangenen 20 Jahre zum Thema „Das Selbst in der postmodernen Gesellschaft“ stösst man stets auf ähnliche Schlagworte. Da ist die Rede von der “Dekonstruktion aller Subjektvorstellungen“1 der „Entstrukturierung der Lebensführung“2, oder auch dem „Verlust des Selbst“3. Was unterscheidet nun die Selbstkonzeption oder - allgemein gesprochen - das Selbstempfinden der heutigen Zeit und der vergangenen Jahrzehnte von dem der Jahre zuvor? Und lässt sich hierbei überhaupt eine klare zeitliche Zäsur setzen? Ausgelöst wurde die von Beginn an äusserst kontroverse Diskussion um das Selbst in der Postmoderne von dem französischen Philosophen Jean Francois Lyotard im Jahr 1982.4 Mit regelrechten Parolen postuliert er den „Krieg dem Ganzen [und] der kommunikativen Vereinheitlichung!“5 Dies steht im völligen Gegensatz zu den Grundprinzipien der frühen 80er Jahre wie Universalität und Totalität.6 Lyotard stellt sich damit offen gegen die in seinen Augen überhand nehmende Entindividualisierung, unter anderem durch die Massenmedien.
Um die Fragestellung dieser Arbeit diskutieren zu können, bedarf es zunächst einer
Definition des Begriffes der Postmoderne
Terry Eagleton, Professor für Kritische Theorie in Oxford definierte die Postmoderne 1987 als einen „Prozess des Erwachens aus dem Alptraum der Moderne mit ihrer manipulativen Vernunft und ihrem Fetisch der Totalität; des Erwachsens [...] in den lässigen Pluralismus der Postmoderne, jenes heterogene Sortiment von Lebensstilen“.7 Markant hierbei ist die Erwähnung des Begriffes der Pluralität als Gegensatz zur Totalität.
Heiner Keupp spricht in diesem Zusammenhang von einer „Postmoderne [die] also der sich verbreitende Zweifel an den Segnungen der Moderne [ist].“8 Zehn Jahre nach Lyotard zeigt Zygmunt Bauman, dass die „Postmoderne [...] nicht notwendig das Ende, die Diskreditierung oder Verwerfung der Moderne [ist]. [...] Postmoderne ist die Moderne, die volljährig wird.“9
Zusammengefasst
lässt sich feststellen: Postmoderne ist keine neue zeitliche Epoche nach der Moderne, eher eine „Verwandlung unter anderen Vorzeichen“10. Es besteht ein fliessender Übergang. Übermächtige Einwirkungen durch die Gesellschaft (Medien, Politik, etc.) stehen einer Individualität im eigentlichen Sinne entgegen. Die Metaerzählung, allgemein gesagt die Tradition, wird durch die neuen Informations- und Kommunikationstechniken zerstört. Es kommt zu einem „Verlust der kulturellen Bindungskräfte“11, die es den Menschen ermöglichen, sich selbst über die eigene Tradition zu definieren. Als positives Beispiel wäre anzuführen, dass die berufliche Zukunft einer Person nicht mehr von vornherein durch die soziale Herkunft vorbestimmt ist. Vielfältige Bildungsmöglichkeiten ermöglichen viele „Bilder“ der Zukunft. Gerade der Aspekt der Pluralität - zentrales Element der Postmoderne - birgt in den Augen der Kritiker neben den Chancen zugleich viele Risiken: Das Individuum wird zum „bloßen Imitator medial vorgefertigter Existenz [...- und Lebens...] stile“.12
Baudrillard sieht das Subjekt der Medienwirklichkeit so sehr ausgesetzt, dass allmählich die Fähigkeit zur Unterscheidung von Wirklichkeit und Fiktion verloren geht.13 Eine zu extreme Darstellung der Situation? Bedenkt man die Tatsache, dass in einer Zeit der „ Big Brother“ Hysterie oder einer verlorenen Saalwette eines TV-Moderators niemand mit Sicherheit die „wirkliche“ Realität von der „erfundenen“ Realität zu unterscheiden vermag, so erscheint Beaudrillards These durchaus dem Stand der Dinge zu entsprechen.
Für eine Antwort auf die bereits angesprochene Frage - welche Auswirkungen die Postmoderne auf die Selbstfindung beziehungsweise die Identität des Menschen haben kann - folgt zunächst ein Rückblick auf verschiedene
Ansichten zum Selbst im letzten Jahrhundert
Richard Gerling, ein Bestsellerautor im Ratgeberbereich während der ersten Jahrzehnte des 20.Jahrhunderts verlangt die völlige „Einbindung des einzelnen in die höheren Aufgaben von Staat, Nation und Gemeinschaft“14. Dieses „Wollen des Gesollten“15 führe zur persönlichen Erfüllung.
George Herbert Mead differenziert zwischen dem „me“, der individuellen Spiegelung des gesellschaftlichen Gruppenverhaltens und dem „I“, der Reaktion des Subjekts auf gesellschaftliche Inhalte. Im Gegensatz zu Gerling sieht Mead das Selbst nicht mehr nur als Aktion innerhalb der festen Gesellschaftsordnung sondern vielmehr als Reaktion auf die und Interaktion in der Gesellschaft.16 Nach XXX Macpherson ist „das Individuum [...] nicht Teil einer größeren gesellschaftlichen Ganzheit, [...] sondern [...] Eigentümer seiner [...] eigenen Person oder seiner eigenen Fähigkeiten, für die es nichts der Gesellschaft schuldet. “17 Das Selbst eines Menschen ist demnach nicht von der Gesellschaft konstruiert, sondern vielmehr vom Individuum ohne Fremdeinwirkung autonom gestaltet.
Dem gegenüber steht die These von Ulrich Beck, wonach „der gesellschaftliche Freisetzungsprozess allenfalls potentiell einen Freiheits- oder Autonomiegewinn darstellt. Faktisch führt er häufig zu neuen Abhängigkeiten, zu einem Selbstzwang zur Standardisierung der eigenen Existenz.“18
Becks Modell einer „neugearteten“19 Individualisierung
1. Ebene: Das Subjekt erfährt die Herauslösung aus traditionell vorgegebenen Sozialformen und Sozialbindungen, wie beispielsweise der Familie (Elternschaft, Geschlechterrolle, Sexualität, etc.).20 Ehemals feste Strukturen haben im Zeitalter der Emanzipation so gut wie keinen Einfluss auf die Identitätsbildung mehr.
2. Ebene: Es kommt zu einem Verlust von traditionellen Sicherheiten beim Handeln.21 Diese Ebene bezieht sich auf die Pluralität der Lebensformen, die sich dem Individuum nun bieten. Autonomie beim Handeln und Wählen - angefangen mit der eingangs erwähnten Schulbildung über die Wahl des Berufes bis hin zur Möglichkeit, überhaupt nicht zu arbeiten, Stichwort „Soziales Netz“ - diese Freiheit macht die jeweilige Entscheidung nicht einfacher. Im Gegenteil: Es fehlen die traditionellen Vorgaben bzw. Vorlagen, die Rückhalt und Sicherheit bei Entschlüssen bieten könnten.
3. Ebene: Den verlorenen Rückhalt erhält der Mensch nach Beck durch eine neue Art der sozialen Einbindung durch Institutionen, die ihn gleichzeitig einer Aussensteuerung und Standardisierung aussetzt.22
Die Identität wird von den Institutionen vorgegeben. Als Beispiel hierfür kann das allgemeingültige Schönheitsideal angeführt werden, welches durch Werbung und die Medien im allgemeinen vermittelt wird. Nach postmoderner Theorie hat der Mensch zwar die Möglichkeit, sich diesem Ideal nicht zu unterwerfen, die Gesellschaft lässt ihn diese Entscheidung aber keinesfalls völlig frei treffen.
Als Folge der Standardisierung und Angleichung an eine gesellschaftliche Norm stünde die „Entindividualisierung des Subjekts“.23
Becks Modell dargestellt an der Kindesentwicklung24
Simone Jostock versucht in ihrem Buch „Kindheit in Moderne und Postmoderne“, die Beck´sche These auf die Entwicklung von sozialen Kontakten und Fähigkeiten von Kindern anzuwenden. Sie unterscheidet hier zwischen hochmodern / individualistischem und traditionellem Kinderleben. Man darf an diesem Punkt meines Erachtens durchaus den Vergleich zwischen einem in ländlicher Gegend aufwachsenden Kind und einem, das seine Kindheit in der Großstadt verbringt, ziehen.
Hochmodern:
Die beinahe vollständige Terminierung des Alltags setzt individuelles Planen & Nutzen der eigenen Zeit voraus. Das Kind muss sich - sofern es den eigenen Interessen nachgehen will - an den festen Terminen orientieren und eigenverantwortlich einen Zeitplan erstellen.
Ein relativ breites Aktivitätsspektrum (Æ acht verschiedene Aktivitäten pro Woche vorgeplant), beispielsweise in Sportvereinen, Musik- oder Sprachschulen ermöglicht ein eigenaktives, elternunabhängiges Auswählen der sozialen Beziehungen. Dieser Interpretationsansatz von Jostock ist aber zumindest anzuzweifeln, da die sozialen Kontaktmöglichkeiten durch die Entscheidung der Eltern, welchen Kurs das Kind besucht, bereits eingeschränkt sind.
Traditionell:
Weniger feste Termine und ein niedrigeres Aktivitätsspektrum (ein bis verschiedene zwei Aktivitäten) werden für ein traditionelles Kinderleben angenommen. Das Interessensspektrum ist nach Jostock allerdings etwa gleich hoch anzusiedeln wie bei einem in „hochmodernem“ Umfeld aufwachsenden Kind. Ein weiteres Kennzeichen sind die weniger eigenständig organisierten Beziehungen, die hauptsächlich der lokalen Kinderöffentlichkeit angehören. An die vorherige Kritik anknüpfend ließe sich feststellen, dass diese Kinder zwar weniger Möglichkeiten bei der Auswahl ihres Freundeskreises haben, diese Auswahl aber noch eher selbst treffen können.
Bei diesem Ansatz ist erkennbar, dass die Kinder mit altersbezogen immer früher beginnenden Selbständigkeitsmuster konfrontiert werden. „Gab es früher freie Wohnflächen, andere Kinder als Spielgefährten und ausreichend Spielmöglichkeiten, die spontan und zufällig in Anspruch genommen werden konnten, müssen Kinder in der individualisierten Gesellschaft entscheiden, auswählen, planen. [...] Das Handeln der Kinder [...][wandelt sich] in immer früherem Alter und stärker als in vergangenen Generationen zu rationalisiertem Handeln.“25.
Allgemeines Fazit
Verlust des Selbst in der postmodernen Gesellschaft?
In der verwendeten Literatur zum Thema wird die Selbstfindung stets als ein beinahe ebenso schwieriger Prozess wie die Erhaltung dieses Selbst dargestellt. Hauptargument der Autoren ist in vielen Fällen die Standardisierung des Alltags durch die Institutionen der postmodernen Gesellschaft. Eine Individualisierung ist für den postmodernen Menschen nur noch in sehr eingeschränktem Maße möglich. Man hat zwar ungleich mehr Wahlmöglichkeiten, als beispielsweise noch vor 30 Jahren, kann seine Entscheidungen aber nicht individuell treffen. Der gesellschaftliche Zwang zeichnet den Weg der Entscheidungsfindung meist vor. Theoretisch stünde es jeder Person also frei, sich so zu kleiden, wie es ihr gefällt. Die Gesellschaft jedoch gibt durch die Mode bestimmte Kriterien vor. Eine Abweichung von dieser Norm kann Nachteile mit sich bringen. Man denke - um bei diesem Beispiel zu bleiben - an die korrekte Erscheinungsweise bei einem Vorstellungsgespräch.
Die Postmoderne bringt mit den vielfältigen Wahlmöglichkeiten für den Einzelnen aber zugleich das Dilemma des Sich-Entscheiden-Müssens mit sich. Man kann hier von der sprichwörtlichen „Qual der Wahl“ sprechen.
Als Kritik an den verschiedenen Theorien lässt sich anmerken: Die Autoren gehen oftmals von einem gänzlich unkritischen Menschen aus, der eine sicherlich vorhandene Beeinflussung durch ve rschiedene gesellschaftliche Institutionen, wie Schule, Medien oder Politik, widerspruchslos über sich ergehen lässt. Alleine die allgemeine Diskussion um die Postmoderne und ihre Auswirkungen auf den Einzelnen zeigt jedoch mehr als deutlich, dass diese Beeinflussung nicht nur unbewusst geschieht. Sie wird durchaus als solche erkannt und thematisiert.
Einige Probleme, die in der Literatur für einen Verlust des Selbst in unserer postmodernen Gesellschaft angeführt werden, sind meines Erachtens nicht nur Probleme der heutigen Zeit. Bereits vor Jahrhunderten war es stets leichter in der jeweiligen Gesellschaft zurechtzukommen, wenn man sich „standesgemäß“ verhielt. Dass man dadurch natürlich auch ein Stück der eigenen Persönlichkeit aufgeben musste, war eine akzeptierte Tatsache, um die aber kein grosses Aufhebens gemacht wurde. Der Verlust des Selbst wird von beinahe allen Autoren als ein Phänomen der heutigen Zeit hingestellt, wobei die Tatsache beinahe völlig ausser Acht gelassen wird, dass auch eine weniger pluralistische Gesellschaft wie die zum Beispiel des 18. und 19. Jahrhunderts, solche Prozesse kannte. Das Streben nach Individualität als Flucht vor der gesellschaftlichen Vereinheitlichung zeigt sich bereits in Goethes Werk „Die Leiden des jungen Werther“ auf sehr eindrucksvolle Weise.
Der angesprochene Pluralismus und die vielfältigen Wahlmöglichkeiten der heutigen Gesellschaft begünstigen sicherlich einen Verlust der Persönlichkeit, dieses Phänomen ist aber nicht unbedingt eines der letzten zwanzig Jahre.
Literatur
Jostock, Simone: Kindheit in Moderne und Postmoderne. Wuppertal 1999.
Koslowski, Peter: Die postmoderne Kultur. München 1987.
Keupp, Heiner: Grundzüge einer reflexiven Sozialpsychologie. In: Keupp, Heiner (Hrsg.): Zugänge zum Subjekt. Frankfurt am Main, 1993.
Ferchhoff, Wilfried und Neubauer, Georg: Jugend und Postmoderne. Weinheim und München 1989.
Lyotard, Jean Francois: Das postmoderne Wissen. Ein Bericht. Graz, Wien 1986 (Neuausgabe).
Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main 1986.
Beck, Ulrich und Beck-Gernsheim, Elisabeth: Das ganz normale Chaos der Liebe. Frankfurt am Main 1990.
Willem van Reijen: Vierzig Jahre Flaschenpost. Dialektik der Aufklärung. Frankfurt 1987.
Zygmunt Baumann: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburg 1992.
Axel Honneth: Die zerrissene Welt des Sozialen. Sozialphilosophische Aufsätze. Frankfurt am Main 1990. Rolf Oerter und Leo Montada: Entwiclungspsychologie. Ein Lehrbuch. Weinheim 1998.
Macpherson: Die politische Theorie des Besitzindividualismus. Von Hobbes bis Locke. Frankfurt am Main 1967.
[...]
1 Heiner Keupp: Grundzüge einer reflexiven Sozialpsychologie, in: Ders. (Hrsg.): Zugänge zum Subjekt. Frankfurt am Main, 1993, S.267.
2 Wilfried Ferchhoff und Georg Neubauer: Jugend und Postmoderne. Weinheim und München 1989, S.9.
3 Willem van Reijen: Vierzig Jahre Flaschenpost. Dialektik der Aufklärung. Frankfurt 1987, S.541.
4 Vgl. Jean Francois Lyotard: Das Postmoderne Wissen. Ein Bericht. Graz, Wien 1986 (Neuausgabe), S. 13ff.
5 Ebenda, S.49.
6 Vgl. Keupp: S.235.
7 Terry Eagleton: 1987
8 Keupp, S.234.
9 Zygmunt Baumann: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburg 1992, S.333.
10 Simone Jostock: Kindheit in Moderne und Postmoderne. Wuppertal 1999, S.9.
11 Axel Honneth: Die zerrissene Welt des Sozialen. Sozialphilosophische Aufsätze. Frankfurt am Main 1990, S.669ff.
12 Ebenda, S.669ff.
13 Vgl. ebenda, S.669.
14 Keupp, S.260.
15 Richard Gerling: Der vollendete Mensch und das Ideal der Persönlichkeit. 1917, S. 36.
16 Vgl. zu Mead: Rolf Oerter und Leo Montada: Entwiclungspsychologie. Ein Lehrbuch. Weinheim 1998. S.347.
17 Macpherson: Die politische Theorie des Besitzindividualismus. Von Hobbes bis Locke. Frankfurt am Main 1967, S.15.
18 Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim: Das ganz normale Chaos der Liebe. Frankfurt am Main 1990, S.15.
19 Jostock, S.39.
20 Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main 1986, S.206.
21 Ebenda, S.206.
22 Ebenda, S.212.
23 Jostock, S.44.
24 Vgl. zum folgenden Kapitel: Jostock, S.66 - 68.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Postmoderne Gesellschaft"
Worum geht es in dem Text "Die Postmoderne Gesellschaft"?
Der Text "Die Postmoderne Gesellschaft" untersucht die Auswirkungen der Postmoderne auf das Selbstverständnis und die Identität des Einzelnen. Er beleuchtet die Diskussion um den "Verlust des Selbst" in einer von Medien, Politik und gesellschaftlichen Normen geprägten Welt.
Wie definiert der Text den Begriff "Postmoderne"?
Die Postmoderne wird nicht als eine neue Epoche nach der Moderne verstanden, sondern als eine "Verwandlung unter anderen Vorzeichen". Sie ist gekennzeichnet durch Pluralität, Individualisierung und den Verlust traditioneller Bindungskräfte.
Welche Rolle spielen die Medien in der postmodernen Gesellschaft laut dem Text?
Die Medien spielen eine zentrale Rolle, indem sie die Fähigkeit zur Unterscheidung von Wirklichkeit und Fiktion beeinflussen und zu einer Standardisierung von Lebensstilen führen können.
Welche unterschiedlichen Ansichten zum "Selbst" werden im Text vorgestellt?
Der Text stellt verschiedene Ansichten zum Selbst vor, von der völligen Einbindung in Staat und Nation (Gerling) über die Interaktion mit der Gesellschaft (Mead) bis hin zur autonomen Gestaltung des Selbst (Macpherson). Ulrich Beck warnt jedoch vor neuen Abhängigkeiten und einem Zwang zur Standardisierung.
Was ist Becks Modell einer "neugearteten" Individualisierung?
Becks Modell beschreibt drei Ebenen: die Herauslösung aus traditionellen Sozialformen, den Verlust traditioneller Sicherheiten beim Handeln und eine neue soziale Einbindung durch Institutionen, die zu Aussensteuerung und Standardisierung führen kann.
Wie wird Becks Modell auf die Kindesentwicklung angewendet?
Simone Jostock wendet Becks These auf die Entwicklung von sozialen Kontakten und Fähigkeiten von Kindern an und unterscheidet zwischen hochmodernen/individualistischen und traditionellen Kinderleben.
Welches Fazit zieht der Text bezüglich des "Verlusts des Selbst" in der postmodernen Gesellschaft?
Der Text argumentiert, dass die Standardisierung des Alltags durch gesellschaftliche Institutionen eine Individualisierung nur in eingeschränktem Maße ermöglicht und die vielfältigen Wahlmöglichkeiten zugleich das Dilemma des Sich-Entscheiden-Müssens mit sich bringen. Allerdings wird auch kritisiert, dass die Autoren oft von einem unkritischen Menschen ausgehen und dass der Wunsch nach Individualität kein rein postmodernes Phänomen ist.
Welche Autoren und Werke werden in der Literaturliste aufgeführt?
Die Literaturliste enthält Werke von Jostock, Koslowski, Keupp, Ferchhoff, Neubauer, Lyotard, Beck, Beck-Gernsheim, van Reijen, Baumann, Honneth, Oerter, Montada und Macpherson.
Was sind einige der Schlüsselbegriffe, die im Text verwendet werden?
Schlüsselbegriffe sind Dekonstruktion, Entstrukturierung, Verlust des Selbst, Postmoderne, Pluralität, Totalität, Metaerzählung, Individualisierung, Standardisierung, und Institutionen.
- Quote paper
- Chris Bertele (Author), 2000, Die Postmoderne Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104025