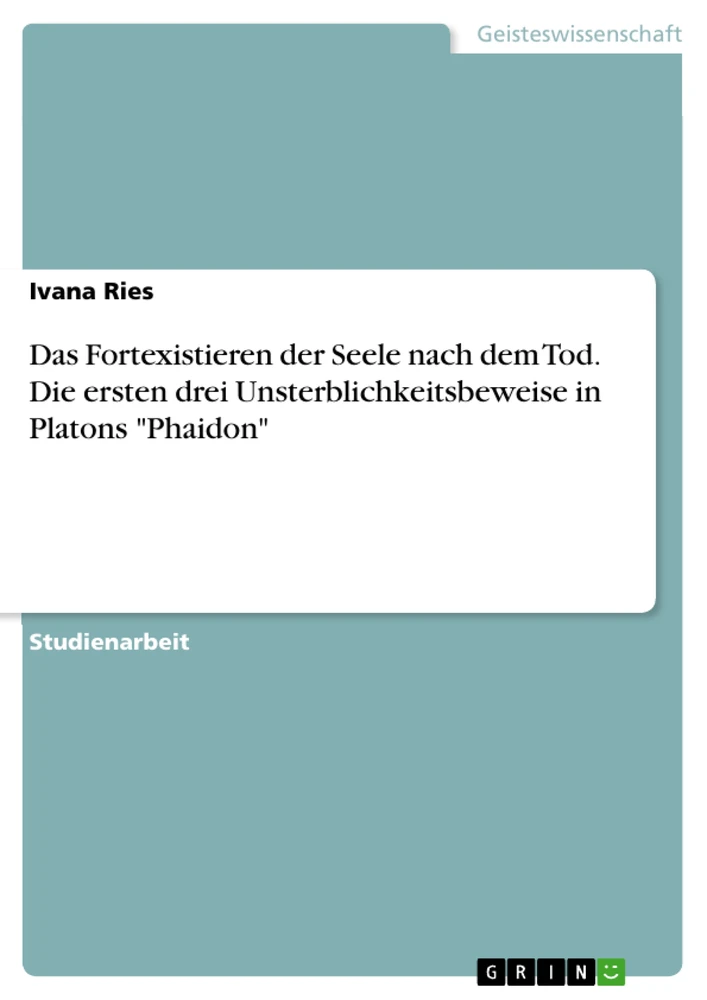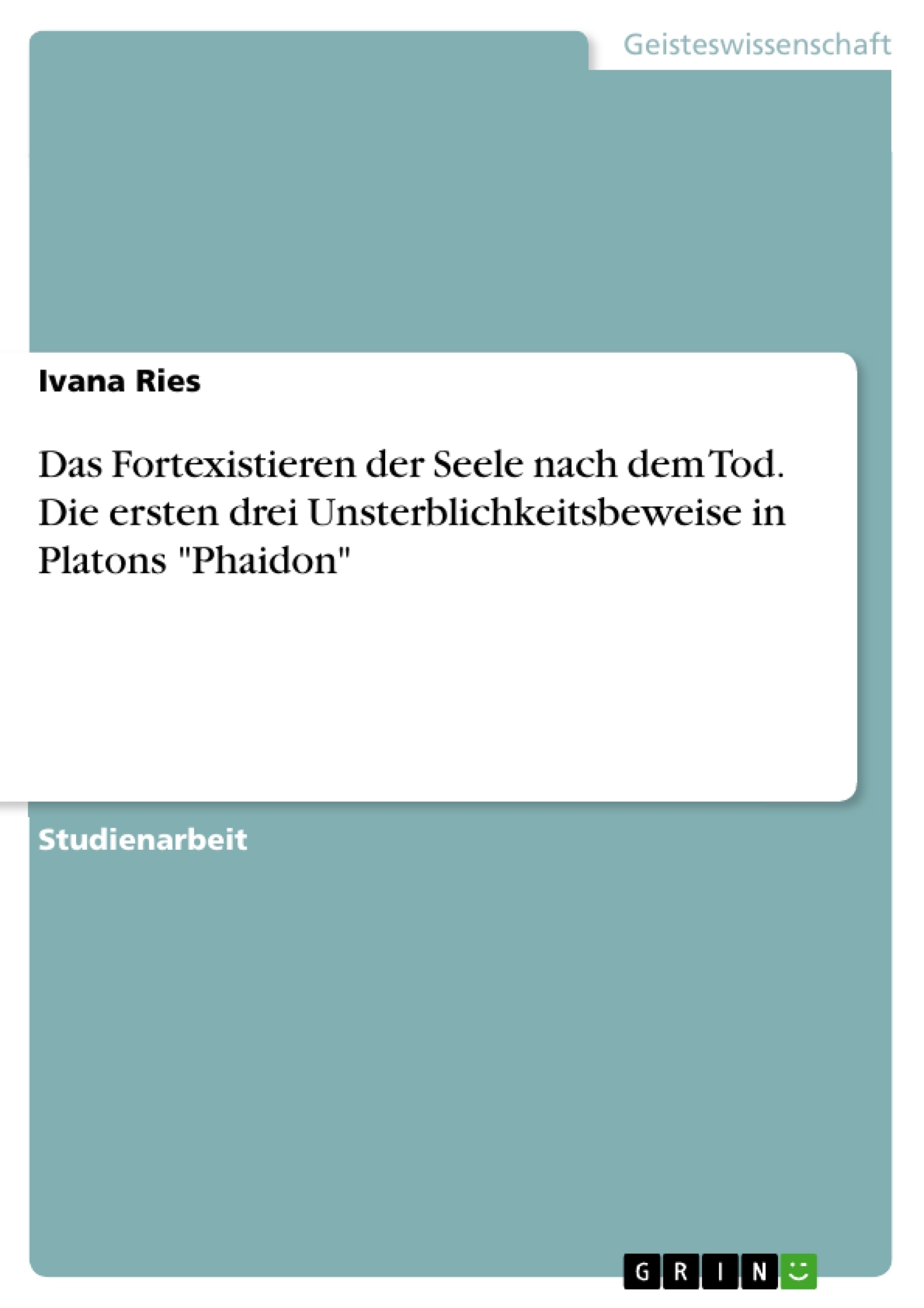In dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern die drei Unsterblichkeitsbeweise nach Platon auf ein Weiterleben der Seele nach dem Tod interpretiert werden können. Zuvörderst wird hierfür eine grundlegende Definition für die seelische Unsterblichkeit erläutert. Anschließend werden die ersten drei Unsterblichkeitsbeweise einzeln vorgestellt. In der Hauptdiskussion wird die Beweislage der Argumente geprüft und im Hinblick auf das Fortexistieren der Seele angewendet und interpretiert.
In seinem Werk "Phaidon" lässt Platon seinen damaligen Lehrer Sokrates als Protagonisten auftreten. Dieser befindet sich – nach der Anklage, er würde die ‚Jugend verderben‘ – im Gefängnis. Trotz seiner bevorstehenden Hinrichtung unter Zuhilfenahme von Gift begegnet er seinen Schülern mit einer durchweg stoischen, geradezu ‚eudämonistischen‘ Haltung. Platon selbst ist nicht anwesend. Dies lässt der Autor durch Phaidon – den Erzähler der Schrift – wie folgt durchblicken: „Platon aber, glaube ich, war krank.“ Diese Obskurität lässt einerseits darauf schließen, dass Platon diese Schrift so wahrhaftig und glaubhaft wie möglich inszenieren möchte, andererseits stellt man sich logischerweise die Frage, was wohl der wirkliche Grund für die Absenz Platons ist.
Zu diesem ominösen ‚Anlass‘ seines zweifellos baldigen Todes erklärt Sokrates seinen Schülern, dass die Angst vor dem Tod unbegründet ist, da mit diesem Zeitpunkt eine Trennung von Leib und Seele vollzogen wird, welche das ‚Geistige‘ auf eine metaphysische Art und Weise erlösen und zur Erfüllung führen kann. Dies betrifft jedoch – laut Platon – primär einen ‚auserwählten‘ Teil der Menschheit: „Also vor allem in diesen Dingen zeigt sich der Philosoph als einer, der die Seele so weit er kann von der Gemeinschaft mit dem Körper loslöst, anders als die anderen Menschen.“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wie lässt sich die Unsterblichkeit der Seele,omnibus' definieren?
- 3. Der erste Beweis: Zirkulation (70d-72e)
- 3.1 Hervorgehen aus dem Entgegengesetzten
- 3.2 Das Obligat der Auflebungen
- 4. Der zweite Beweis: Die Entsinnung (72e-77b)
- 5. Der dritte Beweis: Der Hang zur Göttlichkeit (77b-84b)
- 6. Analyse der Beweislage - angewendet auf das Weiterexistieren der Seele nach dem Tod
- 7. Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Platons Argumentation für die Unsterblichkeit der Seele im Phaidon. Die Zielsetzung ist, die drei Hauptbeweise Sokrates' zu analysieren und deren Tragfähigkeit im Hinblick auf das Fortbestehen der Seele nach dem Tod zu bewerten. Die Arbeit verzichtet auf eine abschließende Wertung der Beweise.
- Definition der seelischen Unsterblichkeit
- Analyse der drei Hauptbeweise Platons für die Unsterblichkeit der Seele
- Bewertung der Beweisführungen im Kontext des Weiterlebens der Seele nach dem Tod
- Die Rolle der pythagoreischen Philosophie in Platons Argumentation
- Der Gegensatz von Leib und Seele in Platons Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Platonschen Phaidon dar, indem sie den Rahmen der Handlung (Sokrates im Gefängnis vor seiner Hinrichtung) und die beteiligten Personen beschreibt. Sie hebt Sokrates' stoische Haltung und die Abwesenheit Platons hervor, wobei die Gründe für Letzteres nur angedeutet werden. Die Einleitung führt in die zentrale These ein: Sokrates argumentiert gegen die Angst vor dem Tod, da dieser lediglich eine Trennung von Leib und Seele bedeutet, welche die Seele erlösen kann. Der Fokus liegt auf der Ankündigung der drei Beweise für die Unsterblichkeit der Seele, welche im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden.
2. Wie lässt sich die Unsterblichkeit der Seele,omnibus' definieren?: Dieses Kapitel widmet sich einer grundlegenden Klärung des Begriffs der seelischen Unsterblichkeit. Es definiert die Unsterblichkeit der Seele als das Weiterleben des Geistigen nach dem Tod, der Trennung von Körper und Geist. Die genaue Form dieses Weiterlebens wird als Thema für die nachfolgenden Kapitel angekündigt, die die Beweise Platons genauer untersuchen werden. Die Definition legt den Fokus auf die essentielle Unterscheidung zwischen Körperlichem und Geistigem und den damit verbundenen Implikationen für das Konzept des Todes.
3. Der erste Beweis: Zirkulation (70d-72e): Dieser Abschnitt analysiert den ersten Beweis für die Unsterblichkeit der Seele, der sich auf die Zirkulation von Leben und Tod konzentriert. Sokrates argumentiert, dass alles aus seinem Gegenteil entsteht (z.B. Leben aus Tod), und stützt sich dabei auf die orphisch-pythagoreische Tradition. Der Beweis wird durch zwei Argumente gestützt: erstens, dass jedes Sein aus seinem Gegenteil hervorgeht, und zweitens, dass ein Kreislauf des Werdens und Vergehens existiert. Die Zusammenfassung dieser beiden Argumentationslinien unterstreicht die zyklische Natur der Existenz, die für Platons Beweis essentiell ist, und zeigt auf, wie die Seele in diesen Kreislauf eingebunden ist.
Schlüsselwörter
Platon, Phaidon, Unsterblichkeit der Seele, Sokrates, Leib-Seele-Problem, orphisch-pythagoreische Philosophie, Beweisführung, Metaphysik, Wiedererinnerung, Göttlichkeit.
Häufig gestellte Fragen zum Platons Phaidon: Analyse der Beweisführung zur Unsterblichkeit der Seele
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Platons Argumentation für die Unsterblichkeit der Seele im Phaidon. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der drei Hauptbeweise Sokrates' und deren Tragfähigkeit im Hinblick auf das Weiterleben der Seele nach dem Tod. Eine abschließende Wertung der Beweise wird vermieden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Definition der seelischen Unsterblichkeit, die Analyse der drei Hauptbeweise Platons, die Bewertung der Beweisführungen im Kontext des Weiterlebens der Seele nach dem Tod, die Rolle der pythagoreischen Philosophie in Platons Argumentation und den Gegensatz von Leib und Seele in Platons Philosophie.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Definition der Unsterblichkeit der Seele, Analyse des ersten Beweises (Zirkulation), Analyse des zweiten Beweises (Entsinnung), Analyse des dritten Beweises (Hang zur Göttlichkeit), Analyse der gesamten Beweislage und Schlussfolgerung (Conclusio). Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Wie definiert die Arbeit die Unsterblichkeit der Seele?
Die Unsterblichkeit der Seele wird als das Weiterleben des Geistigen nach dem Tod, also nach der Trennung von Körper und Geist, definiert. Die genaue Form dieses Weiterlebens wird in den folgenden Kapiteln, die sich mit den Beweisen Platons befassen, untersucht.
Was ist der erste Beweis Sokrates' für die Unsterblichkeit der Seele?
Der erste Beweis basiert auf der Zirkulation von Leben und Tod. Sokrates argumentiert, dass alles aus seinem Gegenteil entsteht (z.B. Leben aus Tod) und stützt sich dabei auf die orphisch-pythagoreische Tradition. Zwei Argumente werden verwendet: Alles entsteht aus seinem Gegenteil und ein Kreislauf des Werdens und Vergehens existiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Schlüsselbegriffe sind Platon, Phaidon, Unsterblichkeit der Seele, Sokrates, Leib-Seele-Problem, orphisch-pythagoreische Philosophie, Beweisführung, Metaphysik, Wiedererinnerung und Göttlichkeit.
Welche Rolle spielt die pythagoreische Philosophie?
Die orphisch-pythagoreische Philosophie spielt eine wichtige Rolle in Platons Argumentation, insbesondere im ersten Beweis, der sich auf die Zirkulation von Leben und Tod und die Entstehung des Seins aus seinem Gegenteil bezieht.
Welche Kapitelzusammenfassungen sind enthalten?
Der Text enthält Kapitelzusammenfassungen für die Einleitung, die Definition der Unsterblichkeit der Seele und den ersten Beweis (Zirkulation). Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt der jeweiligen Kapitel.
- Citation du texte
- Ivana Ries (Auteur), 2021, Das Fortexistieren der Seele nach dem Tod. Die ersten drei Unsterblichkeitsbeweise in Platons "Phaidon", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1039889