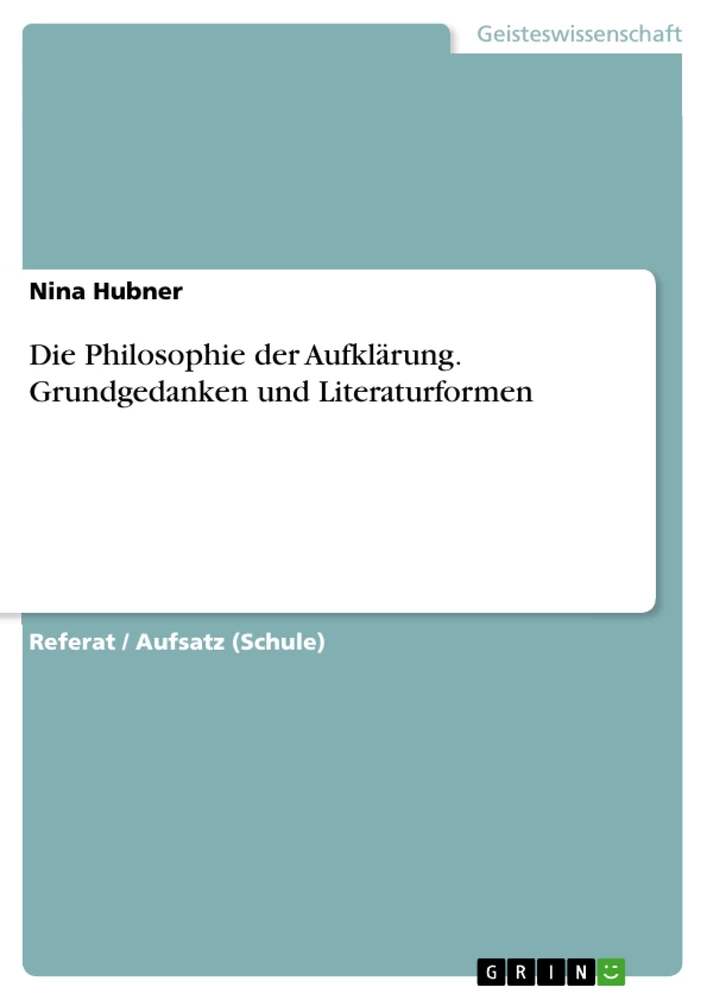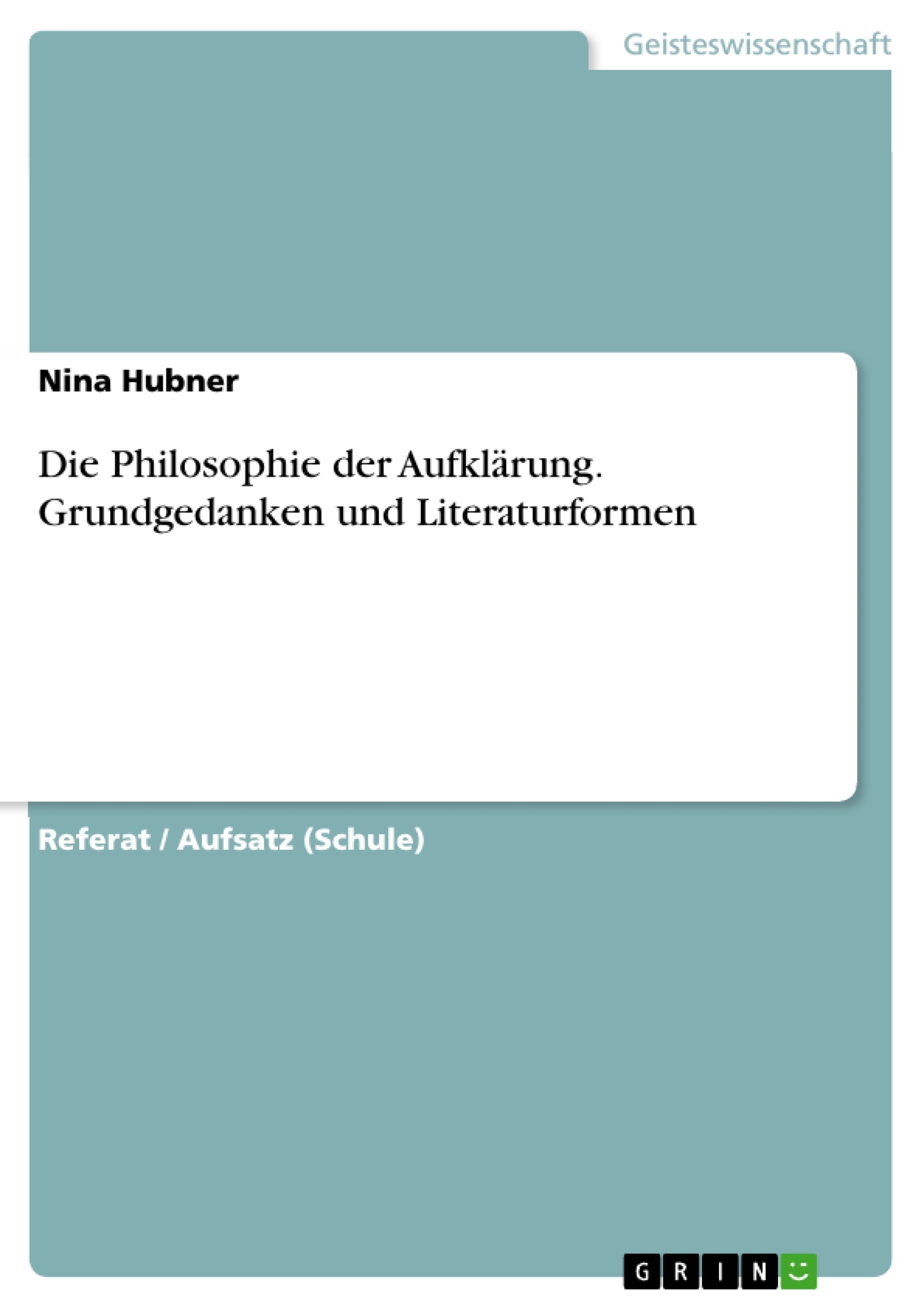Was, wenn die Fesseln des Denkens, die uns knebeln, selbstgeschaffen sind? Tauchen Sie ein in die Epoche der Aufklärung (1720-1785), eine Zeit des Umbruchs, in der der menschliche Geist nach Freiheit und Erkenntnis strebte. Diese tiefgreifende Analyse entfaltet die komplexen Strömungen dieser revolutionären Periode, von Kants berühmter Definition der Aufklärung als dem Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit bis hin zu den gesellschaftlichen und politischen Beben, die sie auslöste. Erforschen Sie die Wurzeln des Rationalismus mit Descartes' "Ich denke, also bin ich", entdecken Sie die empirischen Erkenntnisse Lockes und Humes, und erleben Sie die revolutionäre Kraft des Naturrechts, das die Fundamente der Französischen Revolution legte. Entdecken Sie, wie die Aufklärung Religion, Erziehung und Literatur veränderte, die starren Dogmen der Kirche in Frage stellte, eine allgemeine Schulpflicht forderte und die Literatur als Werkzeug zur Verbreitung aufklärerischen Gedankenguts nutzte. Begegnen Sie Schlüsselgestalten wie Gottsched und Lessing, die die literarische Landschaft ihrer Zeit prägten. Dieses Buch ist mehr als nur eine historische Abhandlung; es ist eine Einladung, die Prinzipien der Vernunft, Toleranz und Freiheit neu zu entdecken, Prinzipien, die bis heute unsere moderne Welt prägen und deren vollständige Verwirklichung noch immer ein Ziel ist. Wagen Sie es, Ihren eigenen Verstand zu nutzen – Sapere aude! Begeben Sie sich auf eine intellektuelle Reise, die Ihr Verständnis von Fortschritt, Gesellschaft und der menschlichen Natur selbst verändern wird. Lassen Sie sich von den Idealen der Aufklärung inspirieren und erkennen Sie, wie relevant sie auch heute noch sind, um die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern und eine gerechtere, aufgeklärtere Zukunft zu gestalten. Ergründen Sie die tiefe Bedeutung der Menschenrechte, die Notwendigkeit der Gewaltenteilung und die Bedeutung der Meinungsfreiheit in einer Welt, die oft von Konflikten und Ungerechtigkeiten geprägt ist. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für Philosophie, Geschichte und die fortwährende Suche nach Wahrheit und Erkenntnis interessieren.
Die Aufklärung (1720 - 1785)
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Vermögen, sich seines Verstandes ohne Leistung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache der selben nicht am Mangel des Verstandes sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. [...]
- Philosoph Imanuel Kant in wenigen Sätzen darstellte à ich verdeutlichen
- gesch. Hintergrund:
+ nach 30-jährigem Krieg scheinbar dauerhafte europ. Ordnung:
Absolutismus auf dem Kontinent, parlamentarische Monarchie in E + tiefes Friedensbedürfnis
+ Höfe der Landesfürsten Kulturzentren
+ Bildung einer neuen sozialen Schicht: Bürgertum: ~ dem Adel durch lit. Bildung überlegen
~ fordern Mitwirkung am Staat, bzw. unabhängige Justiz ~ fordern Schutz vor Willkür der Fürsten
- Basis: + Bewegung ging von E + F aus; erst mit Verzögerung nach D
+ Erfolge der Technik + Naturwissenschaft infolge von methodischem Denken und rationalen Methoden (Fallgesetzte v. Galileo Galilei; Newtons Mechanik)
+ Religionskriege des 16. + 17. Jh. führen zur geringeren Verbindlichkeit des Glaubens
+ Aufstieg des Bürgertums: Nichtadelige Untertanen können durch rationalen Lebensstil zu wirtschaftl. Erfolg kommen
- Kriege:
+ 1740 - 45 Schlesische Kriege + 1756 - 63 Siebenjähriger Krieg
+ 1775 - 83 nordam. Unabhängigkeitskrieg gegen England
- Zeitalter d. Aufkl. heute als Beginn d. mod. Zeit betrachtet
- Ziel: allseitig selbständige Entwicklung des Geistes
- gesamteurop. Bewegung(v.a. in F/E; D erst später): wesentliche Grundsätze gleich, aber
von einzelnen Vertretern versch. aufgefasst
- 4 Bereiche gliedern: Aufklärung in Philosophie, Religion, Erziehung, Literatur
1. Philosophie
- Ziel: Menschen den Weg aus seiner Unmündigkeit zu zeigen
- wichtige Begriffe: Rationalismus, Empirismus, Naturrecht
1.1 Rationalismus (ratio = Vernunft)
- Hauptvertreter: René Descartes, Voltaire
- entstanden in F; Begründer: Mathematiker + Philosoph René Descartes
- er ging davon aus, überliefertes Wissen nicht einfach hinzunehmen, sondern alles, was er
von anderen gelernt hatte, in Zweifel zu ziehen.
- fand heraus: am Anfang nur eine Erkenntnis nicht bestreitbar und daher wahr
- er definierte in satz: “Ich denke, also bin ich” (= also bin ich als denkendes Wesen
vorhanden)
- à Ratio (der menschliche Verstand) einzige Erkenntnisquelle; Maßstab für wahr/nicht
wahr, richtig/nicht richtig
- nur durch bloßes Denken kann der Mensch zur Wahrheit vordringen ohne Hilfe eines anderen
1.2 Empirismus (Empirie = Erfahrung)
- Hauptvertreter: John Locke, David Hume, Thomas Hobbes
- Geburtsstätte E, John Locke
- John Lo>- menschl. Erfahrung + nachprüfbares Wissen bildet sich alleine aus Wahrnehmung unserer Sinne, aus der Beobachtung
- Philosoph David Hume: nichts in unserem Verstand, das nicht schon vorher mit Sinnen wahrgenommen à Beobachtung: Methode der Erkenntnisgewinnung è Weg für moderne Wissenschaft frei
1.3 Naturrecht
- ansich alter Gedanke des Naturrechts wieder aufgenommen und neu durchdacht:
jedem Menschen kommen von Natur aus bestimmte Rechte zu: Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum
- alle Menschen sind gleich
- jeder frei geboren, deshalb soll er es auch bleiben
- Staat hat Aufgabe, dieses natürl. Recht des Einzelnen zu schützen
➔ damalige Zeit der Leibeigenschaft und fürstl. Absolutismus: Gedanke wirkt sehr Revolutionär
- Wurzeln der franz. Rev. (Begriffe: liberté, fraternité, égalité)
- Montesquieu: Forderung nach Gewaltentrennung
➔ - Gedankengut der Aufklärer auch Auswirkungen auf nachfolgende Epochen
- 18. Jh. Diskussionen der Philosophen gingen in Revolten und Kriege über: Volk forderte Recht an der Politik teilzunehmen, zu wählen, auf Meinungsfreiheit è Bürgerliche Revolution in England, Unabhängigkeitskampf der Vereinigten Staaten, franz. Revolution
heute: + Erklärung der Menschenrechte durch Vereinte Nationen (1948) + Einrichtung demokr. Staatswesen
1.4 Philosoph Immanuel Kant (1724 - 1804)
- bedeutenster Philosoph in D
- seine Philosophie wird nicht zur Aufklärung gerechnet sond. dt. Idealismus
- versuchte zu erklären, was Aufkl. ist (am Beginn vorgelesen)
- philosoph. Hauptwerk: „Kritik der reinen Vernunft“:
→ vom heil. Stuhl auf Liste d. verbotenen Bücher für Katholiken gesetzt
- Er sagte: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“
- daher forderte er: „Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen“
2. Religion in der Aufklärung
- große Veränderung in rel. Sicht
- durch 30-jähr. Krieg und Religionskriege des 16. + 17. Jh. Glaube geschwächt
- Kircheninterne Streitereien + luxuriöse Leben d. Geistlichen verunsichern zusätzlich
- prot. und kath. Kirche in Dogmen (Lehrsätze) d. 16. Jh. erstarrt
→ viele Gläubige: Pietismus: + Erneuerung d. frommen Lebens
+ Kirche reformieren
+ Mittelpunkt: Wiedergeburt
+ kirchl. Organisation soll ersetzt werden durch
Lebensgem. der ernsthaft gläubigen Christen
+ kennzeichnend für unsichtbare Kirche des P..: starkes Gefühlsleben/große Empfindsamkeit
- wichtige Bewegung: Deismus (John Locke, Voltaire):
+ Gott nimmt nach der Schöpfung keinen Einfluß mehr auf Welt + Gott spricht nicht die Offenbahrung zur Welt
- Aufklärer fordern Vernunft anstelle Offenbarungsreligion:
+ Glaubensinhalte mit log. Denken in Einklang bringen + wenden gegen Vormundschaft der Kirche
+ Beanspruchung der Möglichkeit freier, rel. Betätigung (da Zweifel an Christentum als einzig wahre Rel.)
→ Forderung nach Toleranz (John Locke): ~ öffentliche Duldung aller rel. Gemeinschaften und Religionen
+ Maßstab für Wert einer Religion in prakt. Wirkung: à jede Rel. Aufgabe: ~ Mensch zu bessern
~ zu sittlichem Wesen machen
3. Erziehung
- Aufklärer zutiefst überzeugt: Fortschritt der Menschheit beruht auf Bildung + Erziehung
jedes Einzelnen
➔ Einführung d. allgem. Schulpflicht
- Reformation d. bestehenden Schulwesens: Auswendiglernen von Lehrsätzen à ersetzt
durch verstehendes Lernen, lebenspraktische Ausrichtung des Unterrichts
- Forderung: Erkenntnis des Verstandes praktisch Anwenden à dadurch Leben vernünftig
gestalten!
4. Literatur
- Lit. bes. wichtig um Denkanstöße d. Aufkl. zu verbreiten, lehren
- Nützen durch Demonstration von Tatsachenkenntnissen (Aufsätze, Essays) + Vermittlung
von moralischen Lehren (Fabeln, Dramen)
- Erfreuen durch Witz und Scharfsinn (Reden, Dramen)
- Schriftsteller an Fürsten gebunden; lösen sich: freie Schriftsteller
- Probleme: + Großteil der Bev. nicht lesen konnte
+ kein festes Gehalt mehr
+ Zensur der Fürsten (selbstauferlegte Zensuren) à Forderung nach Pressefreiheit und Abschaffung der Zensur
+ geringe Auflagehöhen
- Vorteil: geistige Unabhängigkeit
- Dichter müssen sich an Regeln halten:
+ strenge Trennung der verschiedenen Gattungen: Epik, Lyrik, Dramatik + Mittelpunkt Mensch: entwickelt sich durch seinen Willen + Vernunft zu vollkommenem Wesen
- außerdem in D: Entwicklung der Nationalsprache (vorher: franz. und Latein, folgten
Literaturgesetzten in Paris verfasst)
4.1 lit. Buchmarkt entsteht
- moral. Wochenschriften große Rolle zur Verbreitung aufkl. Gedankenguts:
→ durch Vielfältigkeit breites Leserpublikum
- Lesezirkel: - Verbilligung der Lektüre
- wegen Mitgliedsbeiträge nur auf wohlhabende Bürger und Adelige
beschränkt
- Leihbibliotheken + kommerzielle Bibliotheken für Kleinbürger und Unterschicht
- Entstehen von Verlag und Sortiment: Bücher können auch unter dem Jahr, nicht nur auf
Messen gekauft werden; feste Preise
- aber: Schriftsteller Abhängig vom Verleger: Verleger Eigentumsrecht der Schriften
- keine Urheberrechte à Nachdrucke
- Zeitungs- und Zeitschriftenwesen entsteht (mußte abonniert werden, nicht täglich, oft nur wenige Nummern)
4.2 Literaturmethoden
- Literatur will Werte d. Aufkl. wie Vernunft, Nützlichkeit, Menschlichkeit auf alle Gattungen d. Literatur übertragen
- wichtige Deutsche Autoren: Johann Christoph Gottsched, Gotthold Ephraim Lessing
- Gottsched: + mechan. Ansicht vom Schaffungsprozeß d. Dichters (Satz, dem Handlung zu Grunde liegt)
+ mechan. Vorstellung wirklichkeitsgetreuer Nachahmung d. Natur
+ starres festhalten an 3 Einheiten im Drama: Ort, Zeit Handlung (nach arestotelischem Grundprinz.)
+ starres festhalten an Ständeklausel (Tragödie, Staatsroman,
Heldengedichte: Fürsten, Adelige; Komödien, Schäfergedichte, Romane: Bürger/Landleute)
- Gottsched Literaturkrieg gegen Lessing und Züricher Gelehrte Bodmer und Breitinger
5. Zusammenfassung
- Vernunft einzige, dass entscheidet über: + Methoden, Wahrheit und Irrtum jeder Erkenntnis + Normen des eth., pol, soz. Handelns
- Instrument: Kritik
- Forderung nach: + Freiheit der Meinungsäußerung
+ Toleranz gegenüber anderen Meinungen
- Glaube an die Vernunft verband sich Glaube an unbegrenzten Fortschritt
- gesellschaftsverändernede Absicht è starkes Interesse an Fragen der Erziehung
6. Schluss
- Aufklärung geistige Bewegung, die Grundsätze schuf, die selbst heute noch Bestand haben und teilweise noch immer auf ihre Verwirklichung warten
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufklärung (1720 - 1785)?
Die Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit bedeutet, sich seines Verstandes nicht ohne die Anleitung eines anderen bedienen zu können. Immanuel Kant definierte dies treffend.
Welche historischen Hintergründe prägten die Aufklärung?
Nach dem Dreißigjährigen Krieg entstand eine scheinbar dauerhafte europäische Ordnung mit Absolutismus auf dem Kontinent und parlamentarischer Monarchie in England. Die Höfe der Landesfürsten wurden zu Kulturzentren. Das Bürgertum, dem Adel durch literarische Bildung überlegen, forderte Mitwirkung am Staat, unabhängige Justiz und Schutz vor fürstlicher Willkür.
Wo liegen die Basen der Aufklärung?
Die Bewegung ging von England und Frankreich aus und erreichte Deutschland erst später. Erfolge in Technik und Naturwissenschaft durch methodisches Denken und rationale Methoden sowie die Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts trugen zur geringeren Verbindlichkeit des Glaubens bei. Der Aufstieg des Bürgertums ermöglichte nichtadeligen Untertanen wirtschaftlichen Erfolg durch rationalen Lebensstil.
Welche Kriege fielen in die Zeit der Aufklärung?
Die Schlesischen Kriege (1740-45), der Siebenjährige Krieg (1756-63) und der nordamerikanische Unabhängigkeitskrieg gegen England (1775-83).
Was ist das Ziel der Aufklärung?
Die allseitig selbständige Entwicklung des Geistes.
Wie gliedert sich die Aufklärung thematisch?
In Philosophie, Religion, Erziehung und Literatur.
Was sind die Kernbegriffe der Philosophie der Aufklärung?
Rationalismus, Empirismus und Naturrecht.
Was versteht man unter Rationalismus?
Der Rationalismus, begründet von René Descartes, besagt, dass die Ratio (der menschliche Verstand) die einzige Erkenntnisquelle und Maßstab für Wahrheit und Richtigkeit ist. Der Mensch kann durch bloßes Denken zur Wahrheit gelangen.
Was besagt der Empirismus?
Der Empirismus, vertreten durch John Locke, besagt, dass menschliche Erfahrung und nachprüfbares Wissen sich allein aus der Wahrnehmung unserer Sinne und der Beobachtung bilden. David Hume argumentierte, dass nichts im Verstand ist, was nicht vorher durch die Sinne wahrgenommen wurde.
Was beinhaltet das Naturrecht?
Das Naturrecht besagt, dass jedem Menschen von Natur aus bestimmte Rechte zustehen: Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum. Alle Menschen sind gleich und frei geboren. Der Staat hat die Aufgabe, diese natürlichen Rechte zu schützen. Montesquieu forderte die Gewaltentrennung.
Wer war Immanuel Kant?
Immanuel Kant (1724-1804) war ein bedeutender Philosoph, dessen Philosophie zum Deutschen Idealismus gezählt wird. Er definierte Aufklärung als den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und forderte: „Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen.“
Wie veränderte sich die Religion in der Aufklärung?
Der Glaube wurde durch den Dreißigjährigen Krieg und Religionskriege geschwächt. Kircheninterne Streitereien und das luxuriöse Leben der Geistlichen verunsicherten zusätzlich. Der Pietismus strebte nach einer Erneuerung des frommen Lebens und die Reformation der Kirche. Der Deismus (John Locke, Voltaire) ging davon aus, dass Gott nach der Schöpfung keinen Einfluss mehr auf die Welt nimmt. Aufklärer forderten Vernunft anstelle von Offenbarungsreligion und Toleranz gegenüber allen religiösen Gemeinschaften.
Welche Bedeutung hatte die Erziehung in der Aufklärung?
Aufklärer waren überzeugt, dass der Fortschritt der Menschheit auf Bildung und Erziehung jedes Einzelnen beruht. Dies führte zur Einführung der allgemeinen Schulpflicht und zur Reform des Schulwesens: Auswendiglernen wurde durch verstehendes Lernen und lebenspraktische Ausrichtung des Unterrichts ersetzt.
Welche Rolle spielte die Literatur in der Aufklärung?
Die Literatur diente zur Verbreitung der Denkanstöße der Aufklärung. Schriftsteller, die sich von der Bindung an Fürsten lösten, standen vor Problemen wie fehlendem Gehalt und Zensur. Es entstand ein literarischer Buchmarkt mit moralischen Wochenschriften, Lesezirkeln und Leihbibliotheken.
Was waren die Ziele der Literaturmethoden in der Aufklärung?
Die Literatur wollte Werte der Aufklärung wie Vernunft, Nützlichkeit und Menschlichkeit auf alle Gattungen übertragen. Wichtige Autoren waren Johann Christoph Gottsched und Gotthold Ephraim Lessing. Gottsched vertrat eine mechanische Ansicht vom Schaffungsprozess des Dichters und starres Festhalten an den drei Einheiten im Drama (Ort, Zeit, Handlung) sowie der Ständeklausel.
Was waren die wichtigsten Forderungen der Aufklärung?
Freiheit der Meinungsäußerung und Toleranz gegenüber anderen Meinungen. Der Glaube an die Vernunft verband sich mit dem Glauben an unbegrenzten Fortschritt.
- Quote paper
- Nina Hubner (Author), 2000, Die Philosophie der Aufklärung. Grundgedanken und Literaturformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103981