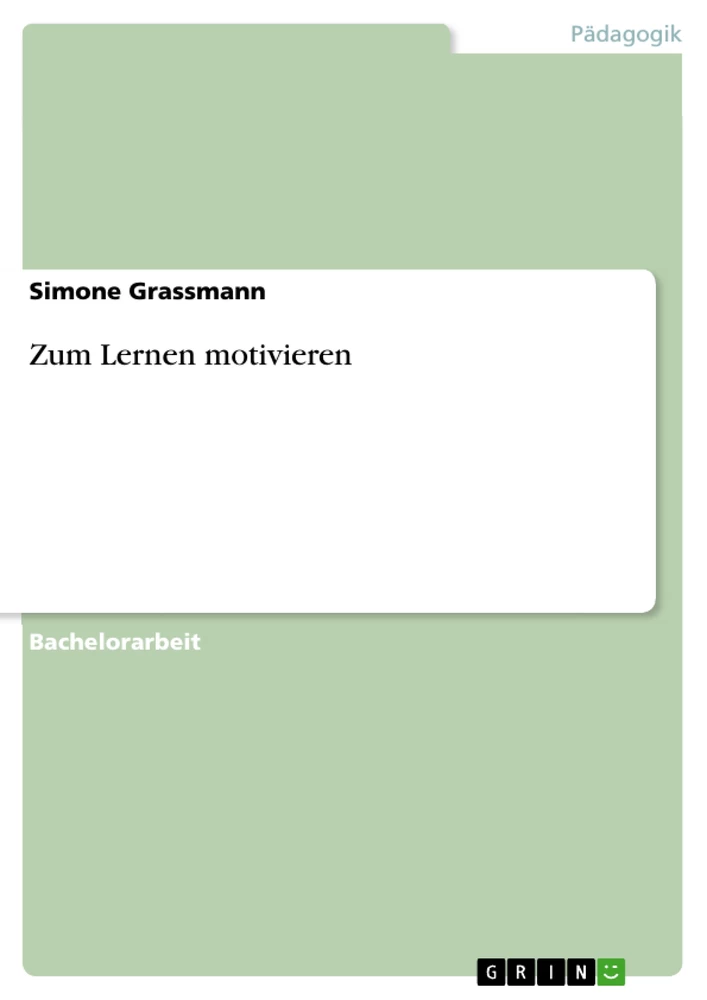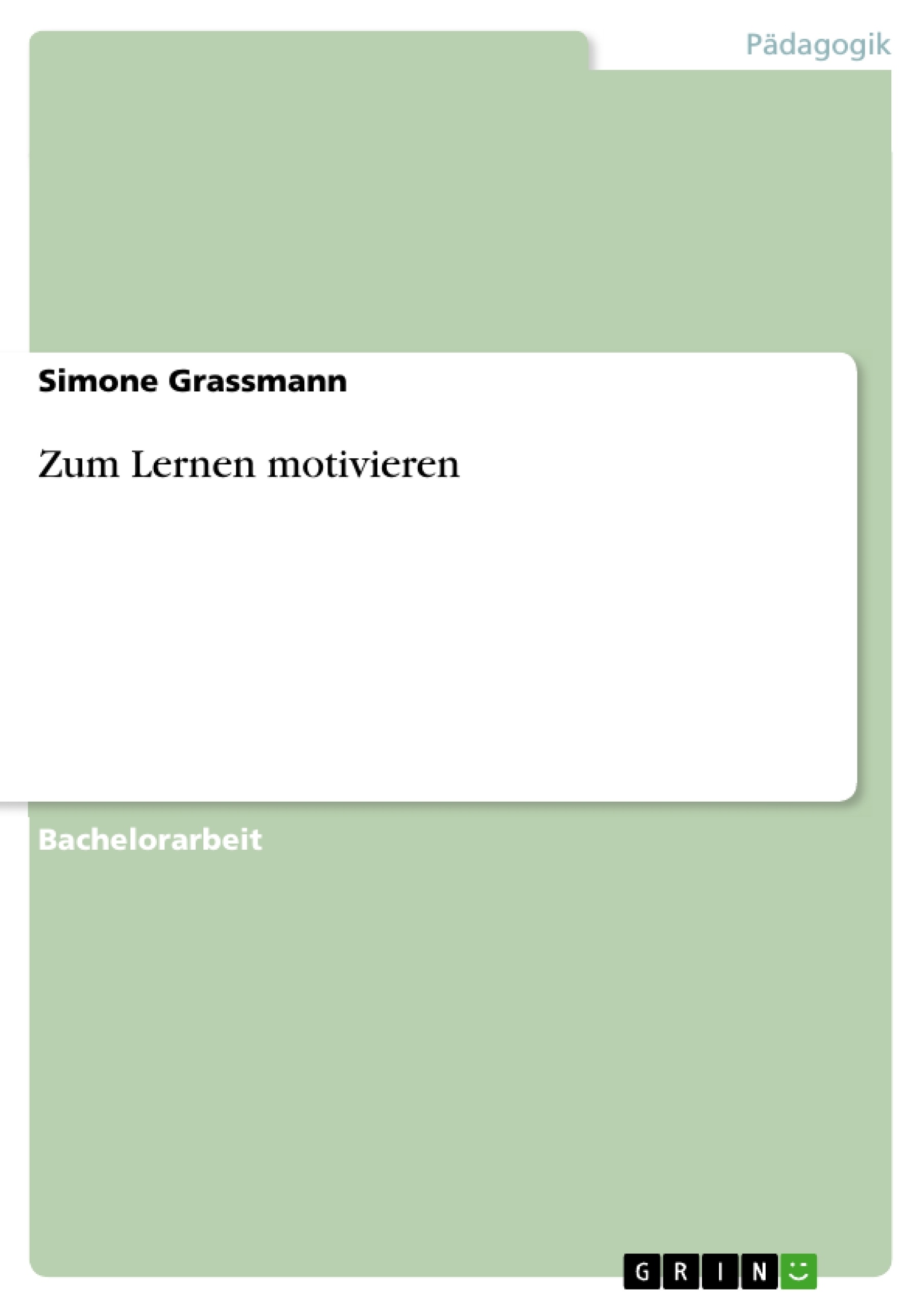Bearbeitung eines frei waehlbaren Themenschwerpunktes
Zum Lernen motivieren
Ich habe dieses Thema gewaehlt, weil mir bereits waehrend des Semesters im Seminar zum Orientierungspraktikum und dem damit verbundenen Literaturstudium aufgefallen ist, dass es sich hierbei um ein vielfach diskutiertes, oftmals auch kontrovers diskutiertes Thema handelt. Da ich diese Thematik enorm wichtig finde, habe ich es mir dann im Praktikum zur Aufgabe gemacht, einmal verstaerkt darauf zu achten, wie in der Schulalltag damit umgegeangen wird, wie die Lehrer sich der Aufgabe des Motivierens annehmen und wie die Schueler darauf reagieren. Denn aus meiner eigenen Schuelererfahrung hatte ich den Eindruck gewonnen, dass die Lehrer entweder immer hinten herum, versteckt motivieren muessten, oder aber dass man als Schueler generell motiviert sein muss, um den Schulalltag ueberstehen zu koennen. Vor allem dann in der Kurstufe war die einzige Motivation oftmals der eigene Drang, das Abitur und die diesem vorausgehenden Klausuren und die damit verbundenen Abschlusspruefungen, moeglichst gut zu bestehen. Motivation zum Lernen von den Lehrern ausgehend, habe ich damals, zumindest in den Leistungskursen, nicht verspuert. Da bestand unser Hauptproblem darin, bis zu den Pruefungen all den Stoff abgearbeitet zu haben, der pruefungsrelevant sein koennte. Mit diesen Erfahrungen, und den Erkenntnissen aus dem Literaturstudium, stand fuer mich nun meine (Beobachtungs)Aufgabe fuer das Orientierungspraktikum fest.
Zunaechst moechte ich nun erst einmal die Ergebnisse meines Literaturstudiums zu meinem gewaehlten Thema: “Zum Lernen motivieren“, vorstellen und dann diese mit meiner prakischen Erfahrung in einen Zusammenhang bringen und auswerten.
Einleiten moechte ich diesen Teil meiner Arbeit mit einer moeglichen Definition des Begriffs Motivation: „Grundlage aller menschlichen Handlung ist die Motivation, und das gilt ganz besonders fuer Lernprozesse. Die Motivaton haengt jeweils von individuellen Voraussetzungen und von Umweltgegebenheiten ab.“1 Zu den individuellen Voraussetzungen zaehlen Veranlagung, persoenliche Motive, das Selbstwertgefuehl. Auch kann man davon ausgehen, dass eine gewisse Erfolgserwartung die Voraussetzung fuer Motivation, fuer das Bemuehen eines Individuums, eine bestimmte Handlung durchzufuehren, ist. Um aber bestimmte Handlungen durchfuehren zu koennen, ist ein bestimmtes Koennen und sind bestimmte Faehigkeiten, die Voraussetzung.
„Ausgeloest werden Handlungen durch Aufforderungsgehalte, die allerdings nur dann zur Wirkung kommen, wenn sie auf Motive treffen.“2
In der Literatur wird Motivation ganz grundsaetzlich in extrinsisch und intrinsisch unterschieden. Bei der extrinsischen Motivation liegt der Aufforderungsgehalt und die Motive ausserhalb der Sache selbst. So kann man dazu zum Beispiel Ehrgeiz oder auch die Angst vor Bestrafung oder das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg als Belohnung zaehlen. Sie sind haeufig Ursachen, die das Lernen ausloesen koennen. Eine Form der extrinsischen Motivation kann auch ein sympathischer Lehrer sein, dem sich der oder die Schueler nur von ihrer besten Seite praesentieren moechten. In meinem Praktikum sind mir mehrere Faelle dieser Art der Motivierung augefallen. Zum Teil ging diese von Lehrern aus, die ich vor meinem Praktikum noch nicht kannte, weil sie neu an der Schule waren, aber zum Teil bin ich auch in Stunden von Lehren gegangen, von denen mir schon vorher bewusst war, dass sie diese Art der Motivation (Zum Teil allerdings nur, oder vor allem bei den Maedchen) geradezu provozieren. Es sind dies auch immer die Lehrer gewesen die als erste gefragt wurden, ob sie nicht die bevorstehende Klassenfahrt begleiten koennten. Diese LehrerInnen waren an sich, allein mit ihrer Person schon genug, um die Schueler in den Unterrichtsstunden in eine dem Lernen und der Mitarbeit foerderliche Grundstimmung und Grundsituation zu bringen. Es bedurfte in diesen Stunden keiner weiteren (groesseren) Anstrengungen seitens der Lehrer, die Schueler zum Lernen zu bewegen. Ganz andere Erfahrungen hingegen habe ich in einigen Franzoesischstunden gemacht, die eine Lehrerin gehalten hat, die frueher meine Klassenlehrerin war. Ich bildete mir also ein, diese Frau recht gut gekannt zu haben, aber offenichtlich war das nicht wirklich der Fall. Ich hatte sie damals immer so erlebt, dass sie staendig um Anerkennung, Disziplin und vor allem um Mitarbeit kaempfte, und, da sie die in den meisten Faellen von unserer Klasse nicht erhielt, zu zum Teil seltsamen und wenig effektiven Methoden griff, um unsere Mitarbeit zu verbessern. In den besagten Franzoesichstunden in meinem Praktikum erlebte ich diese Lehrerin in einem voellig neuen Bild. Diese Klassen arbeiteten freiwillig mit und meldeten sich zum Teil sogar freiwillig zu verschiedenen Leistungskontrollen, was in meiner Klasse niemals vorgekommen waere. Dieses Beispiel fuehrte mir eindrucksvoll vor Augen wie wichtig das persoenliche Verhaeltnis zwischen Lehrern und Schuelern wirklich ist. Hat man als Lehrer ersteinmal die Sympathien der Schueler auf seiner Seite, wird es einem auch nicht mehr so schwer fallen, sie im Unterricht und auch darueber hinausgehend, zum Lernen zu motivieren.
Als intrinsische Motivation wird diejenige verstanden, die aus dem Aufforderungsgehalt der Sache selbst, also dem Lerngegenstand, kommt. Dies ist immer dann der Fall, wenn Neugierde im Spiel ist, Neugierde die der Sache selbst entspringt. Die Handlung, die aus dieser Motivation heraus erfolgt, befriedigt folglich diese Neugierde und damit ist dann die Ausgangsfrage beantwortet.
Zur Wertung dieser beiden Formen der Motivation, moechte ich ein Zitat anbringen:
„Dennoch erweist sich ... die itrinsische Motivation als die tragfaehigere, denn die Effizienz eine intrinsisch motivierten Lernprozesses ist deutlich groesser. Fuer den Lernprozess gilt es also, die Motivation der Lernenden herzustellen, wenn sie nicht, wie in der Mehrzahl der Faelle, vorausgesetzt werden kann.“3
Aber kann man denn wirklich in der Mehrzahl der Faelle Motivation voraussetzen? Im Folgende moechte ich einige Moeglichkeiten, die bereits vorhandene Motivation zum Lernen zu unterstuetzen oder aber noch nicht vorhandene Motivation zu initiieren.
Eine Moeglichkeit die Schueler im Unterrichtsgeschehen zu motivieren ist, einen informierenden Unterrichtseinstieg zu bieten. Dazu ist es notwendig den Schuelern mitzuteilen, was sie in der kommenden Stunde lernen sollen, und vor allem, warum sie das lernen sollen. Aus eigener Erfahrung kann ich bestaetigen, dass es wesentlich einfacher ist, den Fakt lernen zu muessen, zu ertragen, wenn man genau weiss, oder zumindest eine Idee davon hat, weshalb das denn eigentlich wichtig ist. Und das hoffentlich nicht nur fuer den Lehrer!
Um einen solchen Unterrichtseinstieg zu geben, kann man zum Beispiel den Schuelern zu Beginn der Stunde die Ziele dieser, muendlich oder auch schriftlich, beispielsweise an der Tafel, bekannt geben. Des Weiteren kann man den geplanten Stundenverlauf als eine Uebersicht praesentieren. Wichtig bei einem solchen Stundeneinstieg ist es auch unbedingt die Stundenziele zu begruenden und damit die Wichtigkeit dieser herauszustellen. Auch kann man die Stundenziele in der Klasse diskutieren. Diese Art von Unterrichtseinstieg ermoeglicht ein hohes Mass an Transparenz. Die Absichten des Lehrenden werden fuer die Schueler durchsichtig und damit nachvollziehbar. „Der informierende Unterrichtseinstieg beruht auf der Annahme, dass Menschen gern etwas sinnvolles tun und dass daher mehr Schueler ihre Lernbereitschaft einschalten werden, wenn sie Ziel und Sinn der Arbeit kennen. Bei den ueblichen Einstiegsformen koennen Schueler keine willkuerliche Lernbereitscha ft entwickeln, weil sie den Sinn des Unterrichts nicht oder nur sehr ungenau kennen.“4 Diese Art des Unterrichtseinstieges habe ich, in der Praxis, im Orientierunspraktikum und auch in meiner persoenlichen Erfahrung, nur selten erlebt. Meist wurde auch in keiner Weise dabei erwaehnt, warum es nun wichtig sei, gerade diesen Stoff zu lernen. Die Rechtfertigung lag zumeist einfach in der Tatsache, dass demnaechst ein Test oder eine Klausur zu dem Thema zu erwarten seien.
Diese Art des Stundenbeginns ist allerdings auch sehr Zeitaufwendig, zumindest in der Einfuehrungsphase, wenn es darum geht, Unterrichtsziele zu diskutieren. Aber aus Gespraechen mit Lehrern entnahm ich, dass es einerseits sehr schwierig sei, so etwas durchzufuehren, weil die Zeit einfach immer sehr knapp ist und die Rahmenrichtlinien dick, aber andererseits sei es auch unbedingt lohnend, weil den Schuelern damit das Recht auf Mitbestimmung suggeriert wird und somit die Bereitschaft im Unterricht Initiative zu zeigen steigt und sich aktiv und produktiv am Unterrichts- und Lerngeschehen zu beteiligen. Eine Lehrerin erzaelte mir auch, dass sie damit sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Wenn sie also auf die Ziele der Stunde zu sprechen kam, gab es oftmals einige Schueler, die ein besonderes Interesse an dem Stoff hatten, zum Beispiel weil es etwas mit ihrem Hobby zu tun hatte, oder such weil sie „Experten“ kannten, vielleicht die Eltern oder Verwandte oder Bekannte, die sie gern befragen wuerden zu dem Thema oder aber gerne einladen wuerden, zu einer Diskussionsstunde. Auf diese Weise bekam die Lehrerin schon oft Rueckmeldung darueber, wie beliebt das Thema bei den Schuelern ist. Dadurch kamen oft positive Impulse fuer die kommenden Stunden zu Stande.
Generell muss ich aber sagen, dass diese Art der Eroeffnung einer Unterrichtstunde in meinem Praktikum nur zweimal vorkam, also sehr selten zu beobachten war. Auf meine Nachfragen hin habe ich dann immer wieder den Einwand der knappen Zeit zu hoeren bekommen. Dazu habe ich in der Literatur einen interessanten Gegenstandpunkt gefunden: „ Lernschwierigkeiten gehoeren mit zum Unterricht und Schueler koennen wichtige Lernerfahrungen machen, wenn solche Meinungsverschiedenheiten in der Klasse besprochen und nicht verdraengt werden. Ich will die Einwaende der Schueler ernst nehmen und zur Diskussion stellen, selbst auf die Gefahr hin, das der Zeitplan der Stunde nicht eingehalten werden kann. Dieses Verfahren zahlt sich langfristig aus, weil Klassen nach und nach lernen, solche Probleme schneller zu loesen.“5
Eine andere in der Literatur beschriebene Moeglichkeit Motivation bei den Schuelern hervorzurufen, ist die des Ausloesens positiver reziproker Affekte. Dazu kann ein Lehrer zum Beispiel zu Unterrichtsbeginn mit einem kurzen persoenlichen Gespraech starten, zum Beispiel in dem er sich nach dem aktuellen Stand der Rettungsschimmerausbildung eines seiner Schueler erkundigt. Eine andere Variante ist zum Beispiel einen Witz zu erzaehlen oder die Klasse fuer ihre besondere Mitarbeit in der letzten Stunde zu loben, oder fuer ihren besonderen Einsatz bei einem Projekt. Auch kann man versuchen die Schueler durch das eigene Engagement „anzustecken“. Wichtig dabei ist, davon auszugehen, bzw. davon ueberzeugt zu sein, dass die Schueler (zumindest die Meisten) vernue nftig genug sind, den Sinn darin zu erkennen, diesen Stoff zu verstehen und zu lernen. Essentiell ist auch, dass ich als Lehrer auch davon ueberzeugt bin, dass das Thema wichtig und sinnvoll ist. Nur dann kann ein Lehrer das Thema auch ueberzeugend vertreten und lehren, und damit die Schueler in ausreichendem Masse zum Lernen motivieren.6
Diese Art des Hervorrufens von Motivation bei den Schuelern habe ich im Laufe meines Praktikums haeufig beobachten koennen. Besonders in einigen Geschichts- und Englischstunden habe ich LehrerInnen erlebt die voll und ganz hinter den Inhalten standen, die sie lehrten. Dadurch entstand in der Klasse eine Stimmung, die sehr geschaeftig war, die das Lernen und Verstehen sehr gut unterstuetzte. Ich habe in dem Praktikum den Eindruck gewonnen, dass das „Hinter dem Thema stehen“ des Lehrers den gleichen Effekt hat, wie das Entgegenbringen von Sympathien fuer einen Lehrer bei den Schuelern. In beiden Faellen setzt eine Motivation bei den Schuelern ein, die dem Unterricht und damit auch dem Lernen sehr dienlich ist.
In der Literatur wird vielerorts auch beschrieben, dass das gemeinsame Planen von Unterricht eine besondere Motivation nach sich zieht. Die Vorteile dieser Art von Unterricht liegen auf der Hand: der Unterricht ist viel transparenter, er wird von den Schuelern mitgetragen, denn sie fuehlen sich nun mitverantwortlich, planen, organisieren und denken demnach eher mit. Der Lehrer muss in diesem Fall nicht mehr nur dirigieren, befehlen, veranlassen, sondern kann durch Anr egungen und Vorschlaege positiv in das Unterrichtsgeschehen eingreifen. Ein weiterer positiver Aspekt dieser Art von Unterricht ist sicherlich auch, dass die Schueler zunehmend in die Lage versetzt werden, Lernvorhaben selber zu planen und durchzufuehren. Dies finde ich ins Besondere im Hinblick auf ein kommendes Studium besonders wichtig. Generell laesst sich hierzu jedoch sagen, dass es sehr schwer ist, diese Art Unterricht in der Praxis zu verwirklichen. Oftmals, besonders in den Faechern Mathematik und in den Fremdsprachen, ist der Lernstoff Jahr fuer Jahr sachlogisch aufeinander bezogen, so dass es nur selten moegich sein wird, derartiges durchzusetzen und in die Tat umzusetzen. Bei Zusatzangeboten von Themen besteht dann doch hin und wieder die Moeglichkeit, die Schueler an der Planung zu beteiligen. Dadurch dokumentiert der Lehrer sein Interesse an seiner Beziehung zu den Schuelern und an deren Lernerfolg und es wird deutlich, dass er keine ungerechtfertigten Leistungsansprueche stellen und die Schue ler nicht unnoetig unter Druck setzen will. Dadurch wird es moeglich Aengste abzubauen - und so ein das Lernen .unterstuetzendes Klima zu schaffen, ein Klima der Motivation.
Wenn aber manche Schueler in der Klasse besondere Kenntnisse auf manchen Gebieten haben, dann kann es unter Umstaenden moeglich werden, eine Unterrichtsplanung mit diesen Schuelern vorzunehmen. Das schafft Vertrauen. Und das vom Lehrer diesen Schuelern entgegengebrachte Vertrauen wird sich lohnen, denn welchem Schueler gefaellt es nicht, mit Anerkennung fuer seine besonderen Leistungen entlohnt zu werden?7
Eine weitere Moeglichkeit die Schueler zu motivieren ist die, hin und wieder die Sozialformen zu wechseln. Unter einer Sozialform versteht man die Art und Weise, wie ein Lehrer die Schueler zum Lernen organisiert, oder diese sich selbst organisieren. Durch einen Wechsel der Sozialformen erreicht man eine abwechlungsreichere Gestaltung des Unterrichtes. „Die Schueler werden dadurch aktiviert und motiviert, koennen sich einbringen, auseinandersetzen und lernen miteinander umzugehen.“8
Wenn ein Lehrer also in seinem Unterricht hin und wieder einmal die Sozialformen wechselt, also seinen Unterricht mit Phasen von Gruppen-, Einzel-, Partner-, oder Kleingruppenarbeit durchsetzt, werden seine Schueler viel mehr am Unterrichtgeschehen teilnehmen, aktiv daran teilhaben und letztendlich viel mehr aus dem Unterricht mitnehmen, also effektiver lernen. Auch durch einen gezielten und gut abgestimmten Medieneinsatz laesst es sich oftmals bewerkstelligen, die Schueler zum Lernen zu motivieren. An einer Unterrichtsstunde, in der die Schueler mit nur einem Medium, der Sprache, konfrontiert werden, sind die Schueler sicher ueberfordert, denn auf diese Weise werden die Sinneskanaele nur einseitig angesprochen und die Schueler werden keinen Spass an dem Thema und an der Stunde haben, denn sie werden nicht umfassend gefoerdert und gefordert. Eine Folge davon kann sein, dass die Schueler aggressiv werden und nicht mehr mitarbeiten, also nur das Gegenteil vo n Motivierung eintritt.
Das Prinzip der Anschauung ist in der Didaktik schon seit Comenius, also seit dem 17. Jahrhundert bekannt und anerkannt und wurde seit dem schon von vielen anerkannten Paedagogen aufgegriffen. Der Einsatz von Schaubildern, Skizzen, Folien, Landkarten und vielem mehr lockert den Unterricht auf und laesst ein besseres, motivierteres Lernklima entstehen.9
In der Literatur erfaehrt man an verschiedenen Stellen, dass der Medieneinsatz auch die Gefahr der Reizueberflutung in sich birgt. Vor allem das Internet mit seiner schier unbegrenzten Menge an verfuegbaren Informationen, das von sehr vielen Schuelern genutzt werden duerfte, kann den Unterricht bereichern. Allerdings besteht auch die Moeglichkeit der Reizueberflutung, wenn dieses Medium falsch oder zu oft im Unterricht zum Einsatz kommt. Dies gilt aber genauso fuer alle anderen Medien im Unterricht.
In meiner Erfahrung als Schueler kann ich sagen, dass es fuer uns immer ein highlight war, wenn ein Lehrer uns einen Film sehen liess.
Vor allem in der Oberstufe wurden dann Folien fuer uns immens wichtig, weil darauf fuer gewoehnlich alles wirklich wichtige aus der Stunde zusammengefasst war und man es dann nur noch abzuschreiben brauchte. Diese Methode wurde von unseren Lehrern vor allem in den Leistungskursen angewandt, in denen eine sehr grosse Stoffuelle die Zeit immer wieder sehr knapp werden liess.
In den unteren Klassen vor allem kommt auch noch haeufig das Tafelbild um Einsatz.
Aus der Erfahrung als Schueler und der aus meinem Praktikum laesst sich auch bestaetigen, dass der Medieneinsatz oft auch ganz klar an den Faehigkeiten ( Angst vor Pannen bei der Bedienung eines Videorecorders) und Vorlieben der LehrerInnen liegt. Ich weiss zum Beispiel um meinen Philosophielehrer, der in der ganzen Schule und darueber hinaus, bekannt fuer seine etwas seltsamen und fuer jemanden, der der Stunde nicht beigewohnt hat, nicht nachvollziehbaren Tafelbilder war. Sie waren fuer uns, seine Schueler ausserst lehr- und hilfreich fuer das Verstaendnis von ohnehin schwer nachvollziehbaren philosophischen Texten.
Zusammenfassend laesst sich sagen, dass es eine Vielzahl von Moeglichkeiten gibt, Schueler in die Lage zu versetzen, effektiven Unterricht zu erleben und effektiv und mit Spass lernen zu koennen. Oftmals bedarf es nur ein wenig Phantasie um das Lernen schoener zu gestalten. Es bleibt zu hoffen, dass es vielen LehrerInnen gelingen wird, einen solchen Unterricht anzubieten und zu vollziehen.
Persoenliche Stellungnahme um Orientierungspraktikum
1. Gesamteindruck vom Orientierungspraktikum
Grundsaetzlich kann ich sagen, dass mir das Orientierungspraktikum sehr viel Spass gemacht hat, obwohl es fuer mich mit einigen Tuecken verbunden war. Durch mein bevorstehendes Auslandsstudium, war fuer mich die Zeit waerend des Praktikums extrem knapp, da ich noch sehr viel vorzubereiten hatte. Erleichternd fand ich, das Praktikum an der Schule zu machen, an der ich auch mein Abitur gemacht habe, da ich noch viele Lehrer kannte und man so viel leichter ins Gespraech kam, als das sonst der Fall gewesen waere. Auf diese Weise habe ich manches erfahren, was den Unterricht und den Umgang mit den Schuelern betrifft, das ich sonst mit Sicherheit nicht erfahren haette.
Irgendwie war es zu Beginn etwas seltsam in die „geheiligten Raeume“, das Lehrerzimmer, nun ganz selbstverstaendlich gehen zu koennen und fuer meine alten Lehrer war es auch etwas befremdlich. Am ersten Tag meines Praktikums setzte eine Lehrerin, als ich an die Tuer des Lehrerzimmers klopfte, schon dazu an, mich hinauszuwerfen, wurde sich aber gerade noch rechtzeitig darueber klar, dass ich ja nun gar keine Schuelerin mehr bin, mein Aufenthalt im Lehrerzimmer als durchaus gerechtfertigt sein koennte.
Die Kombination aus erlebter Praxis in der Schule und der Theorie in der Literatur oder auch im Seminar, habe ich als sehr positiv erlebt. Es war sehr interessant, noch einmal komprimiert jeden Tag Unterricht zu erleben und beobachten zu koennen.
In der „ausserunterrichtlichen Aktivitaet“ habe ich fuer mich allerdings nicht viel Sinn entdecken koennen. Da ich gezwungener massen mein Praktikum direkt nach den Sommerferien machen musste, waren die meisten AG`s erst im Entstehen begriffen, die Elternabende folgten erst spaeter und auch sonst war man in der Schule noch voll und ganz mit der Auswertung der Sommerferien und dem Erstellen neuer Stundenplaene beschaeftigt. Ausserdem sind ungluecklicher weise gleich mehrere Lehrer erkrankt, mehrere Klassen und natuerlich auch Lehrer zu Klassenfahrten unterwegs gewesen, so dass es fuer uns zwei Praktikanten an dieser Schule sehr schwierig wurde, ueberhaupt unser Stundenpensum dort zu schaffen, da manche Lehrer auch noch strikt dagegen waren, dass wir an ihrem Unterricht teilhaben durften. So haben wir dann einige wenige sehr nette LehrerInnen sehr haefig „heimgesucht“ und manche Klassen kannten mich schon richtig gut, so dass die Lehrer mich nicht mehr vorzustellen brauchten.
So war mein erstes Praktikum an einer Schule von diversen unguenstigen Faktoren ueberschattet, aber ich fand es trotzdem hilfreich.
2. Aufgabenstellungen
Die formale Aufgabenstellung, 30 Stunden zu hospitieren, erschien mir persoenlich , zu lang. Wenn man als Prakikant diese Stundenzahl erbringen soll, dann waere es sinnvoll, einen laengeren Zeitraum als zwei Wochen zu waehlen. Das wuerde ich aber auch nicht als sinnvoll erachten. Aber mit diesem Stundenpensum ist man in der Schule immer nur ein Stoerfaktor. Es geben sich zwar alle Muehe, diesen Fakt zu ueberspielen, aber grundsaetzlich ist das erst einmal der Fall. Insofern fand ich vorgegebene Anzahl zu erbringender Stunden zu hoch. Wie bereits erwaehnt, habe ich in der ausserunterrichtliche Aktivitaet, ich nahm passiv an einer Volleyball AG teil, nicht wiklich einen Sinn gesehen.
Fuer die Unterrichtsprotokolle und die Unterrichtsbeobachtung fand ich unser Seminar und die damit verbundenen Hospitationen sehr hilfreich. Sie haben uns damals sehr praktisch erklaert, wie man diesen Teil der Arbeit am besten angeht.
Die Beobachtungsaufgaben fand ich zum Teil sehr gut, zum Teil aber auch nicht sinnvoll, oder nur sehr schwer zu beantworten.
Die Bearbeitung des Themenschwerpunktes hat mir sehr viel Spass gemacht, weil mich das Thema auch sehr interessiert.
3. Zusammenarbeit mit dem Kontaktlehrer, mit anderen Fachlehrern
Die Zusammenarbeit mit dem Kontaktlehrer und mit den anderen Fachlehrern war grundsaetzlich sehr gut. Besonders die Geschichtslehrer waren mir gegenueber sehr aufgeschlossen und gaben mir auf meine Nachfragen immer wieder Auskunft, was mir bei der Bearbeitung der Beobachtungsaufgaben sehr zu Hilfe kam. Die Kontaktlehrerin an der Schule hat mir auch immer wieder sehr gern weitergeolfen. Unser Verhaeltnis war und ist sehr gut.
4. Berufswunsch
Nach wie vor habe ich den Wunsch Lehrerin zu werden. Meine Einstellung zu meinem Berufswunsch hat sich waehrend des Praktikums nur noch verstaerkt. Ich sehe in diesem Beruf die Aufgabe, die mich eines Tages ausfuellen wird.
Ich bin aus diesem Grunde jetzt noch mehr motiviert, mein Studium fortzusetzen und zu beenden, um dann spaeter in diesem Beruf arbeiten zu koennen.
5. Erlernbarkeit des Lehrerberufes
Das Praktikum hat mir in Kombination mit dem Literaturstudium den Eindruck vermittelt, dass besimmte Dinge, die einen gute Lehrer auszeichnen, nicht erlernbar sind, andere wiederum aber trainiert werden muessen. Ich denke, dass ich die Faehigkeiten und Eigenschaften, die man haben muss, um ein guter Lehrer zu sein, die aber nicht erlernbar sind, durchaus aufweise und dass ich ( hoffentlich!) genug Moeglichkeiten zum „trainieren“ bekommen werde.
6. Einfuehrungsseminar zum Orientierungspraktikum
Das Seminar fand ich sehr informativ und sehr gut strukturiert. Auf Grund dessen, was wir im Seminar erarbeitet haben, fiel es mir dann viel leichter, die Aufgaben zum Praktikum zu loesen und den richtigen Zugang zu der entsprechenden Literatur zu finden.
[...]
1 Goetz, Klaus, Haefner, Peter, Didaktische Organisation von Lehr- und Lernprozessen, Ein Lehrbuch fuer Schul- und Erwachsenenbildung, 2.durchgesehene Auflage, Weinheim 1992, S.121
2 ebenda
3 ebenda (1), S. 123
4 Grell, Jochen, Grell, Monika, Unterrichtsrezepte, Weinheim und Basel 1993, S.107
5 Grell, Unterrichtsrezepte, S. 107
6 ebenda, S. 106
7 Becker, Georg E.,Planung von Unterricht Handlungsorientirete Didaktik, Teil I, 4. unveraenderte Auflage, Weinheim und Basel 1991, S. 94 ff.
8 Ebenda, S. 103
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text behandelt die Bearbeitung eines frei wählbaren Themenschwerpunktes mit dem Fokus auf die Motivation zum Lernen.
Wie definiert der Text Motivation?
Motivation wird als die Grundlage aller menschlichen Handlung, besonders in Lernprozessen, definiert. Sie hängt von individuellen Voraussetzungen und Umweltgegebenheiten ab.
Welche Arten von Motivation werden unterschieden?
Es wird grundsätzlich zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation unterschieden.
Was ist extrinsische Motivation?
Extrinsische Motivation bezieht sich auf Motive und Anreize, die außerhalb der Sache selbst liegen, wie z.B. Ehrgeiz, Angst vor Strafe oder Streben nach Erfolg.
Was ist intrinsische Motivation?
Intrinsische Motivation kommt aus dem Aufforderungsgehalt der Sache selbst, also der Neugierde, die der Sache entspringt.
Welche Form der Motivation ist laut Text tragfähiger?
Intrinsische Motivation wird als die tragfähigere angesehen, da sie zu effizienteren Lernprozessen führt.
Welche Möglichkeiten zur Förderung von Motivation werden genannt?
Der Text nennt informierende Unterrichtseinstiege, das Auslösen positiver reziproker Affekte, gemeinsames Planen von Unterricht, Wechsel der Sozialformen und den Einsatz von Medien.
Was ist ein informierender Unterrichtseinstieg?
Ein informierender Unterrichtseinstieg bedeutet, den Schülern mitzuteilen, was sie in der Stunde lernen sollen und warum es wichtig ist.
Wie kann man positive reziproke Affekte auslösen?
Dies kann durch persönliche Gespräche, Witze, Lob oder das eigene Engagement des Lehrers geschehen.
Welche Vorteile hat die gemeinsame Unterrichtsplanung mit Schülern?
Der Unterricht wird transparenter, die Schüler fühlen sich mitverantwortlich, planen mit und der Lehrer kann durch Anregungen positiv eingreifen.
Warum ist ein Wechsel der Sozialformen wichtig?
Ein Wechsel der Sozialformen macht den Unterricht abwechslungsreicher und aktiviert die Schüler.
Welche Rolle spielen Medien im Unterricht?
Der Einsatz von Medien kann den Unterricht auflockern und ein besseres Lernklima schaffen, birgt aber auch die Gefahr der Reizüberflutung.
Was sind die Haupteindrücke des Orientierungspraktikums?
Das Praktikum wird grundsätzlich als positiv und hilfreich erlebt, trotz einiger Schwierigkeiten. Die Kombination aus Theorie und Praxis wird als wertvoll angesehen.
Wie wird die Zusammenarbeit mit Lehrern während des Praktikums bewertet?
Die Zusammenarbeit mit den Kontaktlehrern und anderen Fachlehrern wird als grundsätzlich sehr gut beschrieben, besonders die Aufgeschlossenheit der Geschichtslehrer wird hervorgehoben.
Hat das Praktikum den Berufswunsch bestärkt?
Ja, der Wunsch, Lehrerin zu werden, hat sich während des Praktikums noch verstärkt.
Sind alle Aspekte des Lehrerberufs erlernbar?
Der Text vermittelt den Eindruck, dass manche Dinge, die einen guten Lehrer auszeichnen, nicht erlernbar sind, andere aber trainiert werden müssen.
- Quote paper
- Simone Grassmann (Author), 2000, Zum Lernen motivieren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103935