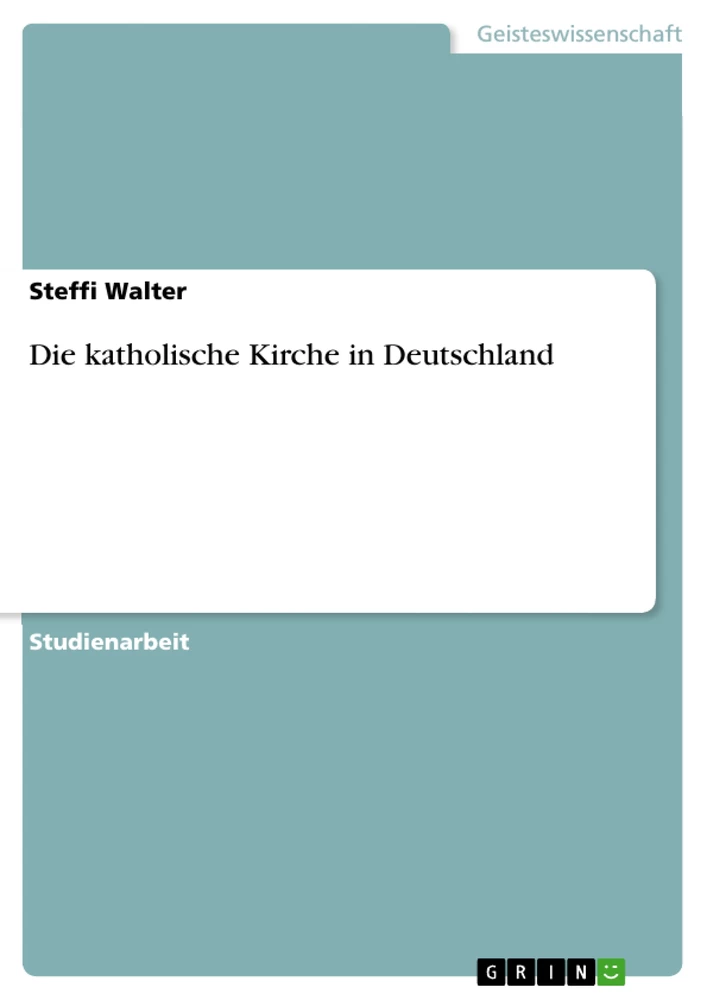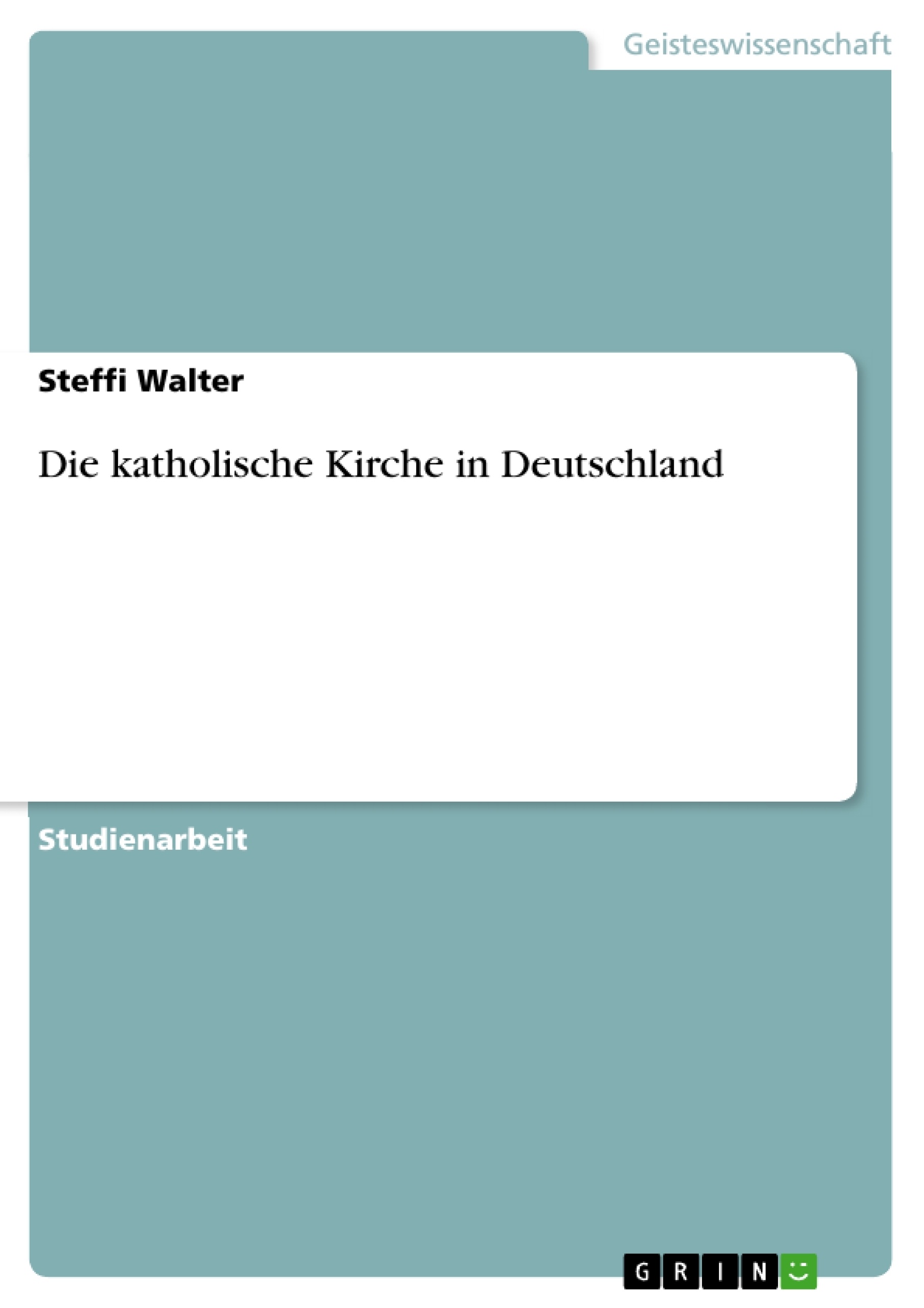1. Einleitung
Im Januar 1998 gab es in der Öffentlichkeit große Aufruhr und hitzige Diskussionen um ein Schreiben von Papst Johannes Paul II an die deutschen Bischöfe, in dem er darum bat, den für eine straffreie Abtreibung gesetzlich vorgeschriebenen Nachweis über eine Schwangerschaftskonfliktberatung nicht mehr auszustellen. Dieser Schritt des Vatikans wurde von vielen Seiten stark kritisiert und versetzte die deutschen Bischöfe in eine sehr schwierige Lage. Die deutsche Öffentlichkeit zeigte mehrheitlich Unverständnis für das Vorgehen des Papstes.
Warum kam es zu dem Papstbrief, der die deutschen Bischöfe in eine so schwierige Lage brachte? In dieser Hausarbeit wird die These vertreten, daß die katholische Kirche aufgrund ihrer starken Organisationskultur keinen Sonderweg einer Ortskirche oder eines sonstigen Subsystems zulassen kann, wenn dieser der Organisationskultur und den von dieser getragenen Normen und Werten widerspricht, auch wenn dieser Sonderweg aufgrund einer besonderen Situation gerechtfertigt oder sogar besser erscheint.
2. Organisation katholische Kirche
Die katholische Kirche ist eine der ältesten Organisationen der Welt. Sie besteht seit fast 2000 Jahren und hat weltweit beinahe eine Milliarde Mitglieder. Sie weist eine bürokratische Organisationsstruktur auf und ist stark hierarchisch gegliedert.
An der Spitze dieser Hierarchie steht der Papst, der als ‚Stellvertreter Jesu Christi‘ die volle und oberste Gewalt der Rechtsentscheidungen in der gesamten Kirche innehat und als unfehlbar gilt. Er ist dafür verantwortlich, daß die Einheit von Glaube und Kirche gewahrt bleiben.
Auf der nächsten Hierarchieebene ist die katholische Kirche in Jurisdiktionsbezirke, die Bistümer bzw. Diözesen, gegliedert. Jede Diözese wird von einem Bischof geleit et. Die Bischöfe werden vom Papst ernannt und schwören auf ihn und seine Nachfolger den Treueeid. Innerhalb ihrer Diözese haben die Bischöfe insbesondere seit dem II. Vatikanischen Konzil weitreichende Handlungskompetenzen. Innerhalb Deutschlands haben sich die deutschen Bischöfe zur Deutschen Bischofskonferenz zusammengeschlossen, um kirchliche Entscheidungen in Deutschland zu koordinieren.
Die dritte Ebene in der Hierarchie der katholische Kirche stellen die Gemeinden dar, denen ein Priester vorsteht. Die Gemeinde ist die kleinste organisatorische Einheit der katholische Kirche. Auf der vierten Ebene stehen schließlich die einzelnen Mitglieder der Kirche, insbesondere die Laien, die aber nicht alle aktiv an der K irche beteiligt sind.
3. Die Organisationskultur der katholische n Kirche
3.1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Begriff der ‚Organisationskultur‘
3.1.1. Definition
Jede Organisation besitzt eigene „bewußt oder unbewußt kultivierte, symbolisch oder sprachlich tradierte Wissensvorräte und Hintergrundüberzeugungen, Denkmuster und Weltinterpretationen, Wertvorstellungen und Verhaltensnormen“ (Schreyögg, 1996, 429), die das Verhalten der Organisationsmitglieder und der Funktionsbereiche nachhaltig prägen. Diese Wert- und Denkmuster werden als Organisationskultur bezeichnet.
Die Kernmerkmale einer Organisationskultur sind nach Schreyögg (ebd., 429 ff) die Implizitheit der Orientierungsmuster, die Kollektivität, die Vermittlung von Sinn und Orientierung durch die Organisationskultur. Ferner ist sie gekennzeichnet durch die Emotionalität, den Umstand, daß die Organisationskultur als historischer Lern- und Sozialisationsprozeß entstanden ist und die Tatsache, daß Symbole eine wichtige Rolle spielen.
Eine Organisationskultur besitzt meist mehrere Subkulturen, die sich in Teilbereichen der Organisation ausbilden. “Subkulturen folgen im Grunde derselben Entwicklungs- und Aufbaulogik wie (Gesamt-) Kulturen, d.h. sie zeichnen sich durch eigene Wertvorstellungen, Standards usw. wie auch durch eine eigene Symbolik aus.“ (Schreyögg, 1996, 444) Sie teilen in der Regel mit der Gesamtkultur die wesentlichen Grundannahmen, bilden dabei aber ein spezifisches Referenzsystem aus, das von den besonderen Umweltbedingungen des Teilbereiches geprägt wird.
3.1.2. Kennzeichen einer starken Organisationskultur
Georg Schreyögg (Schreyögg, 1996, 441ff) führt drei Kriterien an, anhand derer die Stärke einer Orga nisationskultur beurteilt werden kann: Prägnanz, Verbreitungsgrad und Verankerungstiefe.
Prägnanz bedeutet hier einerseits die Konsistenz der von der Organisationskultur vermittelten Werte, Standards und Symbolsysteme und andererseits das Ausmaß, wie umfassend die kulturellen Orientierungsmuster angelegt sind. Das Kriterium Verbreitungsgrad zielt auf das Ausmaß ab, in dem die Organisationsmitglieder die Organisationskultur teilen. Die Verankerungstiefe stellt schließlich einerseits darauf ab, „ob und inwieweit die kulturellen Muster internalisiert, also zum selbstverständlichen Bestandteil des täglichen Handelns geworden sind“ und beinhaltet gleichzeitig die Stabilität der Organisationskultur über einen längeren Zeitraum, also ihre Persistenz.
Starke Organisationskulturen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Prägnanz, Verbreitungsgrad und Verankerungstiefe aus.
3.2 Die Organisationskultur der katholischen Kirche
Grundsätzlich betont die Kirche ihre vier Wesenseigenschaften: Einheit, Katholizität (räumlich-zeitlich universale Sendung), Apostolizität (Wesensgleichheit mit der Kirche der Apostel in Lehre und Sakramenten) und durch Jesus Christus gestiftete Heiligkeit. Aus diesen vier Wesenseigenschaften resultieren die meisten Organisations merkmale der katholische Kirche.
Der christliche Glaube in der katholischen Auslegung liegt den Wertvorstellungen und Orientierungsmustern der katholischen Kirche zugrunde. Er bildet somit die Basisannahmen der Organisationskultur. Die Richtigkeit der katholischen Auslegung wird durch die Apostolizität begründet. Die katholische Kirche ist wegen der durch Jesus Christus gestifteten Heiligkeit davon überzeugt, die einzig wahre und gottgewollte Kirche zu sein. Dies erklärt auch die Vehemenz, mit der stärker abweichende Meinungen innerhalb der katholischen Kirche abgelehnt und sanktioniert werden.
Während Apostolizität und Heiligkeit eher auf der religiösen Ebene ihre Ausprägung gefunden haben, werden Einheit und Katholizität in der Organisation der Kirche konkret umgesetzt. Die katholische Kirche ist eine weltweite Organisation, die auf allen Erdteilen und in fast jeder Gesellschaft vertreten ist, genau wie es ihrem Sendungsauftrag entspricht. Das Symbolsystem ist bei der Kirche in allen Ländern ungefähr das Gleiche. So kann jeder Katholik einen Gottesdienst in einer anderen Sprache und in einem anderen Land problemlos mitfeiern, da der Ablauf streng festgelegt ist. Dasselbe gilt prinzipiell für die Normen und Standards. Dennoch ist jede Region der Erde von unterschiedlichen gesellschaftlichen, politischen, geographischen etc. Verhältnissen geprägt, die mit den Basisannahmen der katholischen Organisationskultur in Konflikt stehen können und somit Druck auf diese ausüben können. Daher ist durch die weltweite Präsenz der katholische Kirche ihre Einheit gefährdet. Um ihre Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten muß die katholische Kirche folglich darauf achten, überall auf der Welt nach den gleichen Prinzipien zu handeln. Eine Ungleichbehandlung zweier Regionen würde die Wesenseigenschaft Einheit gefährden und würde auch im Widerspruch zum Prinzip der Apostolizität stehen.
Untersucht man die Stärke der Organisationskultur der katholische n Kirche, kommt man zu folgendem Ergebnis: Sie weist relativ konsistente Orientierungsmuster auf, die sehr umfassend angelegt sind. Sie ist also sehr prägnant. Sie ist auch durch einen sehr hohen Verbreitungsgrad gekennzeichnet, da sich fast alle Angehörige der katholische Kirche in ihrem Handeln von den katholischen Orientierungsmustern und Werten leiten lassen. Das dritte Kriterium, die Verankerungstiefe, insbesondere die Persistenz, kann auch in großem Ausmaß bei der katholische Kirche beobachtet werden. Es läßt sich also feststellen, daß die katholische Kirche eine außergewöhnlich starke Organisationskultur aufweist.
4. Die katholische Kirche in Deutschland
„In westlich geprägten Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland hat es in neuester Zeit einen tiefgreifenden Frömmigkeitswandel gegeben" (Klöcker, 1997, 5), der die Stellung der katholische Kirche in Deutschland stark beeinflußt hat. Anzeichen dieses Frömmigkeitswandels sind beispielsweise der hohe Prozentsatz an Kirchenaustritten (momentan ca. 0,6% der Gesamtzahl deutscher Katholiken jährlich), der starke Rückgang des Kirchgangs oder die stark rückläufigen Zahlen der Studienanfänger in Theologie mit dem Ziel, Priester zu werden (von 1986 bis 1996 Rückgang um 70%). Insbesondere im Privatleben der deutschen Katholiken ist der Einfluß der Kirche stark zurückgegangen. Gemeinsame Tischgebete beispielsweise sind heute nicht mehr üblich, und die Sexualmoral der katholische Kirche findet nur noch sehr selten ihren Niederschlag im Leben der deutschen Katholiken.
Dieser Frömmigkeitswandel ist hauptsächlich auf die westliche Denkweise in Deutschland zurückzuführen: demokratische, liberale und pluralistische Ideen sind schlecht mit der konservativen und traditionellen Grundhaltung der Kirche vereinbar und stoßen sich insbesondere an der Eigengesetzlichkeit kirchlicher Machtstrukturen. Forderungen nach einer weniger dogmatischen und realitätsnäheren Kirche sind vor diesem Hintergrund zu betrachten. Grundsätzlich kann man beobachten, daß in Deutschland eine Unzufriedenheit mit der Organisationskultur der katholische Kirche besteht.
Daher ist die katholische Kir che in Deutschland zur Zeit in einer schwierigen Lage. Sowohl durch die öffentliche Meinung als auch durch die eigenen Mitglieder steht sie unter starkem Druck sich zu ändern, um den neuen Normen und Werten gerecht zu werden. Neben der starken Kirchenkritik gibt es allerdings noch zwei weitere Charakteristiken der katholische Kirche in Deutschland: Ihre starke Einbindung in das Sozialsystem und ihr fest geregeltes Verhältnis zum Staat.
In Deutschland wird im sozialen Bereich nach dem Subsidiaritätsprinzip ge handelt, was bedeutet, daß der Staat hier so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig eingreift, grundsätzlich aber private Träger wie zum Beispiel die Kirchen bei Tätigkeiten im sozialen Sektor Vorrang haben. Deshalb betreibt die Kirche eine große Anzahl von Altersheimen, Kindergärten, Behinderteneinrichtungen etc. Durch ihr soziales Engagement entlastet die katholische Kirche den Staat erheblich. Allerdings läuft sie damit hin und wieder Gefahr, „daß sie sich so stark in das öffentliche System einbinden läßt, daß sie ihre christliche Identität einbüßt.“ (Hilpert, 1997, 47) Im Gegensatz zur sonst vorherrschenden Kirchenkritik werden die sozialen kirchlichen Tätigkeiten in der Öffentlichkeit mehrheitlich positiv beurteilt.
Das Verhältnis von Kirche und deutschen Staat beruht auf dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der strikten rechtlichen und organisatorischen Trennung. Es ist durch das Staatskirchenrecht, das im wesentlichen aus Konkordaten besteht, geregelt. Darin wird der Kirche der Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts zuerkannt und weitgehende Vorrechte im Bildungs- und Sozialbereich eingeräumt. Infolgedessen hat sie bis heute Einfluß auf Entwicklungen in diesen Sektoren. Die Einbindung der Kirchen in den Staat zeigt sich auch am Beispiel der Kirchensteuer, die an die (staatlich festgelegte) Lohnsteuer gekoppelt ist und vom staatlichen Finanzamt eingezogen wird.
Die Organisationskultur der katholischen Kirche in Deutschland stimmt in allen wesentlichen Punkten mit der Gesamtkultur der katholische n Weltkirche überein. Aufgrund der oben geschilderten besonderen Situation der katholische Kirche in Deutschland weist die Organisationskultur der deutschen Ortskirche allerdings einige Eigenheiten auf. Es handelt sich hierbei also um eine Subkultur. Allgemein fällt auf, daß die Subkultur stärker als die Gesamtkultur auf die gesellschaftliche Realität in Deutschland eingeht. Sie ist pragmatischer, undogmatischer und liberaler und damit realitätsnäher.
5. Die gegenwärtige Abtreibungsregelung in Deutschland
5.1 die Gesetzeslage
Nach der Wiedervereinigung 1990 wurde eine Neuregelung des Abtreibungsrechts notwendig, da in der ehemaligen DDR und der BRD unterschiedliche Regelungen in Kraft waren. Die Neuregelung gestaltete sich als langwieriger und schwieriger Prozeß, in dem unter anderem das Bundesverfassungsgericht eine maßgebliche Rolle spielte. Die heute gültigen Rechtsnormen stammen aus den Jahren 1995 und 1996.
Die relevanten Gesetze zum Thema Schwangerschaftsabbruch sind das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgestz (SFHÄndG), das Schwangerschaftskonfliktgestz (SchKG) und §§ 218 bis 219b des Strafgesetzbuches (StGB).
Grundsätzlich ist ein Schwangerschaftsabbruch nach diesen gesetzlichen Regelungen immer rechtswidrig, bleibt aber straffrei, wenn gewisse Indikationen vorliegen oder wenn der Eingriff in den ersten 12 Schwangerschaftswochen durchgeführt wird, die Frau mindestens drei Tage vor dem Schwangerschaftsabbruch in einer staatlich anerkannten Beratungsstelle an einer Schwangerschaftskonfliktberatung teilgenommen hat und dies durch eine Bescheinigung nachweisen kann. Dabei weist der Gesetzgeber aber ausdrücklich darauf hin, „daß das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch [der Frau] gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und daß deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann“ (§219 I StGB). Ob aber eine Ausnahmesituation vorliegt, liegt nach der gegenwärtigen Regelung allein im Ermessen der Frau selbst. Diese Regelung, die als ‚erweiterte Fristenlösung‘ bezeichnet werden kann, ist in der Welt einzigartig.
5.2 Das plurale Beratungssystem
Durch die gegenwärtige Gesetzeslage ist der Staat verpflichtet, für ein flächendeckendes Netz an Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen zu sorgen. Dabei setzt das Gesetz ausdrücklich fest, daß auch die Beratungsstellen freier Träger gefördert werden sollen, denn „die Ratsuchenden sollen zwischen Beratungsstellen unterschiedlicher weltanschaulicher Ausrichtung auswählen können“ (§ 3 SchKG). Gegenwärtig beteiligen sich u.a. PRO Familia, die AWO, Gesundheitsämter, das Diakonische Werk (evange lische Kirche), die Caritas und der Sozialdienst katholischer Frauen (beide katholische Kirche) am staatlichen Beratungssystem.
Die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen bedürfen einer besonderen staatlichen Anerkennung. Damit soll gewährleistet werden, daß den ratsuchenden Frauen eine fachgerechte Beratung zuteil wird. Kriterien für die Anerkennung sind, daß die Beratungsstellen „ den Anforderungen, die das Gesetz an Ziel, Inhalt und Organisation stellt, genügen und insbesondere über hinreichend persönlich und fachlich qualifiziertes Personal verfügen, daß sie weitere Fachkompetenz kurzfristig zuziehen können und mit allen Stellen, die Hilfen für Mutter und Kind gewähren, zusammenarbeiten.“ (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 1996, 18)
Die Schwangerschaftskonfliktberatung „dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen.“ (§ 219 I StGB). Dennoch ist die Beratung nach § 5 I SchKG „ergebnisoffen“ zu führen und soll von der Verantwortung der Frau ausgehen.
Nach Abschluß einer Beratung sind die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen verpflichtet, der Schwangeren eine mit Namen und Datum versehene Bescheinigung darüber auszustellen, daß eine Beratung im Sinne des Gesetzes erfolgt ist. Nur mit dieser Bescheinigung kann ein Schwangerschaftsabbruch straffrei bleiben.
5.3 Die katholischen Beratungsstellen
Die katholische Kirche beteiligt sich mit insgesamt 251 Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen am staatlichen Beratungssystem. 125 dieser Beratungsstellen gehören der Caritas, dem Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in Deutschland an, die restlichen 126 Beratungsstellen werden vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), dem Frauenfachverband der Caritas, geführt.
Diese Beratungsstellen werden anteilig von Staat und Kirche finanziert, wobei der staatliche Anteil variieren kann. In Konstanz trägt der Staat beispielsweise 45,94% des Gesamtbudgets der Beratungsstelle des SkF. Als staatlich anerkannte und mitfinanzierte Beratungsstellen müssen die katholischen Beratungsstellen den Anforderungen der in 5.1 und 5.2 erläuterten Gesetze genügen. Dies beinhaltet auch die Ausstellung des Beratungsscheines.
Was also unterscheidet die katholischen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen von anderen Beratungsstellen? Zusätzlich zu den Gesetzen sind die katholischen Be ratungsstellen an die vorläufigen bischöflichen Richtlinien gebunden. Diese wurden von der deutschen Bischofskonferenz erarbeitet und gelten in den Diözesen, in denen der jeweilige Bischof sie erlassen hat. Gegenwärtig sind dies alle deutschen Diözesen außer dem Bistum Fulda. Dort werden auf Weisung des Erzbischofs Dyba, einem ausgesprochenen Abtreibungsgegner, keine Beratungsscheine ausgestellt, die Beratungsstellen Fuldas beteiligen sich also nicht am staatlichen Beratungssystem.
Zusätzlich zu den Gesetzesvorgaben wird in den vorläufigen bischöflichen Richtlinien festgelegt, daß die katholischen Beratungsstellen nicht zu einer Abtreibung raten dürfen. Weiterhin ist es ihnen verboten, Informationen bezüglich Abtreibungen weiterzugeben (z.B. über Ort, Finanzierung etc.) oder sich auf sonstige Art und Weise an Tätigkeiten zu beteiligen, die zur Durchführung oder Vorbereitung eines Schwangerschaftsabbruches gehören. Als Aufgabe der katholischen Beratungsstellen wird allerdings auch ausdrücklich „die Beratung und Begleitung von Frauen nach einer Abtreibung“ (vorläufige bischöfliche Richtlinien, 1996, §8) genannt.
Als weitere Unterschiede der katholischen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen zu anderen Beratungsstellen nannten mir Rosemarie Patt und Christine Hähl von der Beratungsstelle des SkF in Konstanz die weitreichenden Hilfsmöglichkeiten für Mutter und Kind durch die katholische Kirche und die langfristige Betreuung durch den SkF. Außerdem ist festzuhalten, daß die katholischen Beratungsstellen nicht nur Beratung für katholische Frauen anbieten. In Konstanz beispielsweise stellten Katholiken 1997 nur 50% der beratenen Frauen, 9% waren evangelisch und 26% muslimisch.
6 Der Konflikt um den Beratungsschein
6.1 Position Roms zur Abtreibung und zur deutschen Regelung
Die katholische Kirche hat sich schon immer und verstärkt unter Papst Johannes Paul II gegen die Abtreibung eingesetzt. Nach dem christlichen Glauben kommt jedes menschliche Leben aus Gott. Deshalb heißt es in der Enzyklika Evangelium Vitae: „Daher ist Gott der einzige Herr über dieses Leben: Der Mensch kann nicht darüber verfügen.“ (zitiert in: SkF, 1995, 7). Eine Abtreibung ist aus diesem Grunde für die katholische Kirche „die beabsichtigte und direkte Tötung eines menschlichen Geschöpfes in dem zwischen Empfängnis und Geburt liegenden Anfangsstadium seiner Existenz.“ (SkF, 1995, 8)
Obwohl sich die Kirche durchaus bewußt ist, daß es oft ernste und dramatische Gründe sind, die zu einer Abtreibung führen, stellt die „vorsätzliche Vernichtung eines unschuldigen Menschens“ für sie eine schwere Sünde und ein nicht wieder gutzumachendes Verbrechen dar. Deswegen muß die katholische Kirche mit allen ihren Möglichkeiten gegen die Abtreibung kämpfen. Sie akzeptiert daher auch keine Art von Legalisierung oder Straffreiheit von Abtreibungen.
Bezüglich der deutschen gesetzlichen Regelungen verurteilt die katholische Kirche die Möglichkeit straffreier Abtreibungen. Dennoch steht sie der Beratungsregelung grundsätzlich positiv gegenüber, da durch die Beratung sowohl den betroffenen Frauen als auch den ungeborenen Kindern geholfen werden könne.
Als äußerst problematisch beurteilt Rom dagegen die Frage der Beratungsbescheinigung, da diese „die Beratung zugunsten des Lebensschutzes bestätigt, aber zugleich die notwendige Bedingung für die straffreie Durchführung der Abtreibung bleibt.“ (Papst Johannes Paul II, 1998, 7). Dadurch leistet die Kirche nach Auffassung Roms Beihilfe zur Abtreibung. Der Beratungsschein birgt also eine Zweideutigkeit, „die Klarheit und Entschiedenheit des Zeugnisses der Kirche und ihrer Beratungsstellen verdunkelt.“ (ebd., 7)
6.2 Position der deutschen Ortskirche
Die deutsche Ortskirche teilt die Überzeugungen der katholischen Gesamtkirche in der Frage der Abtreibung. In der Erklärung des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz vom 27.1.1998 bekräftigen die deutschen Bischöfe die „grundlegende Einmütigkeit zwischen dem Heiligen Stuhl und den deutschen Bischöfen in der Lehre der Kirche zum Schutz des ungeborenen Lebens und in der Verurteilung der Abtreibung wie auch in der Notwendigkeit einer umfassenden Beratung schwangerer Frauen in Not.“
Die gegenwärtigen gesetzlichen Regelungen betrachtet die deutsche Ortskirche mit großer Sorge, da sie ihrer Auffassung nach „eine weitere Verschlechterung des Lebensschutzes“ darstellen, mit der sich die Kirche „nicht abfinden“ wird (vorläufige bischöfliche Richtlinien, 1996). Außerdem beobachtet die katholische Kirche mit Sorge die gesellschaftlichen Veränderungen, die zu einer zunehmenden Akzeptanz der Abtreibung in der Gesellschaft geführt haben.
Dennoch beteiligt sich die katholische Kirche in Deutschland „aus ihrem Selbstverständnis und ihrem eigenen Auftrag der in Not geratenen Frau und ihrer Familie“ (ebd.) heraus am staatlichen Beratungssystem. Dabei betonen die deutschen Bischöfe jedoch ausdrücklich, daß damit eine Zustimmung zur Gesetzeslage nicht verbunden ist.
Es gibt mehrere Gründe für die Mitwirkung der Kirche am staatlichen Beratungssystem. Einerseits bietet die Beratung der Kirche die Chance, auf die Meinungsbildung der Frau vor der Abtreibung einzuwirken und durch die Beratung insbesondere auch Frauen zu erreichen, die der Kirche sonst fernstehen. Letzteres ist in einem Land wie Deutschland, in dem die Kirche immer größere Schwierigkeiten hat, die Menschen zu erreichen, von besonderer Bedeutung. Andererseits würde ein Rückzug der Kirche aus dem staatlichen System aber auch eine weitere Verschlechterung der Position der katholischen Kirche in der Gesellschaft bedeuten. Im Zusammenhang mit dem Papstbrief kam es im Januar 1998 zu einem Proteststurm in der Öffentlichkeit, bei dem einige Politiker und Journalisten sogar so weit gingen, das gesamte Verhältnis zwischen der katholische Kirche und dem deutschen Staat in Frage zu stellen.
Die Ortskirche vertrat bisher immer die Auffassung, daß es besser sei, durch die Beratung den schwangeren Frauen in ihrem Konflikt zu helfen und durch die Beratung zumindest einiges ‚ungeborene Leben‘ zu retten. Durch die katholischen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen hat die Kirche zumindest einen Einfluß auf die Willensbildung der Frau. Ein Rückzug aus dem staatlichen Beratungssystem wird von vielen Bischöfen und von der Mehrheit der Laien als unterlassene Hilfeleistung angesehen. Dabei ist der Mehrheit der deutschen Bischöfe bewußt, daß ein Beratungsangebot ohne Möglichkeit eines Nachweises von vielen Frauen nicht genutzt werden würde.
Die Haltung der katholische n Kirche in Deutschland bezüglich der Beteiligung am staatlichen Beratungssystem ist also relativ pragmatisch und orientiert sich an der gesellschaftlichen Realität.
6.3 Der Konflikt zwischen Rom und der deutschen Ortskirche bezüglich des Beratungsscheins
6.3.1 Konsequenzen aus der deutschen Regelung für die Weltkirche
Grundsätzlich muß die katholische Weltkirche befürchten, daß die Glaubwürdigkeit der Kirche bezüglich ihrer rigorosen Ablehnung der Abtreibung unter eine Akzeptanz der deutschen Regelung und der Ausstellung der Beratungsbescheinigung leiden würde. Da sich die Kirche in dieser Frage so eindeutig festgelegt hat, ist klar, „daß von kirchlichen Institutionen nichts getan werden darf, was in irgendeiner Form der Rechtfertigung der Abtreibung dienen kann.“ (Johannes Paul II, 1998, 5) Aus dem Gewicht, das die katholische Kirche der Abtreibungsfrage zumißt, ist erklärbar, warum Papst Johannes Paul II in dem Konflikt um den Beratungsschein „eine pastorale Frage mit offenkundigen lehrmäßigen Implikationen, die für die Kirche und für die Gesellschaft in Deutschland und weit darüber hinaus von Bedeutung ist.“ (ebd.)
Wie bereits in 3.2 dargelegt, muß die katholische Kirche als Weltkirche ihr Handeln vor allen Gläubigen in allen Regionen der Erde vertreten können. Auch wenn der deutsche Sonderweg und die Beteiligung der katholischen Beratungsstellen am staatlichen Beratungssystem im Hinblick auf die besondere Situation in Deutschland gerechtfertigt scheinen, dürfen aus der Sicht der Weltkirche dennoch keine Ausnahmen von der offiziellen Position gemacht werden, um nicht die Glaubwürdigkeit der Kirche aufs Spiel zu setzen.
Die deutsche Sonderregelung hat aber noch eine viel weitreichendere Konsequenz für die Weltkirche: eine Tolerierung dieser Regelung könnte die Wesenseigenschaften Einheit und Apostolizität empfindlich gefährden. Die Apostolizität impliziert, daß es nur eine Wahrheit und nur einen richtigen Weg (in der Regel den der Weltkirche) gibt. Deswegen können nicht weitere Wege als richtig akzeptiert werden.
Das Konzept der Einheit der katholischen Kirche wird noch viel nachhaltiger gefährdet: erlaubt die Weltkirche einer Teilkirche, aufgrund der sie umgebenden Umwelt einen Sonderweg zu gehen, könnten auch andere Teilkirchen in anderen Bereichen ihr Recht auf einen länderspezifischen Sonderweg einfordern. Das hervorstehende Charakteristikum der katholischen Kirche und einer der Hauptgründe für ihre Stärke ist jedoch ihre Einheitlichkeit in ihrem Handeln.
6.3.2 Reaktionen auf das Beratungsschein-Dilemma
Um den Konflikt um den Beratungsschein beizulegen, schrieb Papst Johannes Paul II am 11. Januar 1998 einen Brief an die Deutsche Bischofskonferenz, in dem er den deutschen Bischöfen Richtlinien für das zukünftige Verhalten vorgibt.
In seinem Brief rekapituliert der Papst den vorausgegangenen Prozeß der Entscheidungsfindung und legt die oben beschriebene Problematik um den Beratungsschein noch einmal aus seiner Sicht dar. Obwohl er ausdrücklich die Arbeit der katholischen Beratungsstellen und das Engagement der katholische Kirche in Deutschland würdigt und Verständnis für die Besonderheit der deutschen Situation zeigt, bittet er die deutschen Bischöfe in seinem Schreiben „eindringlich [...], Wege zu finden, daß ein Schein solcher Art in den kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen nicht mehr ausgestellt wird.“ (Johannes Paul II, 1998, 7). Dabei überläßt er den deutschen Bischöfen jedoch die praktische Umsetzung.
Ende Januar 1998 tagte die deutsche Bischofskonferenz unter großem öffentlichen Aufsehen und verabschiedete schließlich trotz vorangegangener Meinungsverschiedenheiten einstimmig eine Erklärung, in der die deutschen Bischöfe ankündigten, daß sie der Bitte des Papstes Folge leisten werden. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die einen Weg finden soll, wie die katholische Kirche im staatlichen Beratungssystem verbleiben und gleichzeitig den Vorgaben aus Rom gerecht werden kann. Mitglieder der Arbeitsgruppe sind drei Bischöfe, kirchliche Mitarbeiter, Vertreter der Caritas und des Sozialdienstes katholischer Frauen und Juristen (beispielsweise der ehemalige Verfassungsrichter Böckenförde). Hieran kann man erkennen, daß die deutschen Bischöfe an einer Lösung interessiert sind, die für alle Beteiligten und Betroffenen tragbar ist.
6.3.3 Die starke Organisationskultur als Grund für das Vorgehen der katholischen Kirche in dieser Frage
„Organisationskulturen können [...] die Anpassungsfähigkeit der Organisation selbst beeinträchtigen: Entwicklungsmöglichkeiten, die nicht von der Organisationskultur legitimiert sind, lassen sich nur schwer durchsetzen.“ (Kieser, Kubicek, 1992, 125) Dies gilt ganz besonders für starke Organisationskulturen.
Die Bitte des Papstes an die deutschen Bischöfe, den Beratungsschein in Zukunft nicht mehr auszustellen ist ein gutes Beispiel für diese These. Die Alternative ‚Verbleib im staatlichen Beratungssystem Deutschlands mit Scheinausstellung‘ ist nicht konsistent mit der katholischen Organisationskultur und wird daher von der Weltkirche abgelehnt. Um die deutsche Ortskirche wieder zu einem kulturkonformen Handeln zurückzubringen, hat der Papst mit seinem Schreiben korrigierend in die Entscheidungen der Ortskirche eingegriffen. Obwohl ein Rückzug der Kirche aus der staatlichen Beratung für die katholische Kirche in Deutschland mit vielen negativen Folgen verbunden wäre (vgl. 5.2), macht Rom als Vertreter der Weltkirche in diesem Fall keine Ausnahme. Der Papst hat volle Kenntnis der schwierigen Lage der katholische Kirche in Deutschland, setzt die Befolgung der christlichen Normen und Werte in der katholischen Auslegung - also das Handeln gemäß der Organisationskultur der Kirche - aber als wichtiger an. In seinem Brief unterstreicht der Papst durch Zitate aus dem Neuen Testament, daß sich die Kirche „in unseren Tagen immer mehr von der sie umgebenden Umwelt unterscheiden“ (Johannes Paul II, 1998,2) und gegebenenfalls auch gegen die herrschende Meinung handeln müsse. Dies ist eine logische Folgerung aus der Organisationskultur heraus.
Organisationen mit starken Organisationskulturen laufen Gefahr, neue Ideen durch eine „kollektive Vermeidungshaltung“ (Schreyögg, 1996, 454) abzuwehren, selbst wenn diese Ideen bei objektiver Betrachtung die bessere Alternative darstellen. Organisationen mit starken Kulturen tendieren dazu, nur solche Handlungsmöglichkeiten in Erwägung zu ziehen, die durch ihre Organisationskultur gerechtfertigt sind.
Hätte der Rom die deutsche Regelung stillschweigend akzeptiert und daraus nicht eine pastorale Frage gemacht, wäre die katholische Kirche in Deutschland vermutlich nie in die jetzige heikle Lage gekommen. Die Bedenken des Papstes gegenüber der Beratungsbescheinigung sind verständlich. Die Einheit und Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche in der Abtreibungsfrage wäre aber möglicherweise nie gefährdet gewesen, hätte die deutsche Regelung nicht eine solche Publizität von kirchlicher Seite erfahren. Dennoch scheint in Rom niemand diese Alternative ernsthaft in Erwägung gezogen zu haben. Es erscheint ironisch, daß die einzigartige Regelung in Deutschland, die eingeführt wurde um den Schutz des ungeborenen Kindes im Vergleich zum Modell einer Fristenlösung zu verbessern, von der Kirche zu einem solchen Problem gemacht wurde. Daß die deutsche Regelung von Rom nicht akzeptiert und statt als Modellösung als Gefahr für die Kirche gesehen wurde, kann zum großen Teil auf ihre Organisationskultur zurückgeführt werden. Die Organisationskultur der katholischen Kirche zieht eine eindeutige, der katholischen Lehre entsprechenden, Position einer an die Realität angepaßten Kompromißlösung vor, auch wenn diese zur „Spaltung zwischen gelebter Praxis und der immer wieder proklamierten, aber nicht ernstgenommenen kirchlichen Position“ (Gründel, 1998) führen kann.
Die Reaktion der deutschen Bischöfe wiederum ist konsistent mit und erklärbar durch die Organisationskultur, da sie sich der Autorität des Papstes gebeugt haben. Damit haben sie die von der Organisationskultur geforderte Gehorsamsbereitschaft gegenüber dem Heiligen Stuhl gewahrt und einen die Einheit gefährdenden offenen Konflikt zwischen Ortskirche und Rom vermieden.
7 Konsequenzen für die Ortskirche und Ausblick
Der Brief des Papstes mit der klaren Aufforderung, keine Beratungsbescheinigungen mehr auszustellen, setzt die deutschen Bischöfe von zwei Seiten unter Druck: Einerseits von der Gesamtkirche, die Gehorsam gegenüber der Bitte des Papstes und Handlungen, die mit der offiziellen Lehre der Kirche übereinstimmen, einfordert, und andererseits von der deutschen Öffentlichkeit, die einen Verbleib der katholischen Kirche in der Schwangerschaftskonfliktberatung fordert. Die Bestrebungen, diesen beiden so gegensätzlichen Seiten gerecht zu werden, wurde in der Presse häufig als eine versuchte ‚Quadratur des Kreises‘ bezeichnet.
Allein eine - auch vom Papst angeregte - Gesetzesänderung könnte die Zwickmühle, in der sich die deutschen Bischöfe befinden, beseitigen. Dies wurde aber in der auf den Papstbrief folgenden Diskussion entschieden von allen Parteien abgelehnt.
Für die deutschen Bischöfe ergeben sich nun mehrere Handlungsmöglichkeiten: Erstens ist ein Verbleib im staatlichen System und damit ein offenes Zuwiderhandeln gegen die päpstlichen Anordnungen denkbar. Dies wäre allerdings eine grobe Verletzung des Einheitsgebots der katholischen Kirche und ist damit wenig wahrscheinlich. Zweitens könnte die Beratung weitergeführt werden, allerdings ohne die Ausstellung eines Beratungsnachweises. Damit würden die deutschen Bischöfe zwar den Anweisungen aus Rom folgen, hätten aber mit großer gesellschaftlicher Kritik und weitreichendem Unverständnis zu rechnen. Da die katho lischen Beratungsstellen ihre staatliche Anerkennung verlieren würden, würden auch die staatlichen Finanzmittel für diese empfindlich gekürzt werden. Diese Lösungsmöglichkeit scheint also auch sehr problematisch, wenn auch wahrscheinlicher als ein Verstoß gegen die päpstliche Bitte. Am wahrscheinlichsten erscheint eine Kompromißlösung. Die eingesetzte Arbeitsgruppe soll nach einer solchen Lösung suchen. Angedacht wurden Möglichkeiten wie ein ‚Beraterbrief‘ oder die telefonische Rückfrage des Arztes bei der Beratungsstelle. Eine solche Kompromißlösung ist allerdings schwer zu finden, da sie sowohl den gesetzlichen Bestimmungen als auch den Anforderungen des Vatikans genügen muß.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptkonflikt in dem Text?
Der Hauptkonflikt dreht sich um die Frage, ob die katholische Kirche in Deutschland weiterhin Beratungsscheine für Schwangerschaftsabbrüche ausstellen soll. Rom (der Vatikan) fordert, dass dies nicht mehr geschieht, da es als Beihilfe zur Abtreibung angesehen wird, während die deutschen Bischöfe zögern, da sie einen Rückzug aus dem staatlichen Beratungssystem befürchten und die gesellschaftliche Realität in Deutschland berücksichtigen wollen.
Was ist die These der Hausarbeit?
Die These ist, dass die katholische Kirche aufgrund ihrer starken Organisationskultur keinen Sonderweg einer Ortskirche oder eines Subsystems zulassen kann, wenn dieser der Organisationskultur und den von dieser getragenen Normen und Werten widerspricht, selbst wenn dieser Sonderweg aufgrund einer besonderen Situation gerechtfertigt oder sogar besser erscheint.
Wie ist die katholische Kirche organisiert?
Die katholische Kirche ist hierarchisch gegliedert. An der Spitze steht der Papst, gefolgt von den Bischöfen in den Diözesen, dann die Priester in den Gemeinden und schließlich die einzelnen Mitglieder der Kirche, insbesondere die Laien.
Was ist eine Organisationskultur und welche Merkmale hat sie?
Eine Organisationskultur umfasst bewusst oder unbewusst kultivierte Wissensvorräte, Denkmuster, Weltinterpretationen, Wertvorstellungen und Verhaltensnormen, die das Verhalten der Organisationsmitglieder prägen. Zu den Kernmerkmalen gehören Implizitheit, Kollektivität, Sinnvermittlung, Emotionalität, historische Entstehung und die Rolle von Symbolen.
Was sind die Kennzeichen einer starken Organisationskultur?
Die Kennzeichen einer starken Organisationskultur sind Prägnanz (Konsistenz und Umfassendheit der kulturellen Orientierungsmuster), Verbreitungsgrad (Ausmaß, in dem die Organisationsmitglieder die Kultur teilen) und Verankerungstiefe (Internalisierung und Stabilität der Kultur).
Wie stark ist die Organisationskultur der katholischen Kirche?
Die katholische Kirche weist eine außergewöhnlich starke Organisationskultur auf, gekennzeichnet durch hohe Prägnanz, Verbreitungsgrad und Verankerungstiefe.
Wie ist die Situation der katholischen Kirche in Deutschland?
Die katholische Kirche in Deutschland befindet sich in einer schwierigen Lage aufgrund eines tiefgreifenden Frömmigkeitswandels, der zu Kirchenaustritten, rückläufigem Kirchgang und einer Unzufriedenheit mit der Organisationskultur geführt hat. Gleichzeitig ist sie stark in das Sozialsystem eingebunden und hat ein fest geregeltes Verhältnis zum Staat.
Wie ist die gegenwärtige Abtreibungsregelung in Deutschland?
Ein Schwangerschaftsabbruch ist grundsätzlich rechtswidrig, bleibt aber straffrei, wenn er innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen durchgeführt wird und die Frau eine Schwangerschaftskonfliktberatung nachweisen kann.
Welche Rolle spielen die katholischen Beratungsstellen im deutschen Beratungssystem?
Die katholische Kirche beteiligt sich mit zahlreichen Beratungsstellen am staatlichen Beratungssystem und stellt Beratungsscheine aus. Sie sind jedoch an bischöfliche Richtlinien gebunden, die sie dazu verpflichten, nicht zu einer Abtreibung zu raten oder Informationen darüber weiterzugeben.
Was ist Roms Position zur Abtreibung und zur deutschen Regelung?
Rom verurteilt die Abtreibung entschieden und lehnt jede Form von Legalisierung oder Straffreiheit ab. Bezüglich der deutschen Regelung wird die Beratungsbescheinigung als problematisch angesehen, da sie als Beihilfe zur Abtreibung interpretiert wird.
Was ist die Position der deutschen Ortskirche?
Die deutsche Ortskirche teilt die Ablehnung der Abtreibung durch die katholische Gesamtkirche, beteiligt sich aber am staatlichen Beratungssystem, um in Not geratenen Frauen zu helfen und Einfluss auf ihre Entscheidung zu nehmen.
Welche Konsequenzen hat der Konflikt um den Beratungsschein für die Weltkirche?
Der Konflikt gefährdet die Glaubwürdigkeit der Kirche, die Wesenseigenschaften Einheit und Apostolizität. Die Tolerierung eines deutschen Sonderwegs könnte dazu führen, dass andere Teilkirchen in anderen Bereichen ebenfalls Sonderwege fordern.
Wie reagierte der Papst auf den Konflikt?
Papst Johannes Paul II schrieb einen Brief an die Deutsche Bischofskonferenz, in dem er sie aufforderte, Wege zu finden, damit keine Beratungsscheine mehr ausgestellt werden.
Welche Konsequenzen hat der Konflikt für die deutsche Ortskirche und was sind die möglichen Ausblicke?
Die deutschen Bischöfe stehen unter Druck von Rom und der deutschen Öffentlichkeit. Mögliche Handlungsoptionen sind ein Verbleib im System ohne Scheinausstellung, ein Kompromiss oder eine Gesetzesänderung. Im Februar 1999 sollte eine Lösung des Konflikts gefunden werden.
- Quote paper
- Steffi Walter (Author), 2001, Die katholische Kirche in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103891