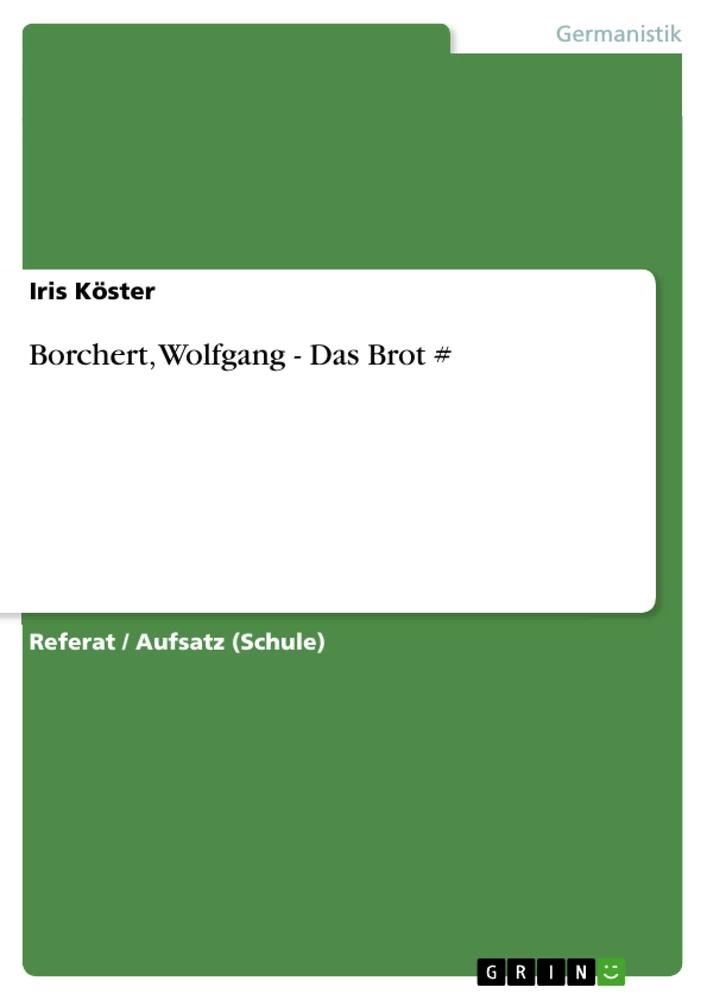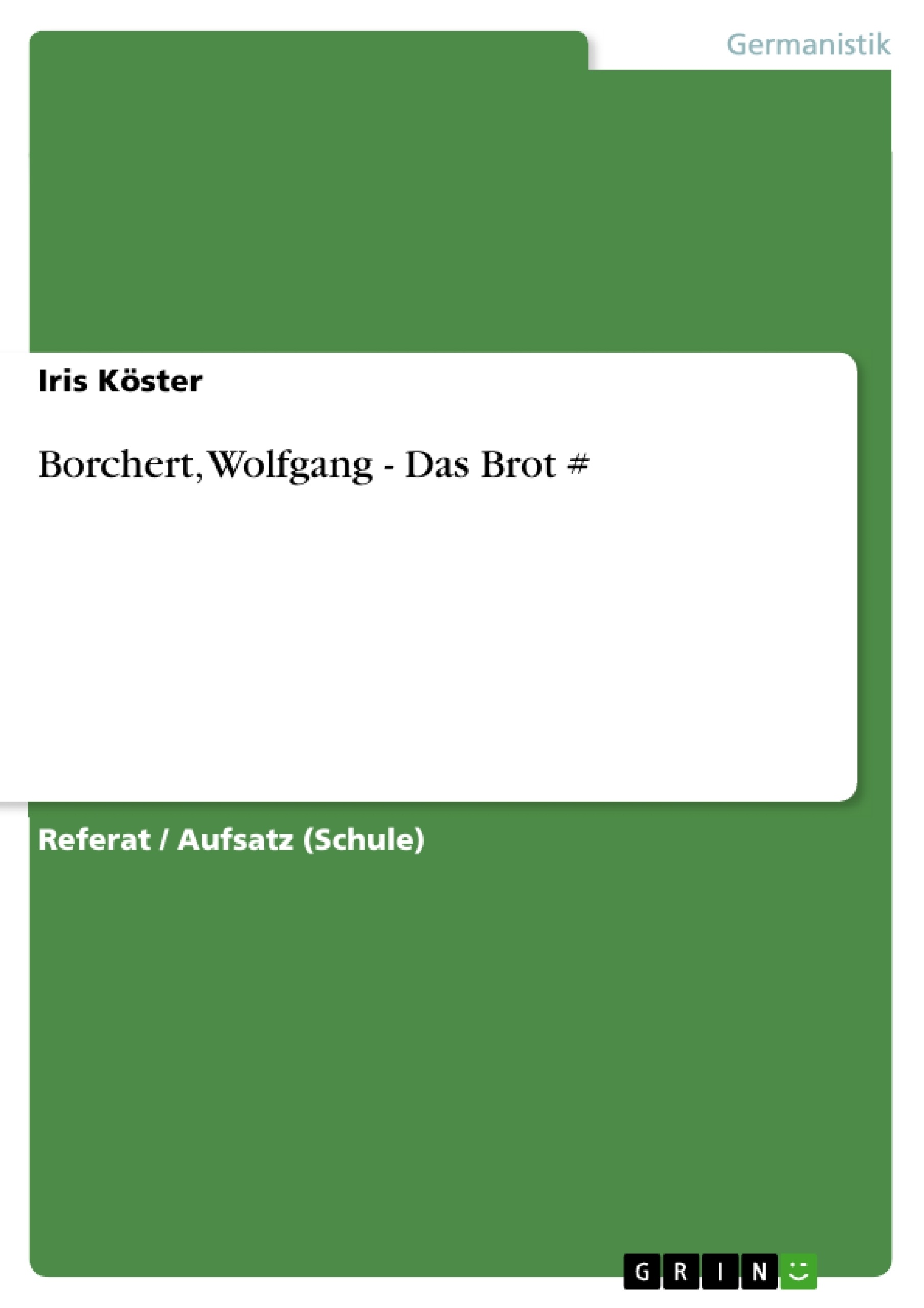Was, wenn die Stille der Nacht eine Lüge enthüllt, die ein ganzes Leben in Frage stellt? In Wolfgang Borcherts erschütternder Kurzgeschichte "Das Brot" wird ein älteres Ehepaar in den dunklen Stunden der Nach durch ein banales Vergehen – das heimliche Essen einer Brotscheibe – mit der brüchigen Realität ihrer langjährigen Beziehung konfrontiert. Die Frau, aufgeschreckt durch ein verdächtiges Geräusch, entdeckt ihren Mann in der Küche, wo er sich widerwillig und erfolglos bemüht, seine Tat zu verbergen. Es beginnt ein subtiles Katz-und-Maus-Spiel, eine stille Konfrontation, in der unausgesprochene Vorwürfe und gegenseitiges Misstrauen zwischen den Zeilen vibrieren. Borchert zeichnet mit minimalistischer Präzision das Psychogramm einer Ehe, die von Entbehrungen und dem stillen Kampf ums Überleben gezeichnet ist. Die Geschichte entfaltet eine beklemmende Atmosphäre, in der die Kargheit der Nachkriegszeit nicht nur den physischen Hunger, sondern auch die emotionale Not der Menschen widerspiegelt. Die Dunkelheit der Küche wird zur Bühne einer Tragödie im Kleinen, in der die Protagonisten gefangen sind in einem Netz aus Scham, Stolz und der Angst vor dem Verlust der Würde. Das Brot wird zum Symbol für weit mehr als nur Nahrung; es steht für Vertrauen, Ehrlichkeit und die unaufhaltsame Erosion menschlicher Beziehungen unter dem Druck existentieller Nöte. Die Geschichte ist ein Meisterwerk der Andeutung, das den Leser zwingt, sich mit den unbequemen Fragen nach Liebe, Verzeihen und den Grenzen der Selbstaufopferung auseinanderzusetzen. Entdecken Sie in dieser zeitlosen Erzählung die verborgenen Abgründe einer Ehe, die durch die Stille der Nacht und den Duft von frisch geschnittenem Brot für immer verändert wird. "Das Brot" ist ein Muss für alle Liebhaber der deutschen Nachkriegsliteratur und eine bewegende Reflexion über die menschliche Natur in Zeiten der Krise, über die stille Not, die in vermeintlich banalen Alltagssituationen lauert, und über die fragilen Bande, die uns in schwierigen Zeiten zusammenhalten oder eben auch zerreißen lassen. Tauchen Sie ein in die Welt von Wolfgang Borchert und erleben Sie, wie eine einfache Geste das Fundament einer Beziehung erschüttern kann, und wie die Liebe versucht, in den Trümmern des Misstrauens einen Neuanfang zu finden.
Iris Köster
Wolfgang Borchert - Das Brot
Die Geschichte „Das Brot“ von Wolfgang Borchert handelt davon, wie sich schwierige äußere Umstände auf eine zwischenmenschliche Beziehung auswirken können, oder was der Hunger mit den Menschen machen kann.
Die Hauptpersonen sind ein etwa sechzigjähriges Ehepaar, das seit ca. 39 Jahren verheiratet ist.
Die Frau wacht mitten in der Nacht auf und bemerkt, daß ihr Mann nicht im Bett ist. Sie findet ihn schließlich in der Küche, wo er sich gerade eine Scheibe Brot abgeschnitten hat. Er leugnet dies allerdings und sagt, er habe etwas gehört, was ihn aufgeweckt hätte. Die Frau tut so, als habe sie die Krümel auf dem Tisch nicht gesehen und versucht sich, aber auch ihn, davon abzulenken, indem sie ein Gespräch über unwichtige Dinge anfängt. Kurze Zeit später hört sie im Bett Kaugeräusche, die sie zu ignorieren versucht. Am nächsten Abend gibt sie ihm eine ihrer Brotscheiben mit der Begründung, sie vertrage das Brot nicht mehr.
Das erste Lesen der Geschichte hinterlässt eine sehr gespannte Stimmung. Die peinliche Situation wirkt durch die Hilflosigkeit des Mannes noch beklemmender. Man weiß, dass sich beide etwas vorspielen, die Frau schämt sich für den Mann und will ihn schützen und der Mann ist zu feige um zuzugeben, dass er das Brot gegessen hat.
Die Geschichte hat weder einen richtigen Anfang noch ein Ende. Auch wird nicht auf einen Höhepunkt hingeführt, alles ist durchgängig nüchtern geschildert. Schon mit dem ersten Satz „Plötzlich wachte sie auf“ (Z.2) befindet man sich mitten im Geschehen. Die Tatsache, dass sich die adverbiale Bestimmung am Anfang des Satzes befindet, betont das von sich aus schon auf sich aufmerksam machende Wort „Plötzlich“ und unterstreicht noch einmal, was geschehen ist. Auch lässt dieser Beginn vermuten, dass dem Aufwachen der Frau schon etwas vorausgeht, worauf hier jedoch nicht mehr näher eingegangen wird. Der erste Satz sagt nichts über den Ort, die Zeit oder aber die Person, so dass völlig unklar ist, wer aufwacht. Die kurze präzise Äußerung „es (sei) halb drei“ (Z.2), wirft die Frage auf, warum die exakte Zeitangabe von Bedeutung ist. Die Frau hört, wie „(...)jemand (in der Küche) gegen einen Stuhl gestoßen (ist) “ (Z.2-3), sie ist also ebenso ahnungslos wie der Leser. Der ganze erste Teil läßt auf einen Einbruch schließen und die Spannung wird durch die danach folgenden kurzen, aneinander gereihten Hauptsätze noch gesteigert. Der Leser wird dadurch Schritt für Schritt mitgeführt, und kann die Gedanken der Frau nachempfinden. Nach dem die Frau die Geräusche in der Küche hörte, entsteht die für sie so verdächtige Stille, die wiederum auf eine Kriminalgeschichte hinweist, als würde der Einbrecher nach dem ungewollt lautem Geräusch nun abwartend in der Küche stehen. Wie automatisch tastet die Frau nach ihrem Mann und stellt fest, daß er nicht im Bett ist. Die gedankliche Verbindung zwischen der unangenehmen Stille und dem Verdacht der Frau, ihr Mann habe etwas damit zu tun, ist stilistisch durch das „und“ in dem folgenden Satz gelöst: „Es was zu still und als sie mit der Hand über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer.“ (Z.4- 5). Dann folgt die Erläuterung der Stille, nämlich daß ihr sein Atem fehlte. Die ganze erste Passage beschreibt die Undurchsichtigkeit und die Unklarheit der Situation. Die Frau „(...)tappte durch die dunkle Wohnung zur Küche “. Hier wird schon deutlich, daß die Frau ihrem Mann nicht mehr 100%ig vertraut, denn sie hätte ihn vom Bett aus rufen können, wobei es auch sein kann, daß sie nur sicher gehen möchte, ob alles in Ordnung ist. Es wird auch klar, daß es ungewöhnlich ist, daß ihr Mann nachts aufsteht, sonst wäre sie nicht misstrauisch. Dieses Misstrauen wird noch dadurch bestärkt, daß die Wohnung im Dunkeln liegt, wobei der Mann ruhig hätte Licht machen können, wenn er nichts zu verbergen hätte. Auffällig ist auch die häufige Wiederholung der „Küche“( im ersten Absatz 6 mal), die im direkten Zusammenhang zur Überschrift und der ganzen Thematik des Hungers steht.
Der Satz „In der Küche trafen sie sich“ klingt sehr merkwürdig, wie die Betrachtung einer dritten Person von außen. Borchert wählt bewußt nicht die persönlichere Formulierung „ Sie ging zu ihrem Mann in die Küche“, sondern verzichtet auf die Satzgefüge, um die ungewöhnliche Situation zu betonen und wiederum auf einen Krimi zu verweisen, da es sich hier um das Treffen zweier Gegner handeln könnte, dem Einbrecher und dem Opfer. Daraufhin wird wiederum die exakte Zeit genannt, was dem Leser klar macht, daß wenig Zeit verstrichen ist und ihn ungeduldig werden läßt, da man kurz vor der Auflösung der bisher undurchsichtigen Situation steht. Nur im ersten Absatz wird 3 mal die Zeit erwähnt. Im folgenden wird beschrieben, wie der Frau langsam die Situation klarwird. Dies ist stilistisch sehr geschickt gelöst, es wird wie eine Art Erleuchtung beschrieben. Erst steht sie in „(...)(der) dunkle(n) (...)Küche“, dann „(...)(sieht) sie (dort) etwas Weißes (...)stehen“ und anschließend „(...)macht (sie) Licht“ und erkennt ihrem Mann. Die Kriminalgeschichte ist damit aufgelöst, doch durch die Ellipsen „Nachts. Um halb drei. In der Küche.“ wird sprachlich angedeutet, daß trotzdem etwas ungewöhnliches passiert ist. Der Satz „Auf dem Küchentisch stand der Brotteller“ (Z. 13) beinhalten den Kern der Geschichte, das Brot, und schafft die Verbindung zu dem Thema. Der Rest der Geschichte beschreibt, wie beide versuchen zu verhindern, daß der andere merkt, was passierte, obwohl beide wissen, daß sie sich was vorspielen.
In Zeile 18 wird ein weiteres Motiv angesprochen, nämlich „wie die Kälte der Fliesen langsam in ihr hoch kroch. Die Kälte der Fliesen meint ebenso die Kälte der Beziehung, die durch die Unehrlichkeit des Mannes hervorgerufen wurde. Was die ganze Geschichte durchzieht sind die Gegensätze Dunkelheit/Helligkeit, die oft erwähnt werden. Einerseits wird es genutzt um Klarheit in die Geschichte zu bringen, wie schon die anfangs beschriebene Situation in der Küche, als die Frau Licht macht und dann ihren Mann erkennt, es wird aber andererseits auch für das Gegenteil benutzt, nämlich bestimmte Dinge bewußt nicht sehen zu wollen. So macht die Frau in Zeile 45 schnell das Licht aus, da sie „ sonst (...)nach dem Teller sehen (muß)“. Sie kann ihn nicht ansehen, weil sie feststellen muß, daß er sie nach 39 Jahren Ehe anlügt. Deshalb möchte sie die peinliche Situation schnell beenden und drängt ihn ins Bett. Durch die nebensächlichen Gespräche versuchen beide von dem Hauptgeschehen abzulenken. Die Frau versucht ihrem Mann zu schützen und möchte ihm die Erniedrigung ersparen, sich ihr unterstellen zu müssen, weil sie moralisch einen höheren Stand hat als er. Am Ende der Geschichte gibt sie ihm eine ihrer Scheiben, damit er in Zukunft solche Erniedrigungen nicht erleben muss. Und auch hier macht sie es ihm leichter, in dem sie sagt, sie gebe es ihm nicht darum, weil er Hunger hat, sondern weil sie das Brot nicht vertrage. Auffallend an der Geschichte sind die vielen Dinge, die nicht gesagt werden. So wird weder der Ort noch die Zeit genannt, noch wird etwas zu der Vorgeschichte gesagt, zu den Gedanken und Empfindungen des Mannes als er noch im Bett liegt, z. B., oder warum er überhaupt lügt. Auch das zentrale Wort zum Thema, nämlich „der Hunger“ wird keinmal erwähnt.
Häufig gestellte Fragen zu Wolfgang Borchert - Das Brot
Worum geht es in der Geschichte „Das Brot“ von Wolfgang Borchert?
Die Geschichte handelt davon, wie sich schwierige äußere Umstände auf eine zwischenmenschliche Beziehung auswirken können, und wie Hunger Menschen verändern kann.
Wer sind die Hauptpersonen?
Die Hauptpersonen sind ein etwa sechzigjähriges Ehepaar, das seit ca. 39 Jahren verheiratet ist.
Was passiert in der Geschichte?
Die Frau wacht nachts auf und findet ihren Mann in der Küche, wo er sich Brot schneidet. Er leugnet es, und die Frau tut so, als ob sie nichts bemerkt hätte. Am nächsten Abend gibt sie ihm eine ihrer Brotscheiben.
Welche Stimmung vermittelt die Geschichte?
Die Geschichte hinterlässt eine gespannte und beklemmende Stimmung, da beide Ehepartner sich etwas vorspielen.
Wie ist die Geschichte stilistisch aufgebaut?
Die Geschichte hat weder Anfang noch Ende und wird durchgängig nüchtern geschildert. Der Einstieg erfolgt abrupt, mitten im Geschehen.
Welche stilistischen Mittel werden verwendet?
Es werden kurze, aneinandergereihte Hauptsätze verwendet, die die Spannung steigern. Die Wiederholung des Wortes "Küche" betont die Thematik des Hungers.
Welche Gegensätze werden in der Geschichte thematisiert?
Es werden die Gegensätze Dunkelheit/Helligkeit verwendet, um Klarheit zu schaffen oder Dinge bewusst nicht sehen zu wollen.
Welches Motiv wird angesprochen und in welcher Zeile?
In Zeile 18 wird das Motiv der Kälte angesprochen, das die Kälte der Beziehung symbolisiert.
Was ist das Besondere an den Gesprächen des Paares?
Die nebensächlichen Gespräche dienen dazu, von dem eigentlichen Geschehen abzulenken.
Warum gibt die Frau ihrem Mann am Ende eine Scheibe Brot?
Sie gibt ihm eine Scheibe, um ihm zukünftige Erniedrigungen zu ersparen und ihm die Situation zu erleichtern.
Was wird in der Geschichte nicht gesagt?
Es werden weder Ort noch Zeit genannt, noch wird etwas zur Vorgeschichte gesagt, oder zu den Gedanken und Empfindungen des Mannes. Auch das Wort "Hunger" wird nicht erwähnt.
Welche Art von Geschichte ist "Das Brot" eigentlich?
Die Geschichte ist im Kern eine Liebesgeschichte, da die Ehepartner aufgrund ihrer Liebe in der Lage sind, die Situation ohne Konflikt zu bewältigen.
- Quote paper
- Iris Köster (Author), 2001, Borchert, Wolfgang - Das Brot #, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103873