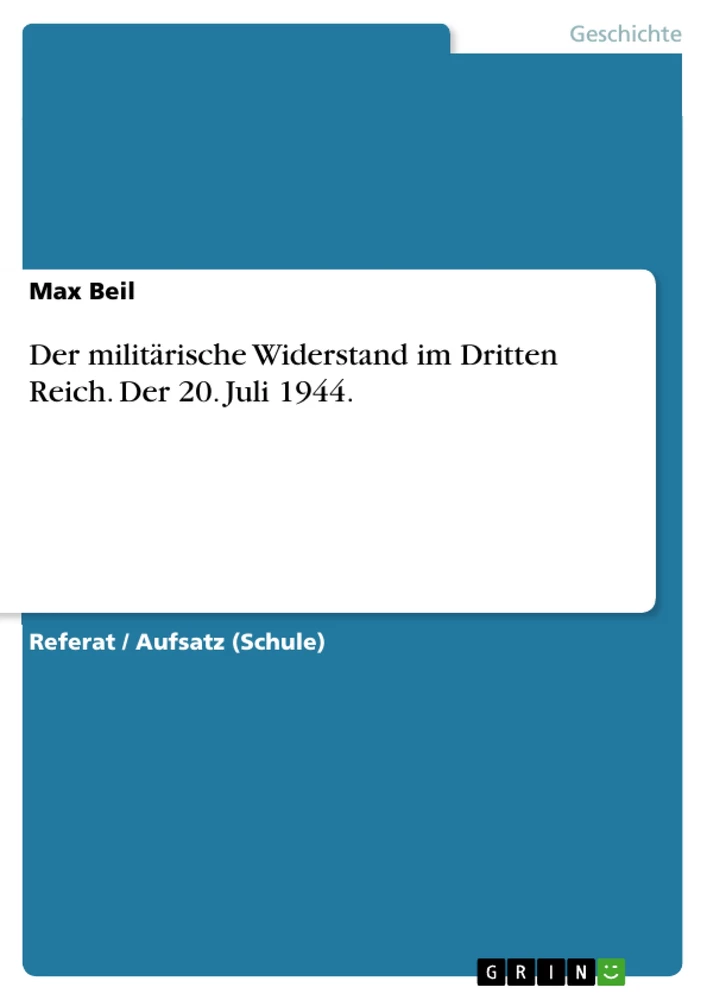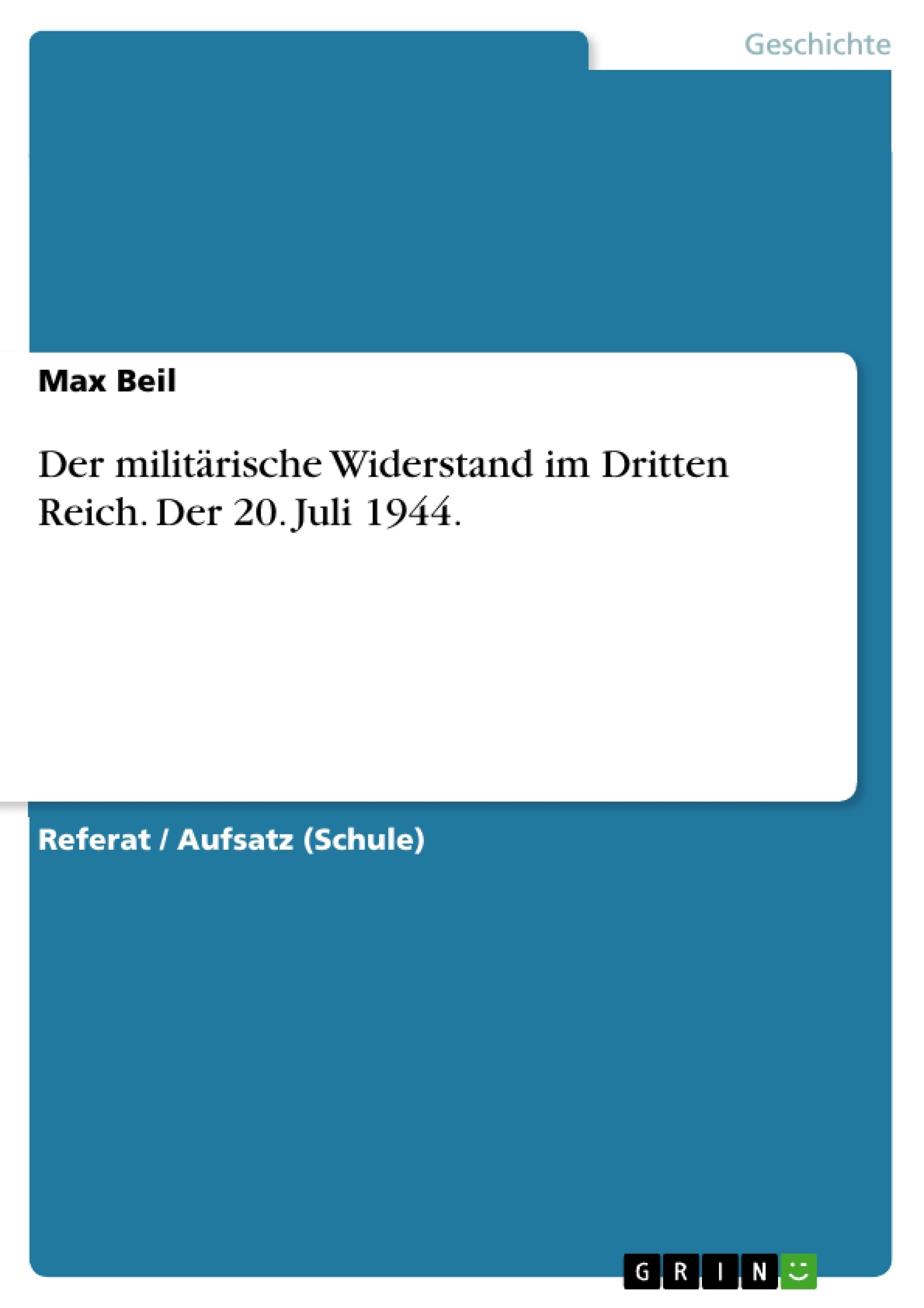Inmitten der dunkelsten Stunden des Zweiten Weltkriegs, als das Dritte Reich scheinbar unbesiegbar schien, keimte ein verzweifelter Plan auf, der das Schicksal Deutschlands für immer verändern sollte. Diese fesselnde Darstellung entführt den Leser in die geheimen Zirkel des deutschen Widerstands, wo mutige Männer und Frauen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten – von Militärs und Geistlichen bis hin zu Intellektuellen und Arbeitern – ihr Leben riskierten, um sich gegen die unerbittliche Tyrannei Adolf Hitlers zu stellen. Im Zentrum dieser Verschwörung steht der 20. Juli 1944, der Tag, an dem Claus Schenk Graf von Stauffenberg versuchte, Hitler durch ein waghalsiges Attentat zu stürzen. Doch hinter diesem kühnen Plan verbirgt sich eine komplexe Geschichte von gescheiterten Attentatsversuchen, ideologischen Konflikten und dem unaufhaltsamen Aufstieg des Nationalsozialismus. Die Beweggründe für den Widerstand waren vielfältig: die Ablehnung des Führerprinzips, die Verfolgung von Juden und Andersdenkenden, die Korruption innerhalb der Parteiführung und die sinnlose Weiterführung eines verlorenen Krieges. Erforschen Sie die geheimen Netzwerke, die riskanten Operationen und die tragischen Konsequenzen des militärischen Widerstands gegen Hitler, während Sie die spannungsgeladene Atmosphäre der Wolfsschanze und die dramatischen Ereignisse des Umsturzversuchs vom 20. Juli hautnah miterleben. Entdecken Sie die wahren Hintergründe einer der mutigsten Aktionen in der deutschen Geschichte, einer Geschichte von Opferbereitschaft, Verrat und dem unerschütterlichen Glauben an eine bessere Zukunft. Tauchen Sie ein in die verschlungenen Pfade des deutschen Widerstands, seine strategischen Überlegungen, die persönlichen Opfer und die politischen Verwicklungen, die diesen Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs prägten. Analysiert werden die gescheiterten Attentate, die Rolle zentraler Figuren wie Ludwig Beck und Henning von Tresckow sowie die Bedeutung der „Operation Walküre“. Der Leser erhält einen authentischen Einblick in die moralischen Dilemmata und ethischen Entscheidungen der Widerstandskämpfer, die sich zwischen Pflichterfüllung und dem Kampf für Gerechtigkeit entscheiden mussten. Ergründen Sie die vielschichtigen Ursachen und Konsequenzen des 20. Juli 1944, ein Datum, das bis heute als Symbol für Mut, Widerstand und die unvollendete Suche nach einer gerechteren Welt steht. Dieses Buch ist eine essentielle Lektüre für alle, die sich für deutsche Geschichte, den Zweiten Weltkrieg und die komplexen Mechanismen des Widerstands interessieren.
Der militärische Widerstand. Der 20. Juli 1944
Widerstand: „Allgemeine Bezeichnung für unbedingte Opposition gegen ein als Willkürherrschaft ( Tyrannei) betrachtetes Regime,“ (Unsere Geschichte Band 3. Moritz Diesterweg Verlag: 1991, S. 200).
In den von deutschen Truppen besetzten Ländern wurde der Widerstand von bewaffneten Kampfeinheiten geleistet; im „Dritten Reich“ von Gruppen der Arbeiterbewegung ( KPD, SPD, Gewerkschaften), den Intellektuellen, dann von Angehörigen der Kirchen, des Militärs und des konservativen Bürgertums, sowie von Jugend- und Studentengruppen. Über 1 Mio. politischer Gegner ( darunter mehr als 100 000 Deutsche) kamen in KZs, fast 12 000 Todesurteile wurden im „Dritten Reich“ wegen „politischer Delikte“ verhängt.
Allgemeine Darstellung des „Deutschen Widerstandes“ im historischen Kontext:
Schon vor Hitlers Ernennung zum Reichskanzler durch Hindenburg haben sich Widerstandsgruppierungen gegen ihn und seine Partei gebildet. Auf Anweisung der SPD Führung wurden im Sommer 1932 für den Fall, dass der legale Apparat von Weimar nicht mehr arbeiten könne, in Leipzig, Hamburg, Magdeburg und Hannover Gruppen der zuverlässigsten und aktivsten Funktionäre gebildet. Hoffnungslos warteten sie am 30. Januar 1933, am Tag der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, auf den Befehl zum Kampf. Es gab auch in mehreren Städten spontane Demonstrationen gegen Hitlers Ernennung zum Reichskanzler. Gewerkschaftler waren entsprechend den Anweisungen zu einem Generalstreik bereit. Doch weder die SPD Führung noch der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund wagten den Befehl zum Kampf zu geben. Sie glaubten nicht an einen Erfolg, denn „in der Zeit der Arbeitslosigkeit ist ein Streik keine wirksame Waffe“.
Die Gründe zum Widerstand gegen Hitler und seine Partei waren in verschiedenen Schichten der deutschen Gesellschaft unterschiedlich. Die staatstragende Schicht der Weimarer Republik, Gemeindemitglieder und Geistliche beider christlichen Bekenntnisse, die Kirchenführer und die Protestanten von der Bekennenden Kirche waren mit Hitlers Plänen nicht einverstanden. Andere Oppositionelle z. B. führende Persönlichkeiten der Wehrmacht und der Konservativen, einzelne
Nationalsozialisten waren überzeugt, dass der Krieg eine Katastrophe für Deutschland werden müsse, und wollten den Zusammenbruch vermeiden oder abschwächen. Die Opposition richtete sich insbesondere gegen das Führerprinzip, gegen das Einparteiensystem, die Unterdrückung aller Andersdenkenden, die Behinderung der Kirchen, die Vergewaltigung des Rechts, vor allem gegen die verbrecherische Verfolgung der Juden und anderer rassischer Minderheiten, die „Liquidierung“ politischer Gegner ohne Gesetz und Urteil, gegen die Korruption innerhalb der Parteiführerschaft, gegen Hitlers Eingriffe in die militärische Kriegsführung, gegen die Terrorisierung der Zivilbevölkerung besetzter Gebiete und die sinnlose Weiterführung des aussichtslos gewordenen Krieges.
Es war allen Widerstandsgruppen klar, dass ein Sturz des Hitlerregimes nur unter entscheidender Teilnahme der Wehrmacht möglich ist. Der Plan, 1938 während der Sudetenkrise einen militärischen Staatsstreich durchzuführen, kam infolge des Münchner Abkommens nicht zur Durchführung. Auch die Absicht, Hitlers Westoffensive durch einen bewaffneten Aufstand zu verhindern (Spätherbst 1939), wurde aufgegeben. Bei den Versuchen mit westlichen Staatsmännern Kontakt aufzunehmen, um Bedingungen für die Behandlung Deutschlands im Falle des Umsturzes festzulegen, hielten sich westliche Staatsmänner vorsichtig zurück. Mehrere Attentatspläne gegen Hitler nach dem Fall Stalingrads scheiterten bereits in der Vorbereitung.
Militäropposition:
Nach der Regierungsübernahme gelang es Hitler, die Reichswehrführung für sich zu gewinnen. Die von ihm proklamierte Aufrüstung, die Bekämpfung pazifistischer Strömungen und die grundlegende Revision der Versailler Friedensordnung entsprachen weitgehend den Vorstellungen und Wünschen der meisten deutschen Offiziere. Auch die Ausschaltung der SA in der Mordaktion vom 30. Juni 1934 wurde trotz offensichtlicher Verbrechen von einem großen Teil der hohen militärischen Führung begrüßt, weil sie in dem verachteten nationalsozialistischen Kampfverband eine Konkurrenz für die Reichswehr sah.
Nach der Ermordung der Generale Kurt von Schleicher und Ferdinand von Bredow änderten nur einige Offiziere ihre Meinung. Ende 1937 erkannten einige kritische Offiziere endgültig, dass Hitler zielstrebig einen Krieg in Europa vorbereitete. Sie befürchteten, dass der Krieg zur militärischen Niederlage und zur nationalen Katastrophe führen werde.
Die zentrale Gestalt der Militäropposition war der Generalstabschef des Heeres General Ludwig Beck. Zuerst versuchte er auf die militärischen Entscheidungsprozesse einzuwirken und die Rüstungspolitik zu ändern. Es gelang ihm, einzelne Offiziere für einen Staatsstreich gegen Hitler zu gewinnen. Am 18. August 1938 wurde Beck demissiokt mit Carl Goeniert. Auch nach seiner Demission sammelte er weiterhin militärische und zivile Gegner des Nationalsozialismus um sich. Er war ständig im Kontardeler, dem führenden Kopf der zivilen Wiederstandskreise. Gemeinsam versuchten sie die vielfältigen Motive und Ziele des Widerstands auf die gemeinsame Tat zu lenken.
Im Oberkommando des Heeres, in einzelnen Wehrkreiskommandos und im Amt Ausland/ Abwehr des Oberkommandos der Wehrmacht versuchten kleinere Gruppen jüngerer Offiziere ihre Vorgesetzten zur Aktion gegen Hitler zu gewinnen. Ein Kreis in der Abwehr um Hans Oster beschäftigte sich besonders aktiv mit Plänen zur Ausschaltung Hitlers. Auch einzelne Angehörige des Auswärtigen Amtes schließen sich ihnen an. Zur gleichen Zeit versuchte Beck die Wehrmachtsspitze zum gemeinsamen Rücktritt aufzufordern, um so einen Angriff deutscher Truppen unmöglich zu machen. Die Widerstandsgruppe um Hans Oster plante bereits einen Anschlag auf Hitler.
Als es Hitler im September 1938 mit dem Münchener Abkommen gelang, die führenden Politiker Europas zur Anerkennung seiner territorialen Forderungen gegenüber der Tschechoslowakei zu bewegen, erfuhren alle Umsturzbemühungen einen schweren Rückschlag. Den Kritischen Militärs war bewusst, dass die Verletzung der polnischen Grenzen einen europäischen Krieg nach sich ziehen musste. General Franz Halder, der als Nachfolger von Ludwig Beck weiterhin in Verbindung mit oppositionellen Gruppen um Hans Oster und Hans von Dohnanyi stand, wollte seinen Vorgesetzten, Generaloberst Walter von Brauchitsch, für die Ausschaltung Hitlers gewinnen. Doch der Oberbefehlshaber des Heeres lehnte die geforderte Zusammenarbeit ab. Nach der Ablehnung resignierte Halder und fügte sich in Hitlers Pläne. „Von der deutschen Generalität war kein Umsturz zu erwarten,“ (Lexikon des Widerstandes 1933-1945. Begriff: Militäropposition).
Einige jüngere Offiziere, unter dem Eindruck deutscher Verbrechen an Polen und Juden, stellten sich immer öfter die Frage, wie die NS-Diktatur zerstört werden konnte. Oberst Henning von Tresckow wurde zu einer führenden Person unter den oppositionellen Offizieren gemacht. Er festigte die Verbindungen des militärischen Widerstands zu Beck und Goerdeler, und vermittelte auch zwischen dem Allgemeinen Heeresamt im Berliner Bendlerblock und der Ostfront. Es gelang ihm einige Offizierskameraden unter seiner Führung zu sammeln, die bereit waren, ein Attentat auf Hitler unter Einsatz ihres Lebens auszuführen.
Verschiedene Attentatsversuche scheiterten infolge unglücklicher und unerwarteter Umstände. Seit Herbst 1943 wurde Claus Schenk Graf von Stauffenberg zentrale Gestalt der Militäropposition. Ihm gelang es gemeinsam mit Friedrich Olbricht und Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, jüngere Offiziere um sich zu sammeln, mit denen Attentat und Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 ausgeführt werden konnten.
Attentate auf Hitler:
Lange Zeit vor dem Anschlag vom 20. Juli 1944 planten Gegner des nationalsozialistischen Regimes, Hitler zu töten. Bekannt sind über 40 Attentatsversuche. Die strengen Sicherheitsmaßnahmen und technische Schwierigkeiten machten die Attentatsversuche kaum durchführbar. Hitler wurde von seiner Leibwache, dem „ Reichssicherheitsdienst“, scharf bewacht.
Der junge Schweizer Maurice Bavaud versuchte im November 1938, Hitler mit einer Pistole zu erschießen. Doch die Passanten verstellten im entscheidenden Augenblick das Schussfeld. Zu Beginn des 2. Weltkrieges schaffte es Johann Georg Elser im Münchener Bürgerbräukeller eine selbst gebaute Zeitbombe zu zünden. Folge: die Schutzmaßnahmen wurden nach diesem Attentat weiter verschärft.
Während des Krieges mied Hitler schließlich fast jede Begegnung mit der Öffentlichkeit. Der Personenkreis derjenigen, die in die Näher Hitlers kommen konnten und bereit waren ein Attentat auszuüben, war sehr klein.
1943 versuchten Henning von Tresckow und Adjutant Fabian von Schlabrendorff ein Attentat. Auf dem Rückflug vom Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte gaben sie einem Begleitoffizier Hitlers ein Päckchen mit einer als Cognacflasche getarnten Bombe mit, deren Zünder jedoch versagte. Als Hitler und Göring im März 1943 eine Beutewaffenausstellung im Berliner Zeughaus besuchten, versuchte Rudolf Freiherr von Gersdorff die beiden mit einer Bombe zu töten. Doch Hitler ging früher weg, als erwartet wurde, was das Attentat unmöglich machte. Auch der Versuch von Axel Freiherr von dem Bussche, sich gemeinsam mit Hitler in die Luft zu sprengen, scheiterte, weil Bussche kurz vor dem geplanten Anschlag schwer verwundet war.
Der 20. Juli 1944:
„Viele Attentatversuche scheiterten in der nächsten Zeit, was die NS-Propaganda geschickt ausnutzte und den „Führer“ als unverwundbar darstellte. Erst am 20. Juli 1944 kam es zu einem erneuten Attentat, als es Claus Schenk Graf von Stauffenberg gelang, in der Lagerbaracke des Führerhauptquartiers Wolfschanze einen Sprengkörper zu zünden. Hitler überlebte auch dieses Attentat,“ (Lexikon des Widerstandes 1933-1945. Begriff: Attentate auf Hitler).
Nach der Festnahme von Moltkes („Kreisauer-Kreis“) und somit der Sprengung des „KreisauerKreises“ und der Bastion Canaris im Jahr 1944 spitzte die Lage sich so zu, dass die Beseitigung Hitlers immer dringender wurde. Es war aber kaum noch möglich ein Attentat auszuüben, weil die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt wurden.
Stauffenberg und Tresckow arbeiteten ab Sommer 1943 an einem Umsturzplan, der sog.
„Operation Walküre“. Ausgangspunkt war ein Attentat auf Hitler. Danach sollte der WalküreBefehl gegeben werden, mit dem das Ersatzheer Unruhen niederschlagen, die Schaltstellen der NSDAP, SS und der Gestapo und Fernmelde-/ Rundfunkeinrichtungen im gesamten Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten besetzen sollte. Eine schon gebildete Regierung aus den verschiedenen Widerstandsgruppierungen sollte nach erfolgreichem Umsturz die Macht übernehmen. Goerdeler sollte Reichskanzler werden, Leber - Innenminister, Hassel - Außenminister und Erwin von Witzleben - Oberbefehlshaber der Wehrmacht.
Am 1. Juli 1944 wurde Stauffenberg zum Stabschef des Befehlshabers des Ersatzheeres ernannt. Er bekam die Möglichkeit im Führerhauptquartier „Wolfsschanze“ an Lagebesprechungen teilzunehmen und war somit auserwählt, das Attentat selbst auszuführen und auch die Vorbereitung des Attentates zu übernehmen.
Im Juni 1944 wollten Stauffenberg und Tresckow immer noch das Attentat ausüben, obwohl der Krieg schon als verloren galt. Zweimal sollte ein Anschlag noch scheitern: einmal waren Himmler und Göring nicht anwesend, ein anderes mal war Hitler früher als geplant gegangen. Am 20. Juli 1944 schien der Plan endlich zu gelingen.
Am 20. Juli 1944, etwa um 10.15 Uhr, landete Graf Stauffenberg zusammen mit seinem Adjutanten Werner von Haeften auf dem Flugplatz Rastenburg. Von dort fuhren sie zur Wolfsschanze. Sie passierten die Außenwache Süd, und vor dem Kasino verließ Graf Stauffenberg den Wagen, um mit Angehörigen des Hauptquartiers und einigen Offizieren frühstücken zu gehen. Um etwa 11 Uhr ging er in die Baracke des Wehrmachtsführungsstabes zu einer ersten Besprechung, und um 11.30 Uhr zur zweiten Besprechung im Oberkommando der Wehrmacht. Die Lagebesprechung bei Hitler sollte eine halbe Stunde früher als vorgesehen beginnen, wegen des Besuchs von Mussolini, deshalb wurde die Besprechung im Oberkommando abgekürzt. Während alle anderen zur „Lagerbaracke“ gingen, ging Stauffenberg zur Toilette, anschließend zusammen mit Haeften in einen Aufenthaltsraum, wo sie Stauffenbergs Aktentasche mit dem Sprengstoff präparierten. Weil sie gestört wurden, konnten sie nur ein Kilo Sprengstoff statt zwei unterbringen und die Säureampulle des Zünders zerdrücken. Haeften kümmerte sich um den Fluchtwagen, während Stauffenberg zur Besprechung eilte. Die Offiziere wurden kurz vor 12.30 Uhr in den Raum gebeten, Hitler erschien pünktlich. Es gelang Stauffenberg, einen Platz neben Hitler einzunehmen und die Aktentasche unter den Tisch zu stellen. Danach verlies er den Raum und fuhr, zusammen mit Haeften, zum Flugplatz zurück. Die erste Wache passierten sie relativ problemlos, an der Außenwache Süd war jedoch bereits Alarm gegeben worden, und sie durften erst dann weiter fahren, als der diensthabende Oberfeldwebel sich telefonisch rückversichert hatte. Etwa um 13.15 Uhr waren sie im Flugzeug nach Berlin.
Stauffenberg war ziemlich sicher, Hitler sei tot. Dem war aber nicht so. Denn die Holzbaracke hatte der Druckwelle nachgegeben und durch die Explosion starben nur 4 Personen, darunter aber nicht Hitler, der leicht verletzt blieb.
Kurz nach der Explosion sah General Fellgiebel, einer der Mitverschworenen, wie Hitler die Baracke verläßt. Zwischen 13 und 14 Uhr rief er die Zentrale der Verschwörer im Kriegsministerium an und teilte mit, dass Hitler lebe. Danach blockierte er unverzüglich die Telefonleitungen in der Wolfsschanze. Drei Stunden war das Führerhauptquartier von der Außenwelt abgeschlossen. Die Verschwörer, verunsichert durch Fellgiebels Anruf, warteten tatenlos auf Stauffenberg.
Obwohl der Walküre-Befehl erst um 16.00 Uhr ausgegeben wurde, anstatt schon um 13.00 Uhr, lief in Berlin alles scheinbar nach Plan. Das Regierungsviertel wurde vom Ersatzheer umschlossen und das Funkhaus besetzt. Befehle wurden erteilt. Doch die „Walküre“- Befehle kreuzten sich mit den „Wolfsschanze“- Befehlen, so dass Unsicherheit entstand.
Während in Paris, Wien, Prag und Brüssel die Aktionen planmäßig abliefen und schon die ersten Verhaftungen und Übernahmen stattfanden, wurden die Attentäter festgenommen. Der Staatsstreich war beendet. Nachdem der Staatsstreich in Berlin ausgelöscht wurde, mussten in Paris und Wien, wo die Verschwörer erfolgreich waren, alle getroffenen Maßnahmen rückgängig gemacht werden.
Eine Verhaftungswelle durchlief das Land und erfasste alle Verdächtigen, egal ob sie mit dem gescheiterten Staatsstreich zu tun hatten oder nicht. Einige, u.a. auch Beck begingen Selbstmord, die anderen wurden zum Tode verurteilt oder in KZs gesteckt. Die Spitze des Widerstandes wurde noch in derselben Nacht im Bendlerblock in Berlin erschossen, weitere in Plötzensee im Nordwesten Berlins sogar an Fleischerhaken erhängt. Viele Hinrichtungen wurden in allen Einzelheiten für Hitler gefilmt. Außerdem gab Hitler die Anordnung, Verwandte der Oppositionellen in Sippenhaft zu stecken und deren Kinder zu verschleppen.
Verwendete Literatur:
- Unsere Geschichte Band 3. Moritz Diesterweg Verlag: 1991, S. 200
- Informationen zur politischen Bildung 160 und 243: Der Deutsche Widerstand 1933-1945
- Steinbach, Peter und Tuchel, Johannes: „Lexikon des Widerstandes 1933-1945.“
C. H. Beck Verlag: 1998
- Ger van Roon: „Widerstand im Dritten Reich.“ C. H. Beck Verlag: 1998, S. 159 - 178.
- Cartarius, Ulrich: „Opposition gegen Hitler.“ Siedler Verlag: S. 244 - 247.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes „Der militärische Widerstand. Der 20. Juli 1944“?
Der Text behandelt den militärischen Widerstand gegen das NS-Regime in Deutschland, insbesondere das Attentat vom 20. Juli 1944 auf Hitler.
Wie wird Widerstand im Text definiert?
Widerstand wird definiert als unbedingte Opposition gegen ein als Willkürherrschaft (Tyrannei) betrachtetes Regime.
Welche Widerstandsgruppen gab es im "Dritten Reich"?
Widerstand wurde von Gruppen der Arbeiterbewegung (KPD, SPD, Gewerkschaften), Intellektuellen, Angehörigen der Kirchen, des Militärs, des konservativen Bürgertums sowie von Jugend- und Studentengruppen geleistet.
Warum wagten SPD-Führung und Gewerkschaften 1933 keinen Generalstreik?
Sie glaubten nicht an einen Erfolg, da in Zeiten der Arbeitslosigkeit ein Streik keine wirksame Waffe sei.
Welche Gründe gab es für den Widerstand gegen Hitler?
Die Gründe waren vielfältig und umfassten das Führerprinzip, das Einparteiensystem, die Unterdrückung Andersdenkender, die Behinderung der Kirchen, die Vergewaltigung des Rechts, die Verfolgung der Juden und anderer rassischer Minderheiten, die "Liquidierung" politischer Gegner, Korruption in der Parteiführung, Hitlers Eingriffe in die Kriegsführung und die Terrorisierung der Zivilbevölkerung besetzter Gebiete.
Wer war Ludwig Beck und welche Rolle spielte er im militärischen Widerstand?
Ludwig Beck war Generalstabschef des Heeres und eine zentrale Figur der Militäropposition. Er versuchte, die militärischen Entscheidungsprozesse zu beeinflussen und die Rüstungspolitik zu ändern, und sammelte militärische und zivile Gegner des Nationalsozialismus um sich.
Welche Attentatsversuche auf Hitler gab es vor dem 20. Juli 1944?
Der Text erwähnt den Versuch von Maurice Bavaud im November 1938, Johann Georg Elsers Bombenanschlag im Bürgerbräukeller zu Beginn des 2. Weltkrieges, den Versuch von Henning von Tresckow und Fabian von Schlabrendorff mit einer als Cognacflasche getarnten Bombe sowie den Versuch von Rudolf Freiherr von Gersdorff mit einer Bombe bei einer Beutewaffenausstellung.
Wer war Claus Schenk Graf von Stauffenberg und welche Rolle spielte er beim Attentat vom 20. Juli 1944?
Claus Schenk Graf von Stauffenberg wurde im Herbst 1943 zur zentralen Gestalt der Militäropposition. Er plante und führte das Attentat vom 20. Juli 1944 im Führerhauptquartier Wolfsschanze aus.
Was war die "Operation Walküre"?
Die "Operation Walküre" war ein Umsturzplan, der auf ein Attentat auf Hitler folgte. Das Ersatzheer sollte Unruhen niederschlagen und die Schaltstellen der NSDAP, SS und Gestapo besetzen. Eine gebildete Regierung sollte nach erfolgreichem Umsturz die Macht übernehmen.
Was geschah nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944?
Es folgte eine Verhaftungswelle, in der Verdächtige festgenommen wurden, unabhängig davon, ob sie mit dem Staatsstreich in Verbindung standen oder nicht. Einige begingen Selbstmord, andere wurden zum Tode verurteilt oder in Konzentrationslager gebracht. Die Spitze des Widerstandes wurde noch in derselben Nacht im Bendlerblock erschossen oder in Plötzensee erhängt. Es gab auch Sippenhaft für Verwandte der Oppositionellen.
Welche Literatur wurde für diesen Text verwendet?
Die verwendete Literatur umfasst: „Unsere Geschichte Band 3", „Informationen zur politischen Bildung", „Lexikon des Widerstandes 1933-1945", „Widerstand im Dritten Reich", „Opposition gegen Hitler" und „Microsoft Encarta 99 Enzyklopädie: 20. Juli".
- Quote paper
- Max Beil (Author), 2001, Der militärische Widerstand im Dritten Reich. Der 20. Juli 1944., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103866