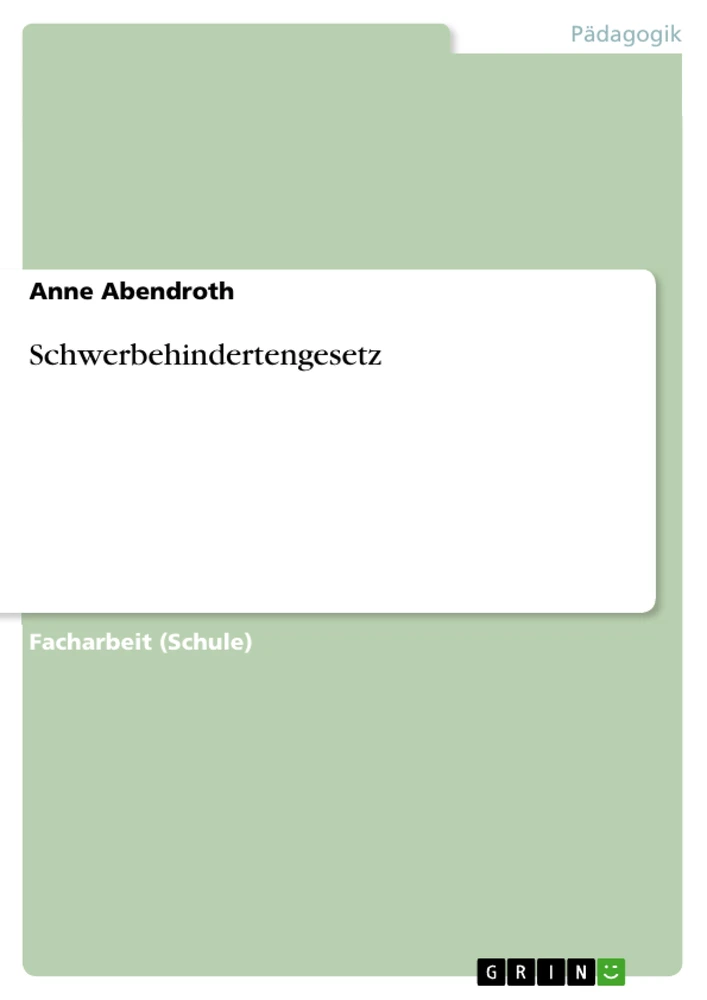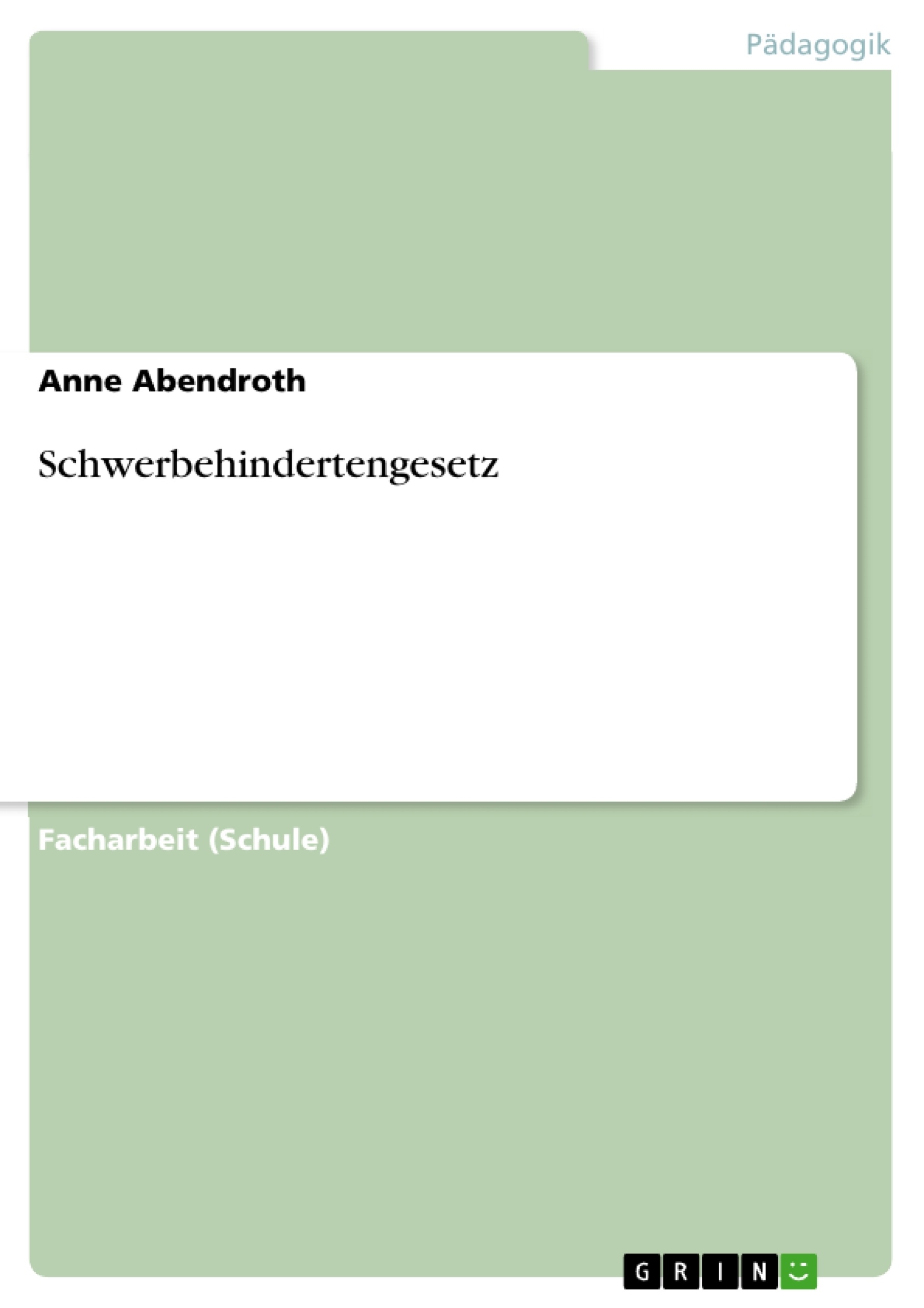Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Rechte aus dem Schwerbehindertengesetz ist die Feststellung der Behinderung. Es gibt verschiedene Definitionen für die Behinderung, ich beschränke mich hier auf die rechtliche, im Schwerbehindertengesetz verankerte Erklärung. Im Sinne des Gesetzes (§3) ist Behinderung die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung (mindestens sechs Monate), die auf einem regelwidrigen, nicht dem Lebensalter typischen, körperlichen, geistigen und seelischen Zustand beruht.
Beim Gedanken an Schwerbehinderte, kommt den meisten Menschen das „klassische“ Bild des nach außen hin sichtbar Behinderten, wie zum Beispiel das des Rollstuhlfahrers, in den Sinn. Doch das ist nur eine kleine Gruppe der Behinderten. Oft sieht man den Schwerbehinderten ihre Einschränkung gar nicht an, so zum Beispiel bei vielen inneren Erkrankungen, wie Nierenschäden oder Verschleißerscheinungen an Wirbelsäule und Gelenken. Diese Menschen haben zwar weniger mit der gesellschaftlichen Diskriminierung oder der Unterschätzung ihrer Leistungsfähigkeit zu kämpfen, aber es gibt oft Probleme damit, dass ihre Erkrankung an der Arbeitsstelle ernst genommen wird, gerade wegen der Nicht-Sichtbarkeit ihrer Behinderung. Für diese Menschen ist es besonders wichtig, dass ihre Behinderung gesetzlich festgestellt wird.
1. Das Schwerbehindertengesetz
1.1. Allgemeines
In der Bundesrepublik Deutschland leben 6,6 Millionen Schwerbehinderte und laut dem Thüringer Landesamt für Statistik war 1995 jeder 17. Einwohner Thüringens, das sind ca. 5,9 % der Gesamtbevölkerung, von einer schweren Behinderung betroffen. Diese Zahlen machen deutlich, wie groß der Teil derer ist, die in vielen Lebensbereichen mit weit mehr Schwierigkeiten zu kämpfen haben, als ihre nichtbehinderten Mitmenschen. Zumindest bei Lösung der rechtlichen Probleme, die entstehen können, kann das Schwerbehindertengesetz (SchwbG) behilflich sein.
Im Vordergrund dieses Gesetzes, welches 1974 erlassen wurde, steht die Eingliederung schwerbehinderter Bürger in Beruf, Arbeit und Gesellschaft. Hierbei wird besonderer Wert auf die begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben gelegt. Man versucht durch den frühzeitigen und vorsorglichen Einsatz dieser Hilfen mögliche Schwierigkeiten schon im Keim zu ersticken.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Rechte aus dem Schwerbehindertengesetz ist die Feststellung der Behinderung.
Es gibt verschiedene Definitionen für die Behinderung, ich beschränke mich hier auf die rechtliche, im Schwerbehindertengesetz verankerte Erklärung.
Im Sinne des Gesetzes (§3) ist Behinderung die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung (mindestens sechs Monate), die auf einem regelwidrigen, nicht dem Lebensalter typischen, körperlichen, geistigen und seelischen Zustand beruht.
Beim Gedanken an Schwerbehinderte, kommt den meisten Menschen das „klassische“ Bild des nach außen hin sichtbar Behinderten, wie z.B. das des Rollstuhlfahrers, in den Sinn. Doch das ist nur eine kleine Gruppe der Behinderten. Oft sieht man den Schwerbehinderten ihre Einschränkung gar nicht an, so z. B. bei vielen inneren Erkrankungen, wie Nierenschäden oder Verschleißerscheinungen an Wirbelsäule und Gelenken. Diese Menschen haben zwar weniger mit der gesellschaftlichen Diskriminierung oder der Unterschätzung ihrer Leistungsfähigkeit zu kämpfen, aber es gibt oft Probleme damit, dass ihre Erkrankung an der Arbeitsstelle ernst genommen wird, gerade wegen der Nicht-Sichtbarkeit ihrer Behinderung. Für diese Menschen ist es besonders wichtig, dass ihre Behinderung gesetzlich festgestellt wird.
Für die Ausführung des Gesetzes sind u.a. die Versorgungsämter zuständig, welche über die jeweils vorliegende Behinderung entscheiden, bzw. den Grad der Behinderung (GdB) feststellen. Dabei richtet sich das zuständige Amt nach den „Anhaltspunkten für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertengesetz“. Diese enthalten allgemeine Beurteilungsregeln und Angaben darüber, wie hoch der Grad der Behinderung bei der jeweiligen Behinderungsart festgesetzt werden muss.
Hierbei ist der GdB ein Maß für die Beeinträchtigung von Funktionen, die Einfluss auf verschiedene Lebensbereiche hat. Er besagt nichts über die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz und ist unabhängig vom ausgeübten oder angestrebten Beruf.
Bei einem GdB von mindestens 20 liegt eine Behinderung vor, ab einem GdB von 50 eine Schwerbehinderung und eine Gleichstellung mit Schwerbehinderten ist möglich ab einem GdB von 30, wenn man infolge einer Behinderung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder behalten kann.
Durch das SchwbG wurde u.a. die Pflicht der Arbeitgeber eingeführt, eine bestimmte Anzahl der Arbeitsplätze an Schwerbehinderte zu vergeben und, falls diese Verpflichtung nicht erfüllt wird, eine Ausgleichsabgabe zu leisten. Außerdem haben die Organisationen der Behinderten und die Beschäftigten nun verstärkt die Möglichkeit, bei der Durchführung des Gesetzes mitzuwirken und auch die Werkstätten für Behinderte (WfB) wurden in den Anwendungsbereich des Gesetzes einbezogen.
Bei diesem Gesetz geht es besonders darum, dass die betrieblichen Stellen, wie Betriebs-/Personalräte, Schwerbehindertenvertretung und Beauftragte der Arbeitgeber sowie die Versorgungsämter und Fürsorgestellen darauf achten, dass durch die Anwendung der Maßnahmen zur Beschäftigung von behinderten Menschen, eine weitgehende Integration in die Arbeitswelt erreicht wird.
Den Behinderten soll an ihrer Arbeitsstelle auch Gelegenheit geboten werden, „ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten und weiterentwickeln [zu] können“ (SchwbG, § 14 Abs. 2).
1.2. Inhalt des Schwerbehindertengesetzes
Der Inhalt dieses Gesetzes bezieht sich auf alle möglichen Lebensbereiche , es geht jedoch besonders auf das Recht der Behinderten im Bereich des Arbeitslebens ein. Das SchwbG ist ein besonderer Teil des Sozialgesetzbuches und es ist in zwölf Abschnitte gegliedert.
Der erste Abschnitt bezieht sich auf den geschützten Personenkreis, d. h. alle Personen, für welche dieses Gesetz gilt. Es erfasst Schwerbehinderte (Personen mit einer Behinderung von mindestens 50) und Gleichgestellte.(GdB von mindestens 30, die aufgrund von Schwierigkeiten bei der Beschaffung, bzw. Erhaltung einer Arbeitsstelle dem Schwerbehinderten gleichgestellt werden). Als Nachweis der Schwerbehinderteneigenschaften dient der Schwerbehindertenausweis, der vom Versorgungsamt ausgestellt wird. Er besitzt jedoch nur eine befristete Gültigkeit und nach Ablauf dieser Zeit ist eine Neufeststellung der jeweiligen Behinderung notwendig.
Im zweiten Abschnitt wird auf die Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber eingegangen. Jedes Unternehmen, sofern es mindestens 16 Arbeiter beschäftigt, muss eine bestimmte Anzahl von Schwerbehinderten einstellen. Hierbei ist vor allem auf Behinderte Rücksicht zu nehmen, die es aufgrund der Art oder der Schwere der Beeinträchtigung besonders schwer haben, eine Anstellung zu finden, oder auf solche, die das 50. Lebensjahr bereits vollendet haben. Arbeitgeber müssen ebenfalls Ausbildungsmöglichkeiten für Behinderte zur Verfügung stellen.
Wird jedoch die vorgeschriebene Zahl der Stellen für Schwerbehinderte nicht vergeben, so muss eine Ausgleichssumme von 200 DM je Monat und nichtbesetzten Pflichtplatz vom Arbeitgeber gezahlt werden. Durch diese Abgabe wird jedoch die Pflicht zur Beschäftigung Behinderter nicht aufgehoben. Sie stellt einen kostenmäßigen Ausgleich gegenüber den Arbeitgebern dar, die ihrer Beschäftigungspflicht nachkommen und denen daraus zusätzliche Kosten entstehen, z.B. durch den gesetzlichen Zusatzurlaub, oder die Ausstattung des Arbeitsplatzes mit technischen Hilfsmitteln.
Die Ausgleichsabgaben gelangen in den sogenannten „Ausgleichsfonds für überregionale Maßnahmen zur Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft“. Dieses Geld darf nur zur Arbeits- und Berufsförderung Schwerbehinderter genutzt werden.
Im dritten Abschnitt des SchwbG sind die sonstigen Pflichten der Arbeitgeber zu finden.
Dazu gehören unter anderem die behindertenfreundliche Gestaltung des Arbeitsplatzes, die Schaffung der Möglichkeit für die Behinderten, sich voll und ganz im Bereich ihrer Fähigkeiten auszuleben und vor allem ihr berufliches Fortkommen zu fördern. Er ist jedoch nicht nur den Schwerbehinderten gegenüber verpflichtet, sondern auch der Bundesanstalt für Arbeit und den Hauptfürsorgestellen. So muss er z. B. ein genaues Verzeichnis über die von ihm beschäftigten Schwerbehinderten führen, in welches er dem Arbeitsamt oder der Hauptfürsorgestelle jederzeit Einblick gewähren muss.
Die Bestimmungen zum Kündigungsschutz sind Inhalt des vierten Abschnitts.
Die Schwerbehinderten haben einen erweiterten Kündigungsschutz, die Kündigung kann nur mit Zustimmung der zuständigen Hauptfürsorgestelle durchgeführt werden. Der Arbeitgeber muss sein Vorhaben schriftlich beantragen und es ist die Pflicht der Hauptfürsorgestelle, eine gerechte Lösung zu finden. Hierzu werden verschiedene andere Stellungnahmen, wie z. B. die der Schwerbehindertenvertretung, oder die des Schwerbehinderten selbst, angehört. Die Hauptfürsorgestelle muss die Genehmigung erteilen, wenn dem Schwerbehinderten z. B. eine andere zumutbare Arbeitsstelle angeboten wird.
Kommt es doch zur Kündigung, so beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist mindestens vier Wochen.
Der fünfte Abschnitt gibt Auskunft über die Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrates, des Beauftragten des Arbeitgebers und ganz besonders der Schwerbehindertenvertretung.
Die Hauptaufgabe der verschiedenen Räte ist es vor allem, die Eingliederung von Schwerbehinderten in das Berufsleben zu fördern. Sie besitzen zudem eine gewisse Kontrollfunktion über die Arbeitgeber, ob diese ihren Verpflichtungen gegenüber ihren behinderten Angestellten nachkommen.
Bei wenigstens fünf Schwerbehinderten in einem Betrieb wird eine Schwerbehindertenvertretung in Form eines Vertrauensmann bzw. einer Vertrauensfrau und mindestens eines Stellvertreters von allen im Betrieb beschäftigten Behinderten gewählt. Die Wahl findet alle vier Jahre statt und es wird geheim und direkt gewählt. Neben der Aufgabe, der Eingliederung der Behinderten, soll die Vertretung ihnen helfend und beratend zur Seite stehen. Sie nimmt Anregungen und Beschwerden der Behinderten entgegen und versucht diese in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber umzusetzen. Die Schwerbehindertenvertretung nimmt an Sitzungen des Personalrats usw. teil und gibt daraus resultierende Beschlüsse an die Schwerbehinderten weiter.
Die Position der Vertrauensperson ist ein Ehrenamt, welches unentgeltlich ausgeführt wird.
Auch der Arbeitgeber hat einen Beauftragten, der ihn in Angelegenheiten, welche die Schwerbehinderten betreffen, vertritt.
Der wichtigste Punkt ist jedoch, dass alle, sowohl Arbeitgeber und dessen Beauftragter, Schwerbehindertenvertretung als auch sämtliche Räte ihr Bestes versuchen, die Eingliederung der Schwerbehinderten in die Arbeitswelt zu ermöglichen und zu diesem Zweck miteinander und nicht gegeneinander arbeiten.
Bei der Durchführung des Gesetzes, welche Inhalt des sechsten Abschnittes ist, sind vor allem die Hauptfürsorgestellen und die Bundesanstalt für Arbeit beteiligt. Diese Institutionen koordinieren die meisten Maßnahmen im Bezug auf das Schwerbehindertengesetz. Die Aufgaben der Hauptfürsorgestellen sind u.a. die begleitende Hilfe der Behinderten im Arbeits- und Berufsleben, Entscheidungen bei Fragen der Kündigung, oder die Erhebung und Verwendung von Ausgleichsabgaben der Arbeitgeber. Sie können auch bestimmte Geldleistungen an Schwerbehinderte (z.B. für technische Hilfsmittel), Arbeitgeber (z.B. zur behindertengerechten Einrichtung der Arbeitsplätze) oder an gemeinnützige Einrichtungen oder Organisationen, gewähren.
Die Bundesanstalt für Arbeit ist u.a. für die Berufsberatung, die Ausbildungsvermittlung und die Arbeitsvermittlung Schwerbehinderter zuständig. Ebenfalls steht sie den Arbeitgebern bei der Besetzung der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten beratend zur Seite und fördert diese Einstellungen und Beschäftigungen.
Sowohl bei den Hauptfürsorgestellen, als auch bei der Bundesanstalt für Arbeit wird ein Beratender Ausschuss für Behinderte gebildet. Er besteht aus 10 bzw. 11 Mitgliedern und soll die Eingliederung der Behinderten in das Berufsleben durch Vorschläge fördern. Dieser Ausschuss unterstützt die Hauptfürsorgestellen bzw. die Bundesanstalt für Arbeit bei der Durchführung des Schwerbehindertengesetzes wirkt bei der Vergabe von Mitteln mit. Die Mitglieder dieser Ausschüsse über ihre Tätigkeit ehrenamtlich für 4 Jahre aus.
Abschnitt sieben befasst sich mit dem Fortfall des Schwerbehindertenschutzes. Dieser kann erlöschen, wenn der Grad der Behinderung auf unter 50 sinkt. Es kann aber auch zur Entziehung des Schutzes durch die Hauptfürsorgestelle kommen, wenn der Schwerbehinderte sich z. B. ohne vernünftigen Grund weigert, eine für ihn zumutbare Arbeitsstelle anzunehmen, oder mit seinem Verhalten die Eingliederung in die Arbeitswelt behindert. Dies geschieht jedoch nicht ohne die vorherige Anhörung des Betroffenen.
Der achte Abschnitt geht auf das Widerspruchsverfahren ein.
Es kann gegen Entscheidungen der Hauptfürsorgestellen, wie z.B. im Kündigungsschutz- verfahren, oder der Verwendung der Ausgleichsabgaben, Widerspruch erhoben werden. Hierzu wird ein Widerspruchsausschuss gebildet, der aus sieben Mitgliedern besteht (zwei schwerbehinderte Arbeitnehmer, zwei Arbeitgeber, ein Vertreter des Landesarbeitsamtes und ein Vertrauensmann/ eine Vertrauensfrau). Auch das Landesarbeitsamt hat einen solchen Ausschuss zu bilden. Dieser kann ebenfalls gegen Entscheidungen des jeweiligen Arbeitsamtes vorgehen, so etwa gegen die Ablehnung des Antrags eines Behinderten auf Gleichstellung mit einem Schwerbehinderten.
Sonstige Vorschriften sind im neunten Abschnitt des Schwerbehindertengesetzes zusammengefasst. Eine davon ist z.B., dass Schwerbehinderte, wenn sie es wollen, von Mehrarbeit freizustellen sind. Ebenfalls haben sie Anspruch auf einen bezahlten Zusatzurlaub von fünf Arbeitstagen im Jahr.
Ein wichtiger Punkt sind auch die Nachteilsausgleiche in Form von bestimmten Rechten und Hilfen, welche jedem Betroffenen entsprechend der Art und Schwere der Behinderung zustehen. Diese sind z.B. Steuervergünstigungen, Ermäßigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Auto, höheres Wohngeld, Befreiung von Rundfunkgebühren, sowie der schon genannte Kündigungsschutz oder der Zusatzurlaub.
Seit 1985 wird in der Bundesrepublik alle zwei Jahre eine Statistik zur Erfassung aller Schwerbehinderten durchgeführt. Dabei wird auf die Zahl der Schwerbehinderten mit gültigem Ausweis, persönliche Merkmale, wie Alter, Geschlecht, Wohnort, usw. und Art, Ursache und Grad der Behinderung eingegangen.
In Abschnitt zehn ist das Hauptaugenmerk auf die Behindertenwerkstätten gerichtet.
Diese sind definiert als Einrichtungen zur Eingliederung Schwerbehinderter in das Arbeitsleben. Eine Werkstatt bietet den Behinderten, die nicht, oder zumindest noch nicht in der Lage sind auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig zu sein, eine Möglichkeit zur Ausübung einer geeigneten Tätigkeit, unabhängig von der Art und der Ursache der Behinderung. Es muss den Behinderten ermöglicht werden, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen.
Jeder Behinderte hat das Recht in einer solchen Werkstatt zu arbeiten, insofern er ein gewisses Maß an Arbeitsleistung erbringt, das sich wirtschaftlich verwerten lässt. Deshalb werden Behinderte, die so stark beeinträchtigt sind, dass sie nicht ohne ständige Betreuung und Pflege arbeiten können, von den Werkstätten nicht aufgenommen.
Es stehen den Behinderten während ihrer Arbeitszeit begleitende Dienste zur Verfügung, wie z.B. Ärzte, Psychologen oder Sozialarbeiter.
Die Behindertenwerkstatt sollte in der Lage sein, sich zum großen Teil durch die Arbeitserträge selbst zu finanzieren. Dies ist ein Kriterium zur Anerkennung einer Institution als „Werkstatt für Behinderte“, welche von der Bundesanstalt für Arbeit ausgesprochen wird.
Sie sollte ebenfalls ein möglichst breites Angebot an Arbeitsplätzen mit geeigneten Tätigkeiten für Schwerbehinderte bieten.
Die Behinderten erhalten für ihre geleistete Arbeit einen Lohn und sie sind selbständig kranken- und rentenversichert.
Die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr ist Inhalt des elften Abschnittes. Behinderte, die in ihrer Bewegungsfähigkeit so eingeschränkt oder hilflos oder gehörlos sind, haben ein Recht darauf, von den verschiedenen Unternehmen des Personenverkehrs kostenfrei befördert zu werden. Als Nachweis ihrer Behinderung müssen sie eine entsprechend gekennzeichneten Ausweis mit einer gültigen Wertmarke, die sie gegen einen Betrag von 120 DM/Jahr erhalten, vorlegen. Die Begleitperson hat dann ebenfalls kein Fahrgeld zu bezahlen. Krankenfahrstühle und sonstige Hilfsmittel dürfen an den dafür vorgesehenen Stellen unentgeltlich untergebracht werden.
Die Unternehmen können einen Antrag darauf stellen, dass ihnen die aus diesem Gesetz resultierenden Fahrgeldausfälle zurück erstattet werden. Hierfür ist im Fernverkehr das Bundesverwaltungsamt zuständig und im Nahverkehr entscheidet die Landesregierung, welche Behörde über dies Anträge abstimmt.
Im zwölften und letzten Abschnitt des Schwerbehindertengesetzes geht es um Ordnungswidrigkeiten, Straf- und Schlussvorschriften.
Es handelt sich z.B. um Ordnungswidrigkeiten, wenn ein Arbeitgeber den bestimmten Pflichtsatz an behinderten Beschäftigten nicht erfüllt, oder nicht umfassend und offen mit der Schwerbehindertenvertretung zusammenarbeitet. Hierbei kann es zu Bußgeldern bis zu 5000 DM kommen.
Die Schwerbehindertenvertretung, insbesondere die Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten, können bei nicht Einhaltung der Schweigepflicht mit Gefängnisstrafen bis zu einem Jahr oder einer Geldbuße bestraft werden.
1.3. Durchführung des Schwerbehindertengesetzes
1.3.1. Aus der Arbeit der Schwerbehindertenvertretung
Die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind im SchwbG definiert, jedoch ist diese Definition wenig hilfreich, wenn man sich ein Bild von ihrer Arbeit machen will. Ich werde versuchen anhand von konkreten Beispielen zu zeigen, mit welchen Problemen die Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung im Alltag konfrontiert werden.
Zu den wichtigsten Bereichen zählen die behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung, das Lösen von Konflikten am Arbeitsplatz und die Mitwirkung bei Einstellungs- und Kündigungsverfahren.
Die Beseitigung von Problemen bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes wird durch die rechtzeitige Erkennung von Verbesserungsmöglichkeiten beschleunigt. Die Arbeitsplätze müssen den Menschen angepasst werden, nicht umgekehrt. Dieser Fakt ist gerade für Schwerbehinderte, die meist Schwierigkeiten haben, aufgrund ihrer Beeinträchtigung z.B. stundenlang in der gleichen Position zu arbeiten, besonders wichtig. Um herauszufinden, ob die Arbeitsbedingungen erträglich sind, oder einer Änderung bedürfen sind Betriebsbegehungen notwendig, um sich vor Ort ein Bild von der Situation der Arbeiter zu machen.
Es ist ebenfalls wichtig, eng mit den Schwerbehinderten zusammen zu arbeiten. Die Vertretung sollte versuchen, die Arbeiter zu motivieren, bei Problemen sofort Kontakt mit ihr aufzunehmen, wie z. B. im Fall von Thorsten K., der Metallfacharbeiter in einem Karosseriebauunternehmen ist:
„Bei uns in der Schleiferei wurde das Klima immer schlechter, und zwar im wörtlichen Sinne. Die Luft war schlecht, und viele meiner Kollegen waren wegen Atemwegserkrankungen in Behandlung. Das lag vor allem an den alten Schleifmaschinen. Da hat man den Staub und den Dreck immer direkt ins Gesicht bekommen. Die Masken haben da auch nicht mehr viel geholfen. Da ich aufgrund einer Lungenschädigung schwerbehindert bin, hat mir das so zugesetzt, dass ich immer häufiger krank war. Ich habe dann unserer Vertrauensfrau gefragt, was man da machen könnte. Die hat sich dann mit dem Betriebsrat zusammengesetzt und die haben gemeinsam erreicht, dass wir neu Schleifmaschinen mit einer modernen Absaugvorrichtung bekamen. das kam dann nicht nur mir, sondern auch den Kollegen, die nicht behindert sind, zugute.“
Probleme lassen sich nicht immer vollständig beseitigen, aber meist ist zumindest eine Linderung vorhanden und in vielen Fällen kommt es zu einer spürbaren Verbesserung.
Es gibt aber auch zwischenmenschliche Konflikte, die sich nicht auf materiellem Weg lösen lassen. Markus O. hat eine typische Situation erlebt, von der viele Schwerbehinderte ebenfalls betroffen sind:
„Als ich wegen meinem Wirbelsäulenschaden einen Schwerbehindertenausweis bekam, dachte ich erst mal, daß das nur eine Formsache ist. Ich habe mich ja wieder recht fit gefühlt und mich aufs Arbeiten auch wieder gefreut. Mein Arbeitsplatz wurde entsprechend eingerichtet - ich bekam einen Spezialstuhl und einen Spezialtisch. Daß die Kollegen da so neidisch reagieren würden, hätte ich im Traum nicht gedacht. Das ging soweit, daß die mit mir nicht mehr geredet haben und mich wie einen Sonderling behandelt haben.“
Diese oder ähnliche Dinge können Auslöser für Konflikte sein. Einige nicht behinderte Mitarbeiter sehen nicht ein, warum ein Schwerbehinderter z. B. Zusatzurlaub bekommt, oder nicht schwer heben darf. Daraus resultieren oft Spannungen, die zu ernsthaften Konflikten, ja sogar Diskriminierung der betroffenen Person führen kann. Hier wird von der Schwerbehindertenvertretung erwartet, dass sie versucht zwischen den einzelnen Gruppen zu vermitteln.
Doch auch auf Seiten der Arbeitgeber bestehen viele Vorurteile gegenüber Behinderten und vor allem deren Beschäftigung. Die meisten scheuen sich davor, Behinderte einzustellen, aus Angst, sie seien nicht voll leistungsfähig, wären häufiger und länger krank oder es wäre einfach zu teuer, die Arbeitsplätze behindertengerecht zu gestalten. Hier muss die Schwerbehindertenvertretung ansetzen und kontinuierlich an einer positiven Einstellung zur Beschäftigung Behinderter arbeiten.
Gerade die Arbeitgeber sollten ihren Angestellten mit gutem Beispiel voran gehen und den Grundstein für eine gute Zusammenarbeit legen. Wenn der Arbeitgeber Schwerbehinderten von vorneherein ablehnend gegenüber steht, ist es auch für die Schwerbehindertenvertretung sehr schwer, die bestmöglichen Arbeitsbedingungen für Behinderte zu schaffen.
Häufig gestellte Fragen zu "Das Schwerbehindertengesetz"
Was ist das Schwerbehindertengesetz (SchwbG)?
Das Schwerbehindertengesetz (SchwbG) ist ein deutsches Gesetz, das 1974 erlassen wurde und darauf abzielt, schwerbehinderte Menschen in Beruf, Arbeit und Gesellschaft einzugliedern. Es legt besonderen Wert auf begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben, um mögliche Schwierigkeiten frühzeitig zu verhindern.
Wer gilt als schwerbehindert im Sinne des Gesetzes?
Im Sinne des Gesetzes (§3) ist Behinderung die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung (mindestens sechs Monate), die auf einem regelwidrigen, nicht dem Lebensalter typischen, körperlichen, geistigen und seelischen Zustand beruht. Eine Schwerbehinderung liegt ab einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 vor.
Wer entscheidet über den Grad der Behinderung (GdB)?
Die Versorgungsämter sind für die Feststellung des GdB zuständig. Sie richten sich dabei nach den "Anhaltspunkten für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertengesetz".
Was ist eine Gleichstellung mit Schwerbehinderten?
Eine Gleichstellung ist möglich ab einem GdB von 30, wenn man infolge einer Behinderung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder behalten kann.
Welche Pflichten haben Arbeitgeber nach dem SchwbG?
Arbeitgeber mit mindestens 16 Beschäftigten sind verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Arbeitsplätzen an Schwerbehinderte zu vergeben. Andernfalls müssen sie eine Ausgleichsabgabe leisten. Sie müssen auch Ausbildungsmöglichkeiten für Behinderte zur Verfügung stellen und den Arbeitsplatz behindertengerecht gestalten.
Was ist die Ausgleichsabgabe?
Die Ausgleichsabgabe ist eine monatliche Zahlung, die Arbeitgeber leisten müssen, wenn sie die vorgeschriebene Anzahl von Schwerbehinderten nicht beschäftigen. Diese Gelder fließen in den "Ausgleichsfonds für überregionale Maßnahmen zur Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft".
Wie sind Schwerbehinderte vor Kündigung geschützt?
Schwerbehinderte haben einen erweiterten Kündigungsschutz. Eine Kündigung bedarf der Zustimmung der zuständigen Hauptfürsorgestelle. Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen.
Was ist die Schwerbehindertenvertretung?
Bei wenigstens fünf Schwerbehinderten in einem Betrieb wird eine Schwerbehindertenvertretung gewählt. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Eingliederung von Schwerbehinderten in das Berufsleben zu fördern, ihnen beratend zur Seite zu stehen und Anregungen und Beschwerden entgegenzunehmen.
Welche Aufgaben haben die Hauptfürsorgestellen?
Die Hauptfürsorgestellen koordinieren Maßnahmen im Bezug auf das Schwerbehindertengesetz, leisten begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben, entscheiden über Kündigungen und erheben und verwenden Ausgleichsabgaben.
Was sind Behindertenwerkstätten (WfB)?
Behindertenwerkstätten sind Einrichtungen zur Eingliederung Schwerbehinderter in das Arbeitsleben, die nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können. Sie bieten ihnen eine geeignete Tätigkeit und ermöglichen es ihnen, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln und zu erhöhen. Die Behinderten erhalten für ihre geleistete Arbeit einen Lohn und sind kranken- und rentenversichert.
Welche Nachteilsausgleiche gibt es für Schwerbehinderte?
Schwerbehinderte haben Anspruch auf Nachteilsausgleiche wie Steuervergünstigungen, Ermäßigungen im öffentlichen Verkehr, höheres Wohngeld, Befreiung von Rundfunkgebühren, Kündigungsschutz und Zusatzurlaub.
Welche Rolle spielt die Schwerbehindertenvertretung in der Praxis?
Die Schwerbehindertenvertretung setzt sich für behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung ein, löst Konflikte am Arbeitsplatz und wirkt bei Einstellungs- und Kündigungsverfahren mit. Sie arbeitet eng mit den Schwerbehinderten zusammen und versucht, ihre Interessen zu vertreten.
- Quote paper
- Anne Abendroth (Author), 2001, Schwerbehindertengesetz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103849