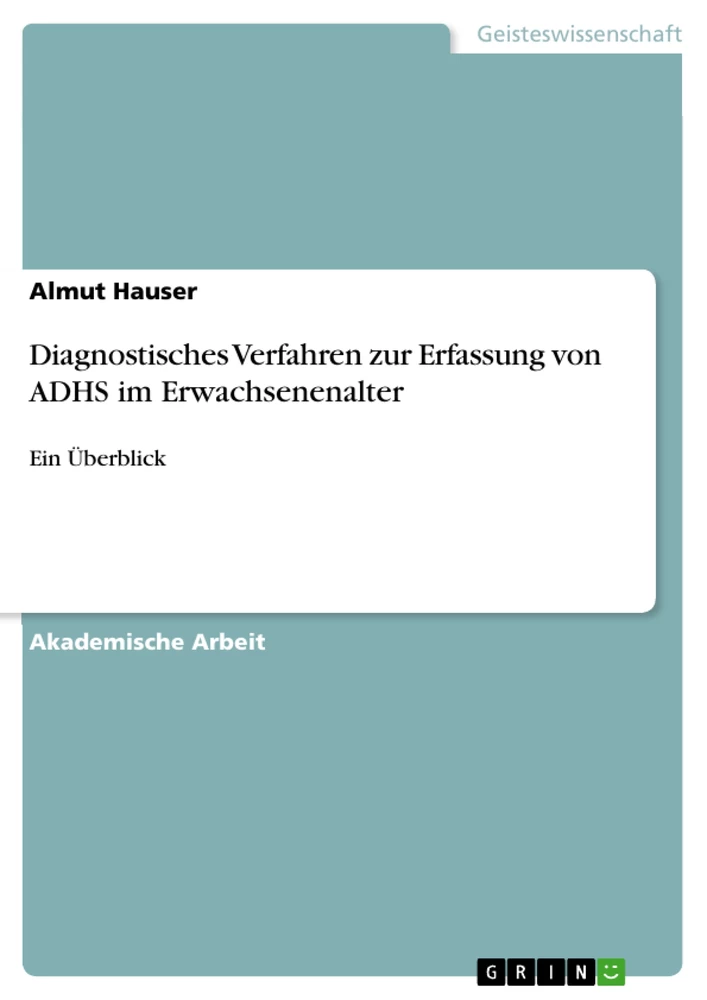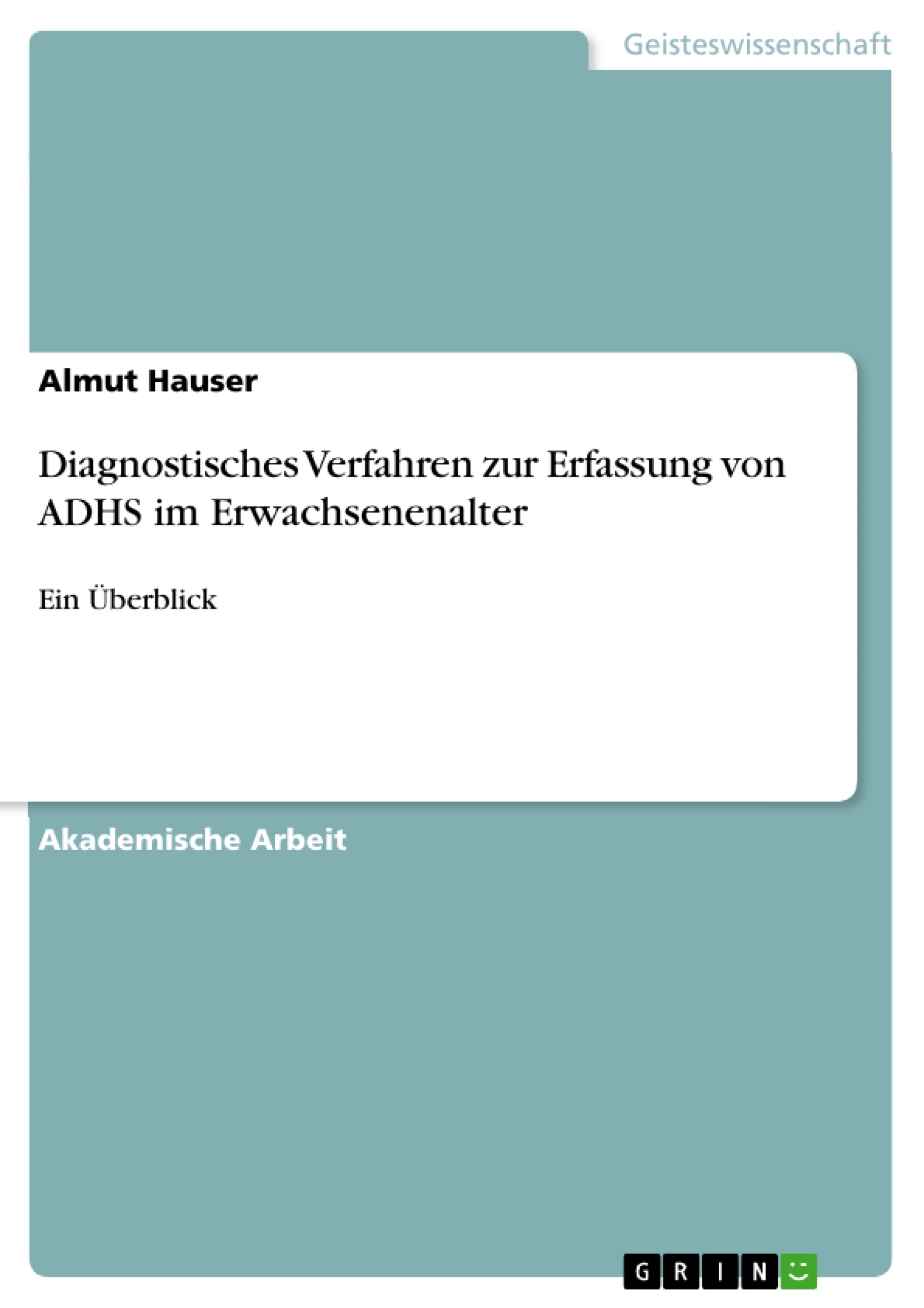Die Vielfalt der Verfahren zur Erfassung von ADHS im Erwachsenenalter hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Leitlinien wie die NICE-guideline und im deutschsprachigen Raum die S3-Leitlinien geben eine ständig aktualisierte Orientierung für den Diagnostiker. In der vorliegenden Arbeit wird ein Überblick über die wichtigsten aktuellen Verfahren gegeben und erläutert, worin sie sich unterscheiden.
Zunächst wird gezeigt, wie sich die Diagnose in den unterschiedlichen Klassifikationssystemen, dem ´International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems´ (ICD-10) (Dilling & Freyberger, 2019), dem `Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders´ (DSM-5) (Falkai, P. et al., 2014), den eigens für ADHS im Erwachsenenalter konzipierten Wender-Utah-Kriterien und dem zukünftigen ICD-11-Klassifikationssystem (“ICD-11,” 2021) darstellt, sowie der alternative, noch nicht etablierte Ansatz des Diagnosesystems `Research Domain Criteria´ (RDoC) (Akram & Giordano, 2017), vorgestellt.
Verfügbare deutschsprachige Instrumente werden aufgeführt, die jeweiligen Inhalte, aktuelle Befundlage bezüglich der Validität und der Reliabilität einschließlich möglicher Limitationen dargestellt. Es stehen zur Erfassung der aktuellen und retrospektiven Symptomatik der adulten ADHS eine Reihe reliabler und valider Screening-, Selbst- und Fremdbeurteilungsverfahren sowie strukturierte Interviews zur Verfügung. Eine Diagnostik anhand von Biomarkern konnte noch nicht validiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Klinisches Störungsbild
- Diagnose der adulten ADHS nach ICD-10
- Diagnose der adulten ADHS nach DSM-5
- Wender-Utah-Kriterien
- Diagnose der adulten ADHS nach ICD-11 in der Zukunft
- Diagnostischer Ansatz: RDoC-Initiative (Research Domain Criteria)
- Methodisches Vorgehen
- Diagnoseverfahren – multimodal
- Selbsturteil
- ADHS-SB
- ASRS-v1.1-Screener und ASRS-v1.1 erweiterte Symptom-Checkliste
- ADHS-E und ADHS-LE
- CAARS-S
- WURS-k
- Klinisches Urteil
- ADHS-DC und ADHS-DC-Q
- WRI und WRI-V
- DIVA 2.0
- CAARS-O
- EIS-B
- Testbatterien im Überblick
- HASE
- KATE
- IDA-R
- Neurodiagnostik
- Qb-Test plus
- EEG-Daten
- Selbsturteil
- Diskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit bietet einen Überblick über diagnostische Verfahren zur Erfassung von ADHS im Erwachsenenalter. Ziel ist es, die verschiedenen Methoden, ihre Stärken und Schwächen, sowie den aktuellen Stand der Forschung darzustellen. Die Arbeit berücksichtigt verschiedene Klassifikationssysteme und bewertet die Validität und Reliabilität der vorgestellten Instrumente.
- Diagnose von ADHS im Erwachsenenalter anhand verschiedener Klassifikationssysteme (ICD-10, DSM-5, Wender-Utah-Kriterien, ICD-11)
- Vielfalt und Bewertung diagnostischer Verfahren (Selbst- und Fremdbeurteilung, strukturierte Interviews, Testbatterien)
- Beurteilung der Validität und Reliabilität der diagnostischen Instrumente
- Einordnung der Neurodiagnostik in die ADHS-Diagnostik
- Diskussion der Limitationen bestehender Verfahren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der ADHS-Diagnostik im Erwachsenenalter ein und beschreibt die steigende Bedeutung und Komplexität der Thematik. Sie begründet die Notwendigkeit eines umfassenden Überblicks über die verfügbaren diagnostischen Verfahren.
Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der ADHS-Diagnostik. Es beschreibt das klinische Störungsbild und vergleicht die diagnostischen Kriterien nach ICD-10, DSM-5, den Wender-Utah-Kriterien und dem zukünftigen ICD-11. Zusätzlich wird der neuere, noch nicht etablierte Ansatz des RDoC-Modells vorgestellt. Die unterschiedlichen Klassifikationssysteme werden verglichen und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgestellt, um ein umfassendes Verständnis der diagnostischen Herausforderungen zu schaffen. Der Abschnitt liefert den notwendigen theoretischen Rahmen für die anschließende Diskussion der diagnostischen Verfahren.
Diagnoseverfahren – multimodal: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung verschiedener multimodaler Diagnoseverfahren für ADHS im Erwachsenenalter. Es unterteilt die Verfahren in Selbsturteil (z.B. ADHS-SB, ASRS, CAARS-S, WURS-k) und klinisches Urteil (z.B. ADHS-DC, WRI, DIVA 2.0, CAARS-O, EIS-B), sowie Testbatterien (HASE, KATE, IDA-R) und neurodiagnostische Verfahren (Qb-Test plus, EEG). Für jedes Verfahren werden die Inhalte, die aktuelle Befundlage hinsichtlich Validität und Reliabilität, sowie mögliche Limitationen diskutiert. Der Überblick ermöglicht eine umfassende Beurteilung der jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze. Die Darstellung der verschiedenen Methoden bietet dem Leser einen klaren und strukturierten Einblick in die Vielfalt der verfügbaren diagnostischen Tools.
Schlüsselwörter
ADHS, Erwachsenenalter, Diagnostik, ICD-10, DSM-5, Wender-Utah-Kriterien, ICD-11, RDoC, Selbstbeurteilung, Fremdbeurteilung, strukturierte Interviews, Testbatterien, Neurodiagnostik, Validität, Reliabilität, Limitationen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Facharbeit: Diagnostische Verfahren bei ADHS im Erwachsenenalter
Was ist der Inhalt dieser Facharbeit?
Die Facharbeit bietet einen umfassenden Überblick über die diagnostischen Verfahren zur Erfassung von ADHS im Erwachsenenalter. Sie behandelt die verschiedenen Methoden, ihre Stärken und Schwächen, den aktuellen Forschungsstand und berücksichtigt verschiedene Klassifikationssysteme (ICD-10, DSM-5, Wender-Utah-Kriterien, ICD-11).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen diagnostischen Methoden für ADHS im Erwachsenenalter darzustellen und zu bewerten. Es werden die Validität und Reliabilität der vorgestellten Instrumente berücksichtigt und die Limitationen bestehender Verfahren diskutiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Diagnose von ADHS im Erwachsenenalter anhand verschiedener Klassifikationssysteme, die Vielfalt und Bewertung diagnostischer Verfahren (Selbst- und Fremdbeurteilung, strukturierte Interviews, Testbatterien), die Beurteilung der Validität und Reliabilität der Instrumente, die Einordnung der Neurodiagnostik und die Diskussion der Limitationen bestehender Verfahren.
Welche Klassifikationssysteme werden berücksichtigt?
Die Facharbeit berücksichtigt die Klassifikationssysteme ICD-10, DSM-5, die Wender-Utah-Kriterien und den zukünftigen ICD-11. Zusätzlich wird das RDoC-Modell (Research Domain Criteria) vorgestellt.
Welche diagnostischen Verfahren werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert verschiedene diagnostische Verfahren, unterteilt in Selbsturteil (z.B. ADHS-SB, ASRS, CAARS-S, WURS-k), klinisches Urteil (z.B. ADHS-DC, WRI, DIVA 2.0, CAARS-O, EIS-B), Testbatterien (HASE, KATE, IDA-R) und neurodiagnostische Verfahren (Qb-Test plus, EEG).
Wie werden die diagnostischen Verfahren bewertet?
Für jedes Verfahren werden die Inhalte, die aktuelle Befundlage hinsichtlich Validität und Reliabilität sowie mögliche Limitationen diskutiert. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze werden gegenübergestellt.
Was ist der theoretische Hintergrund der Arbeit?
Der theoretische Hintergrund beschreibt das klinische Störungsbild von ADHS und vergleicht die diagnostischen Kriterien der verschiedenen Klassifikationssysteme. Er liefert den notwendigen Rahmen für die Diskussion der diagnostischen Verfahren.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der Einleitung (Einführung in die Thematik), des theoretischen Hintergrunds (Klinisches Bild, Kriterienvergleiche), der multimodalen Diagnoseverfahren (detaillierte Beschreibung der Methoden) und der Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: ADHS, Erwachsenenalter, Diagnostik, ICD-10, DSM-5, Wender-Utah-Kriterien, ICD-11, RDoC, Selbstbeurteilung, Fremdbeurteilung, strukturierte Interviews, Testbatterien, Neurodiagnostik, Validität, Reliabilität, Limitationen.
- Quote paper
- Almut Hauser (Author), 2021, Diagnostisches Verfahren zur Erfassung von ADHS im Erwachsenenalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1038346