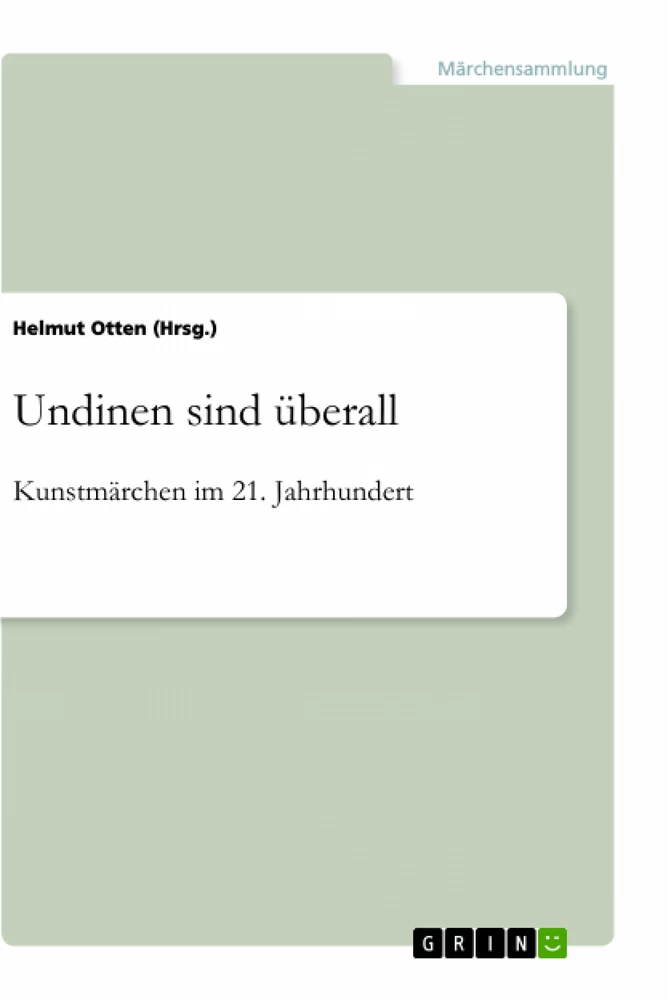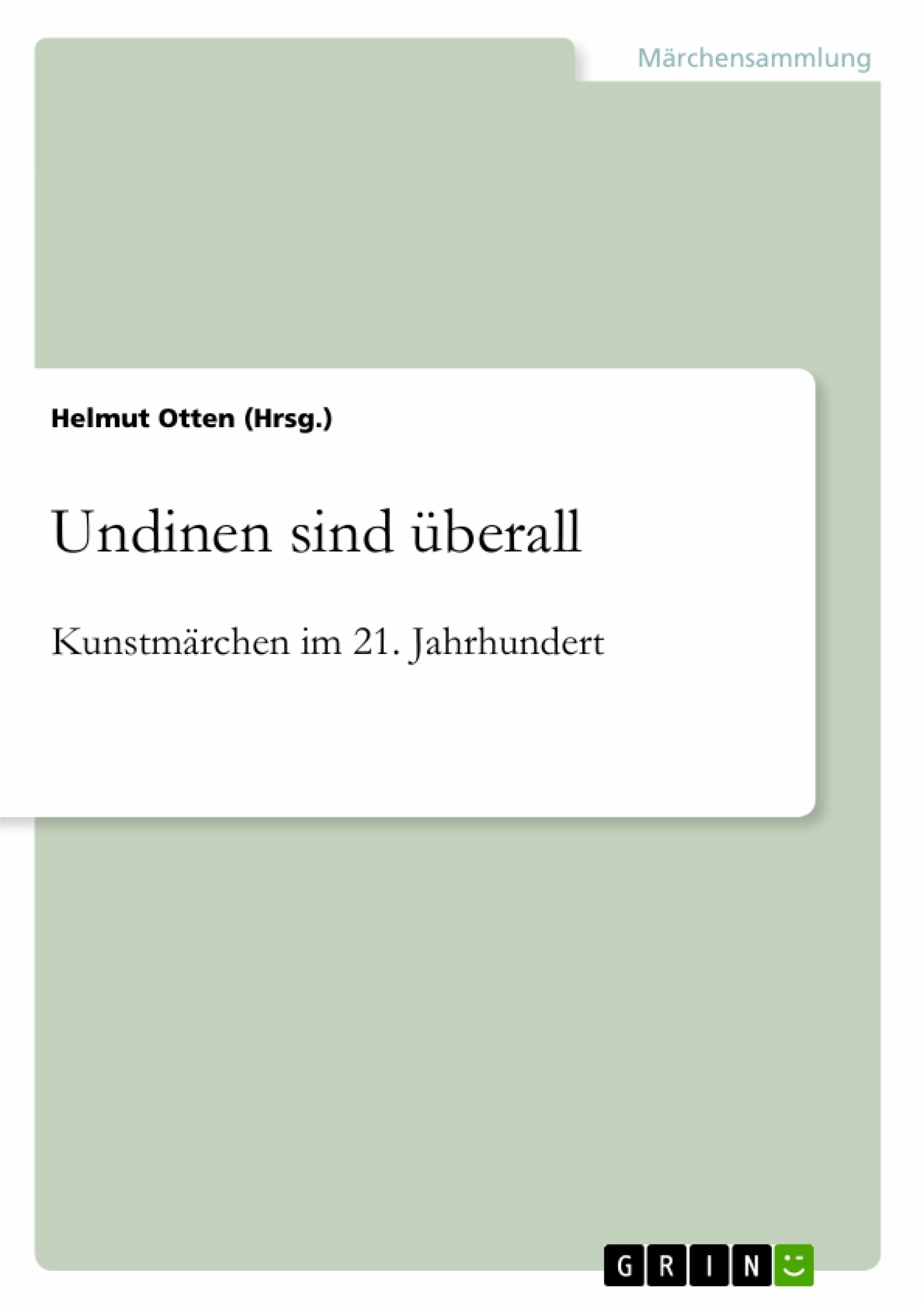Eine im hohen Grad lebendige Wirkung übt das Kunstmärchen Undine von Friedrich de la Motte Fouqué (1777-1843) nicht nur auf die Literaturgeschichte von der Romantik bis in die Gegenwart aus, sondern auch auf die Geschwisterkünste Kunst, Musik und Film bis ins 21. Jahrhundert hinein. Zahlreiche literarische Adaptionen, Malereien und Skulpturen, klassische und moderne Kompositionen bis hin zur Rockmusik, Theaterstücke und filmische Interpretationen, zuletzt erst gerade 2020 in einer deutsch-französischen Koproduktion erschienen, werden von dem Undine-Mythos erfasst und durchdrungen.
Diese Kunstmärchen-Sammlung entstand im Textkompetenz-Seminar (Fachdidaktik Deutsch) zum Thema Der Undine-Mythos im europäischen Kunstmärchen von der Romantik bis ins 21. Jahrhundert in Literatur, Kunst, Musik und Film im Wintersemester 20/21 an der FU Berlin.
Vergleichend verstehendes Interpretieren literarischer Texte und Reflexion individueller Rezeptionsprozesse, analysierendes Interpretieren künstlerischer, musikalischer sowie filmischer Adaptionen und Produktion eines eigenen Kunstmärchens im Kontext des Undine-Mythos waren die Schwerpunkte des Seminars mit dem Ziel zu erweiternder Textkompetenzen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Undine oder die nasse Grenze
- Blindflug
- Andenken
- Die Sehnsucht einer Meerjungfrau
- Eine Welle
- Verschlingende Tiefen
- Die Farben des Wassers
- Die verlorene Identität
- Der Kuss der Treue
- Undine - ein Smartphone-Märchen
- U-ntiefen
- Eben so
- Dalgacik
- Die Muschelkette
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Sammlung von Kunstmärchen entstand im Rahmen eines Seminars an der FU Berlin und untersucht den Undine-Mythos in seiner literarischen, künstlerischen, musikalischen und filmischen Ausprägung von der Romantik bis ins 21. Jahrhundert. Ziel des Seminars war die Erweiterung der Textkompetenz der Studierenden durch vergleichendes und analytisches Interpretieren sowie die kreative Auseinandersetzung mit dem Mythos durch die Produktion eigener Kunstmärchen.
- Der Undine-Mythos in der Literatur und seinen Adaptionen
- Die Entwicklung des Undine-Motivs durch die Jahrhunderte
- Die Darstellung von Liebe, Identität und Sehnsucht im Kontext des Mythos
- Die Rolle der Frauengestalt "Undine" in verschiedenen Interpretationen
- Der Undine-Mythos als Spiegelbild gesellschaftlicher Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert die Entstehung der Sammlung im Kontext eines Seminars an der FU Berlin, das sich mit dem Undine-Mythos in verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen auseinandersetzte. Es beschreibt die Ziele des Seminars, die von der vergleichenden Textinterpretation bis zur kreativen Umsetzung im eigenen Kunstmärchen reichten. Es wird der Einfluss des Undine-Mythos auf Literatur, Kunst, Musik und Film von der Romantik bis in die Gegenwart hervorgehoben und einige Schlüsselwerke und -interpretationen erwähnt, die im Seminar behandelt wurden, um den Rahmen der vorliegenden Arbeit und die Inspiration für die studentischen Arbeiten zu verdeutlichen. Die Einleitung betont die Aktualität und die breite Rezeption des Mythos bis in die Gegenwart.
Undine oder die nasse Grenze: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
Blindflug: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
Andenken: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
Die Sehnsucht einer Meerjungfrau: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
Eine Welle: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
Verschlingende Tiefen: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
Die Farben des Wassers: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
Die verlorene Identität: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
Der Kuss der Treue: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
Undine - ein Smartphone-Märchen: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
U-ntiefen: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
Eben so: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
Dalgacik: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
Die Muschelkette: Diese Zusammenfassung fehlt, da der Text keine detaillierte Beschreibung des Inhalts dieses Kapitels bietet.
Schlüsselwörter
Undine-Mythos, Kunstmärchen, Romantik, Moderne, Literatur, Kunst, Musik, Film, Identität, Liebe, Sehnsucht, Wasser, Utopie, Sprache, Friedrich de la Motte Fouqué, Ingeborg Bachmann, Christian Petzold.
Häufig gestellte Fragen zu "Undine-Mythos in der Literatur und seinen Adaptionen"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument ist eine umfassende Vorschau auf eine Sammlung von Kunstmärchen, die sich mit dem Undine-Mythos auseinandersetzt. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (wobei viele Zusammenfassungen fehlen, da der zugrundeliegende Text keine detaillierte Beschreibung lieferte) und eine Liste von Schlüsselwörtern.
Worum geht es in der Sammlung von Kunstmärchen?
Die Sammlung untersucht den Undine-Mythos in seinen verschiedenen literarischen, künstlerischen, musikalischen und filmischen Ausprägungen von der Romantik bis ins 21. Jahrhundert. Die Märchen entstanden im Rahmen eines Seminars an der Freien Universität Berlin.
Welche Themen werden in den Kunstmärchen behandelt?
Die zentralen Themen sind der Undine-Mythos, seine Entwicklung durch die Jahrhunderte, die Darstellung von Liebe, Identität und Sehnsucht im Kontext des Mythos, die Rolle der Frauengestalt "Undine" in verschiedenen Interpretationen und der Undine-Mythos als Spiegelbild gesellschaftlicher Veränderungen.
Welche Kapitel umfasst die Sammlung?
Die Sammlung enthält die Kapitel: Vorwort, Undine oder die nasse Grenze, Blindflug, Andenken, Die Sehnsucht einer Meerjungfrau, Eine Welle, Verschlingende Tiefen, Die Farben des Wassers, Die verlorene Identität, Der Kuss der Treue, Undine - ein Smartphone-Märchen, U-ntiefen, Eben so, Dalgacik und Die Muschelkette.
Gibt es Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Für das Vorwort gibt es eine Zusammenfassung. Für die restlichen Kapitel fehlt im vorliegenden Dokument eine detaillierte Inhaltsbeschreibung.
Wo wurde die Sammlung erstellt?
Die Sammlung entstand im Rahmen eines Seminars an der Freien Universität Berlin (FU Berlin).
Welche Ziele verfolgte das Seminar?
Das Seminar zielte auf die Erweiterung der Textkompetenz der Studierenden durch vergleichendes und analytisches Interpretieren sowie die kreative Auseinandersetzung mit dem Mythos durch die Produktion eigener Kunstmärchen ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Sammlung?
Schlüsselwörter sind: Undine-Mythos, Kunstmärchen, Romantik, Moderne, Literatur, Kunst, Musik, Film, Identität, Liebe, Sehnsucht, Wasser, Utopie, Sprache, Friedrich de la Motte Fouqué, Ingeborg Bachmann, Christian Petzold.
- Quote paper
- Helmut Otten (Editor), 2021, Undinen sind überall. Kunstmärchen im 21. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1038044