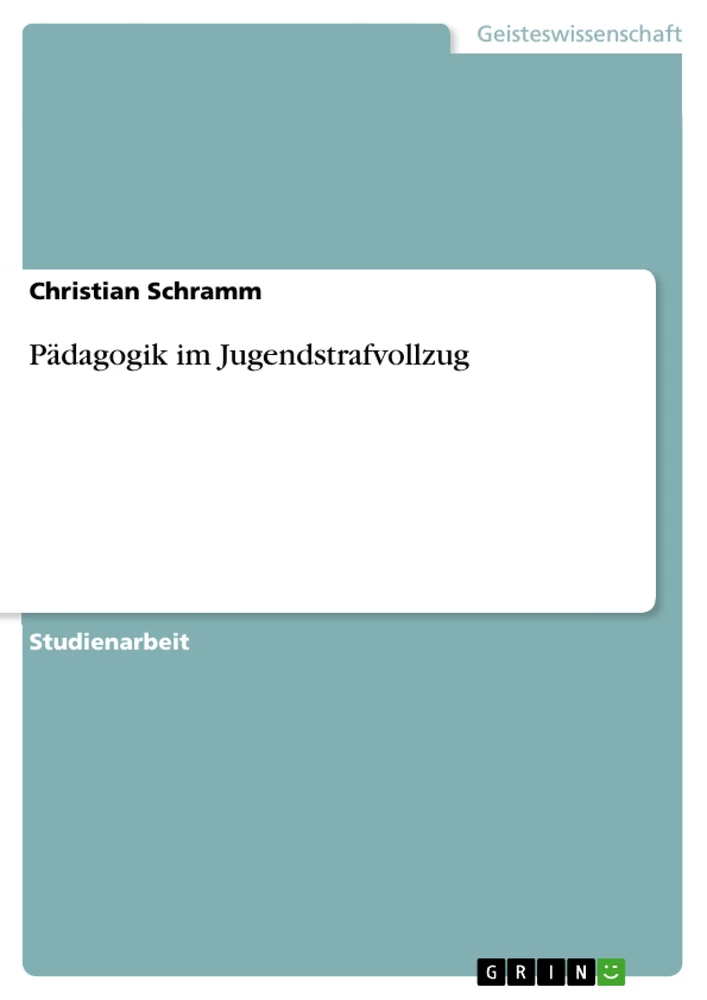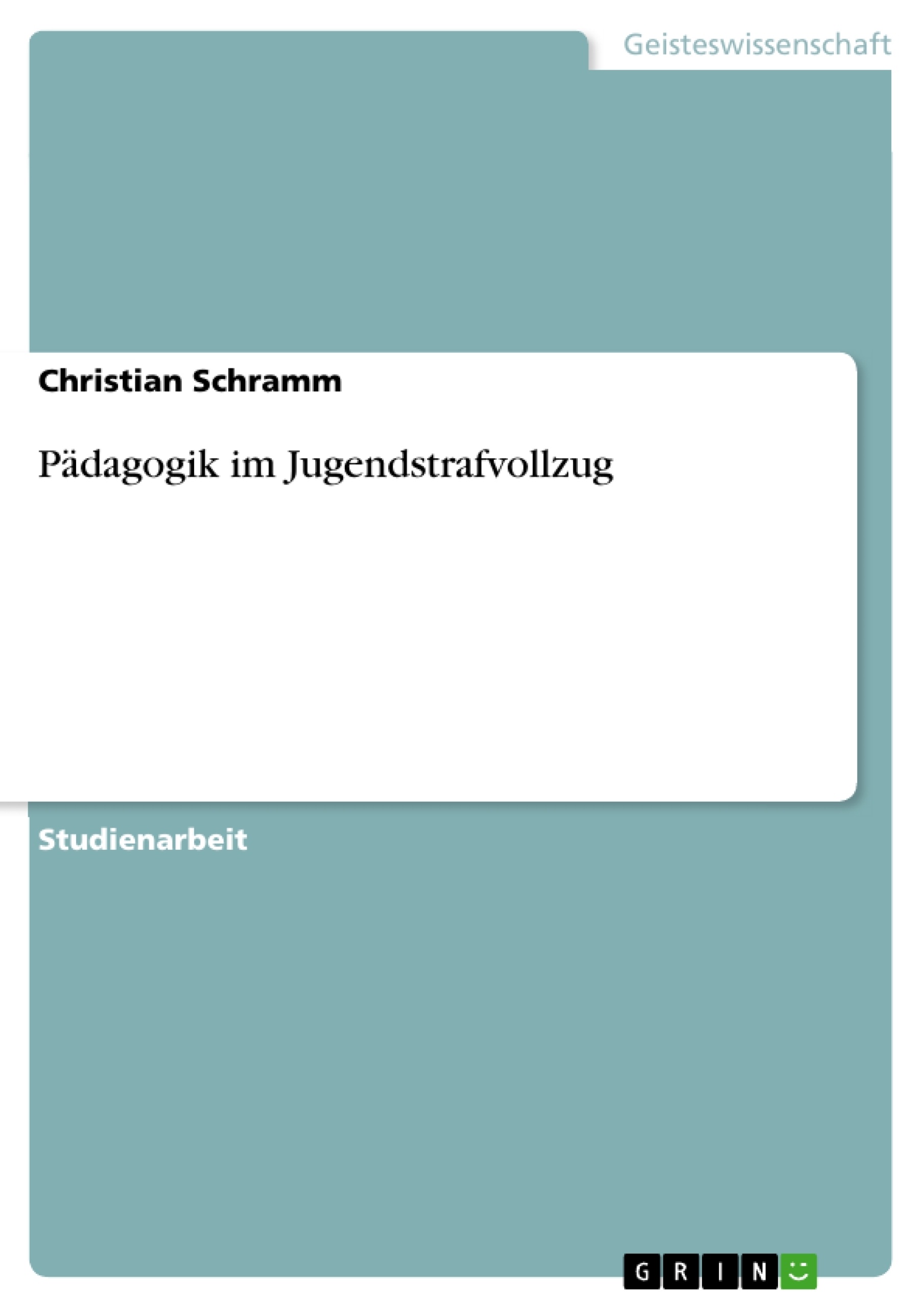Was bedeutet es wirklich, einem jungen Menschen im Gefängnis zu begegnen, nicht als Häftling, sondern als jemandem, der noch geformt werden kann? Diese tiefgründige Analyse dringt in die komplexen Herausforderungen und ethischen Dilemmata der Jugendstraferziehung ein. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Strafvollzugs, von den Anfängen der reinen Verwahrung bis hin zum modernen, auf Resozialisierung ausgerichteten Ansatz. Dabei werden die vielfältigen Faktoren, die auf die Entwicklung junger Menschen im Strafvollzug einwirken, detailliert untersucht. Es werden unterschiedliche Erziehungsstile kritisch betrachtet, von autoritär bis laissez-faire, und ihre Auswirkungen auf das Verhalten und die soziale Kompetenz der Jugendlichen analysiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Definition und Umsetzung von Erziehungszielen im Jugendstrafvollzug, von den übergeordneten Richtzielen der Resozialisierung bis hin zu den konkreten Feinzielen, die auf die Entwicklung von Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein abzielen. Die praxisnahe Betrachtung anhand des Beispiels der Jugendstrafanstalt Schifferstadt ermöglicht einen Einblick in die konkreten Maßnahmen und Einrichtungen, die zur schulischen und beruflichen Förderung, zur Freizeitgestaltung und zur therapeutischen Behandlung junger Straftäter eingesetzt werden. Diese Arbeit wirft ein Licht auf die sozialpädagogischen Aufgabengebiete und die Notwendigkeit, Strafe und Erziehung in einen förderlichen Zusammenhang zu bringen, um abweichendem Verhalten entgegenzuwirken und die Integration der Jugendlichen in die Gesellschaft zu unterstützen. Es ist eine Auseinandersetzung mit den Spannungsfeldern zwischen Resozialisierung und Sicherheitsaspekten, zwischen individueller Förderung und gesellschaftlichen Erwartungen, die für alle relevant ist, die sich mit Jugendkriminalität, Strafvollzug und den Chancen einer zweiten Chance auseinandersetzen. Ein unverzichtbarer Beitrag für Pädagogen, Sozialarbeiter, Juristen und alle, die an einer gerechteren und inklusiveren Gesellschaft interessiert sind. Die Diskussion um die Problematik der Zielsetzung, insbesondere im Hinblick auf das "Doppelmandat" des Strafvollzugs, verdeutlicht die Notwendigkeit einer ständigen Reflexion und Anpassung der erzieherischen Maßnahmen. Es wird die Frage aufgeworfen, wie Vertrauensbildung und Kontrolle in Einklang gebracht werden können, um die Resozialisierung der Jugendlichen nicht zu gefährden. Abschließend wird betont, dass der Jugendstrafvollzug trotz aller Herausforderungen eine Chance bietet, junge Menschen auf ein Leben ohne Straftaten vorzubereiten, wobei jedoch die negativen Einflüsse des Strafvollzugs und die Gefahr der Stigmatisierung berücksichtigt werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
1.1 Geschichtliche Entwicklung des Strafvollzugs
2. Erziehung als vieldimensionale Faktorenkomplexion
2.1 Begriffsbestimmung
2.1.1 Pädagogisches Feld im Jugendstrafvollzug
2.2 Ansprüche an die Erziehung
3. Ausgewählte Erziehungsstile
3.1 Autoritärer Erziehungsstil
3.2 Laissez-fairer Erziehungsstil
3.3 Demokratischer Erziehungsstil
3.4 Kritische Anmerkung im Hinblick auf die praktische Umsetzung
4. Erziehungsziele
4.1 Zielvorstellungen im Jugendstrafvollzug
4.1.1 Richtziele
4.1.2 Grobziele
4.1.3 Feinziele
4.2 Problematik hinsichtlich der Zielsetzung
5. Umsetzung in die Praxis (am Beispiel der JSA Schifferstadt)
5.1 Allgemeines zur Jugendstrafanstalt
5.2 Einrichtungen für Schule und Beruf
5.2.1 Schulische Maßnahmen
5.2.2 Maßnahmen zur Berufsvorbereitung
5.2.3 Arbeitstherapeutische Maßnahmen
5.3 Freizeit
5.3.1 Wohngruppenverhalten
5.3.2 Sportliche und erlebnispädagogische Veranstaltungen
5.4 Sonstige Maßnahmen
5.5 Sozialpädagogische Aufgabengebiete
6. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einführung
1.1 Geschichtliche Entwicklung des Strafvollzugs
Der Vollzug der Freiheitsstrafe wandelte sich im Laufe der Jahrhunderte vom reinen Verwahrvollzug (Vergeltungs- und Rachegedanke) zum Behandlungs- bzw. Erziehungsvollzug, der in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts seinen Ursprung hatte.
In England richtete man 1555 auf Schloss Bridewell ein Arbeitshaus ein, in dem Diebe und Landstreicher an die Arbeit gewöhnt werden sollten, um sie somit in die Gesellschaft wieder eingliedern zu können.
Es folgten “Zuchthäuser“ in Holland und Deutschland ( u.a. 1609 in Bremen), sowie die Einrichtung eines separaten Zuchthauses für “missratene Kinder“ (1603). Die bisherigen Vollzugsformen mit reinem Vergeltungscharakter blieben darüber hinaus bestehen.
Während des 30-jährigen Krieges (1618-1648) gingen die ersten Ansätze des Resozialisierungsgedanken wieder verloren. Wieder von England ausgehend, fanden im 18. Jahrhundert Reformbewegungen statt, die noch vor der Jahrhundertwende dazu führten, dass man Kinder und Jugendliche während der Strafverbüßung als Erziehungsbedürftig behandelt.
Diese Reformideen fanden ihre Umsetzung in Deutschland in der Einführung ei- nes gesonderten Jugendstrafvollzugs. In Wittlich wurde 1912 das erste Jugendge- fängnis eröffnet und der Reichstag verabschiedete 1923 das erste Jugendgerichts- gesetz (RJGG).
Es flossen erzieherische Gesichtspunkte bei der Auswahl der Maßnahmen oder der Strafe mit ein. Das Jugendgerichtgesetz in der Fassung vom 04.08.1953 (JGG) beinhaltete die Strafaussetzung zur Bewährung, sowie die Bewährungshilfe. In §91 JGG wird der Jugendstrafvollzug ausdrücklich als Erziehungsvollzug defi- niert.
In §2 des Strafvollzuggesetzes (StVollzG) vom 16.03.1976 heißt es über die Auf- gaben des allgemeinen Strafvollzugs: “...im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel)“, aber weiterhin “der Vollzug der Freiheits- strafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten.“
Es wird hier im Ansatz bereits ein Interessengegensatz deutlich: Behandlung- bzw. Resozialisierung auf der einen, Sicherungsverwahrung auf der anderen Seite.
2. Erziehung als vieldimensionale Faktorenkomplexion
2.1 Begriffsbestimmung
Unter Erziehung versteht man unter anderem das Einwirken “auf die Entwicklung des Menschen zur Persönlichkeit“ (SCHRÖDER, 1985, S.83), im Hinblick auf Urteilsvermögen, Selbstkontrolle, soziale Verantwortung und kulturelle Produktivität, wie die tägliche Arbeit, Hobby, etc.
Die Erziehung sollte also die Persönlichkeitsentfaltung des zu-Erziehenden fördern und sich letztlich überflüssig machen.
Brokelmann bezeichnet die Erziehung als “dasjenige Handeln, in dem die Erzieher den zu-Erziehenden im Rahmen gewisser Lebensvorstellungen (Erziehungsnormen) und unter konkreten Umständen (Erziehungsbedingungen) sowie bestimmten Aufgaben (Erziehungsgehalten) und Maßnahmen (Erziehungsmethoden) in der Absicht einer Veränderung zur eigenen Lebensführung verhelfen, und zwar so, dass die jüngeren das erzieherische Handeln der Älteren als notwendigen Beistand für ihr eigenes Dasein erfahren, kritisch zu beurteilen und selbst fortzufahren lernen.“ (BOKELMANN, H., 1970, S.185 f).
2.1.1 Pädagogisches Feld im Jugendstrafvollzug
Der Begriff der “vieldimensionalen Faktorenkomplexion“ sagt etwas über die Erziehungswirklichkeit aus, bei der es sich um keine eindimensionale UrsacheFolge-Wirkung handelt, sondern um eine Vielzahl sich bedingender Faktoren, “die die pädagogische Situation bestimmen“.(ROTH, H., 1966, S.93). Diese Erziehungswirklichkeit lässt sich anhand eines pädagogischen Feldes am Beispiel eines jugendlichen Inhaftierten aufzeigen.
Abb. 1 : Pädagogisches Feld am Beispiel eines jugendlichen Inhaftierten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2 Ansprüche an die Erziehung
Sowohl die Gesellschaft, als auch das Individuum erheben Ansprüche an die Erziehung. Dem einzelnen soll sie in Form der Personalisation dazu verhelfen seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln und “beurteilend, unterscheidend, ablehnend, integrierend wie verändert der Vielfalt sozialer und kultureller Maßstäbe, Lebensformen und Anforderungen“ gegenüberzutreten.
(WURZBACHER, G., 1966, S. 75).
Dem gegenüber steht die Sozialisation, die einen sozialen Prägungs- und Eingliederungsprozess beschreibt, der als Lernprozess erfolgt und bewirkt, dass sich das Verhalten der jungen Generation innerhalb der jeweiligen gesellschaftlichen Ordnung den kulturspezifischen Erwartungen der Erwachsenen möglichst annähert. (HOFSTÄTTER, P., 1957, S. 266 f).
Abb. 2 : Ansprüche von Gesellschaft und Individuum an die Erziehung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Ausgewählte Erziehungsstile
Es gibt unterschiedliche Methoden, nach denen bestimmte Erziehungsvorstellungen umgesetzt werden sollen. E. Weber definiert Erziehungsstile als “relativ sinneinheitlich ausgeprägte Möglichkeiten erzieherischen Verhaltens, die sich durch typische komplexe von Erziehungspraktiken charakterisieren lassen.“
(WEBER, E., 1970, S. 33).
Die ersten fundierten Untersuchungen hinsichtlich der Auswirkungen von Erziehungsstilen auf das Verhalten von Kindern bzw. Jugendlichen führten Lewin/Lippitt/White (1939) durch.
Sie entwarfen drei Typenkonzepte des Erziehungsverhaltens, die nur eine Aus- wahl an Konzepten darstellen, auf die sich die folgenden Ausführungen beziehen. Sie ordneten den drei Konzepten konkrete, genau festgelegte Verhaltensmerkmale zu und ließen Erwachsene im Umgang mit Kindergruppen (bei einer gemeinsa- men Freizeitbeschäftigung) die verschiedenen Varianten des Erziehungs- bzw.
Führungsverhaltens verwirklichen.
3.1 Autoritärer Erziehungsstil
Verhaltensmerkmale des Gruppenleiters:
- strikte Anweisungen allein durch den Gruppenleiter
- Gruppenleiter teilt ein, wer mit wem zusammen arbeitet und verteilt auch die Arbeitsaufträge
- Er hält Distanz zur Gruppe, ist unpersönlich, Lob und Kritik zielen auf die einzelne Person ab
Auswirkungen des Erziehungsstils:
- Spannungen, Aggression und dominante Verhaltensweisen unter den Gruppenmitgliedern
- teilweise untertänigen Gehorsam gegenüber dem Gruppenleiter
- einige Gruppenmitglieder rebellieren und sind aggressiv
- gemeinsame Gruppenaktivitäten kommen kaum zustande
- Arbeitsintensivität nimmt bei Abwesenheit des Gruppenleiters stark ab
3.2 Laissez-fairer Erziehungsstil
Verhaltensmerkmale des Gruppenleiters:
- Entscheidung über Gruppenmaßnahmen ist den Gruppenmitgliedern freige- stellt
- Gruppenleiter hilft bei den Arbeitsvorgängen nur dann, wenn er darum gebe- ten wird
- Er nimmt keinen Einfluss auf die Verteilung der Arbeitsaufgaben und die Wahl der Arbeitskameraden
- Er verhält sich positiv gegenüber dem Gesamtablauf des Geschehens
Auswirkungen des Erziehungsstils:
- häufiger Wunsch nach gemeinsamen Aktionen, die wegen mangelnder Pla- nung und Koordination nicht zustande kommen
- hohe Unzufriedenheit bei den Gruppenmitgliedern · kein Verlass aufeinander und Ausnutzen der anderen
3.3 Demokratischer Erziehungsstil
Verhaltensmerkmale des Gruppenleiters:
- sämtliche Maßnahmen sind Gegenstand einer Gruppenentscheidung
- Gruppenleiter ist in seinem Verhalten bemüht, ein reguläres Gruppenmitglied zu sein
- Er äußert objektives Lob und objektive Kritik
- Er besitzt natürliche Autorität aufgrund von überlegenem Sach- und Fachwis- sen
Auswirkungen des Erziehungsstils:
- wenig Spannungen und selten dominantes Verhalten unter den Gruppenmitgliedern
- Gruppenmitglieder machen Vorschläge und fühlen sich in der Gemeinschaft wohl
- Gruppenmitglieder erkennen sich gegenseitig an und helfen den schwächeren · Das Verhältnis zum Gruppenleiter ist freier und eher auf der Basis von Gleich- heit
3.4 Kritische Anmerkung im Hinblick auf die praktische Umsetzung
Auch andere Autoren haben eine Einteilung in viele unterschiedliche Erziehungsstile vorgenommen, was deutlich werden lässt, wie subjektiv eine Einteilung ist und das eine Systematik der Erziehungsstile wohl noch aussteht.
In der Erziehungswirklichkeit sollte man sich weniger an dem Schema eines Er- ziehungsstils orientieren, als vielmehr alle Erziehungsstile unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation mit einfließen lassen.
Überblicke über die verschiedenen Einteilungsmöglichkeiten der einzelnen Stilarten bieten u.a. WEBER, E. (1970).
4. Erziehungsziele
Nach Brezinka beschreiben die Erziehungsziele eine Norm, die zum einen die Soll-Vorstellungen der Erzieher und der Gesellschaft hinsichtlich der Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensweisen der zu-Erziehenden bezeichnen und zum anderen benennen die Erziehungsziele auch Soll-Werte für das erzieherische Verhalten der Erzieher (Vorbildverpflichtung).
Durch Lernhilfen sollen Unzulänglichkeiten überwunden, bzw. Erwünschtes erreicht werden. (vgl. BREZINKA, W., 1990, S. 111 f)
Die folgenden Unterscheidungen (Richtziele/Grobziele/Feinziele) entstammen der Curriculumtheorie, deren Aufgabe es unter anderem ist, Lernziele detailliert zu beschreiben, zu klassifizieren und zu operationalisieren.
(KELLER,J.A./NOVAK,F., 1993, S.239 f.)
4.1 Zielvorstellungen im Jugendstrafvollzug
Das übergeordnete Ziel, das im Vollzug der Freiheitsstrafe angestrebt werden soll, ist das Vollzugsziel. Demnach sollen die Gefangenen im Strafvollzug “fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.“ ( Strafvollzugsgesetz, § 2)
Von dieser Formulierung lassen sich die drei folgenden Erziehungsziele ableiten.
4.1.1 Richtziele
Ein Richtziel im Strafvollzug ist unter anderem das im § 2, StVollzG dargestellte Vollzugsziel, die Resozialisierung. Darunter versteht man “alle Maßnahmen, wel- che eine (Wieder-) Eingliederung straffällig gewordener Jugendlicher oder Er- wachsener in die Gesellschaft anzielen.“
(KELLER, J.A./NOVAK, F. 1993, S.304).
Die Formulierung des Richtziels (Resozialisierung) weißt ein hohes Abstraktionsniveau auf, da sie kaum Hinweise für die praktische Umsetzung gibt. Um dieses Ziel zu erreichen sind eine Vielzahl von Grob- und Feinzielen notwendig.
4.1.2 Grobziele
Um erfolgreich auf ein Richtziel hinarbeiten zu können, sind viele Grobziele an- zustreben, deren Erreichen notwendig sind, um dem Richtziel gerecht zu werden. Mögliche Grobziele im Hinblick auf die Resozialisierung (Richtziel) könnten zum Beispiel sein:
- Berufsausbildung
- Soziale Trainingskurse
- Konfliktfreies Zusammenleben
- Übernahme allgemein anerkannter Wertvorstellungen
- Sinnvolle Freizeitbeschäftigung
- Verantwortungsbewusstsein
- Regelmäßige Arbeit
- Leben in Freiheit durch Kontakt zur Außenwelt (Lockerungen)
- Einhaltung von Richtlinien
- Selbstständigkeit
- Sauberkeit
Grobziele weisen sich durch ein mittleres Abstraktionsniveau aus und lassen für die Konkretisierung noch eine Reihe von Möglichkeiten. Des weiteren bildet eins der genannten Grobziele (z. B. Selbstständigkeit) die Vorlage für die Formulierung der folgenden Feinziele.
4.1.3 Feinziele
Sie haben einen hohen Präzisionsgrad, denn sie erlauben eine eindeutige Bestimmung des gewünschten Verhaltens des zu-Erziehenden, bzw. jugendlichen Strafgefangenen. Außerdem ist das Erreichen, bzw. Nichterreichen der Feinziele objektiv überprüfbar. Mögliche Feinziele im Hinblick auf das Erreichen eines Grobziels (z.B. Selbstständigkeit) können sein:
- Eigenständiges Aufstehen
- Den Schriftverkehr mit Behörden selbstständig erledigen
- Haftraum in Ordnung halten
- sich zu waschen
- eigenständige Übernahme von Tätigkeiten innerhalb der Wohngruppe
- seine Wäsche selbst sauber halten
Abb. 3 : Schematische Darstellung der Zielsetzung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.2 Problematik hinsichtlich der Zielsetzung
Oft kommt es bei dem Anstreben von bestimmten Erziehungszielen zu einem Zielkonflikt durch das “Doppelmandat“ im Strafvollzug.
Auf der einen Seite ist im Rahmen der Hilfestellung bezüglich der Resozialisierung/Behandlung Vertrauensbildung erforderlich, auf der anderen Seite wird im Rahmen der Kontrollen (Sicherheitsgedanke/Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten) Misstrauen “provoziert“.
Des weiteren kann es vorkommen, dass zwei oder mehrere bewusst gesetzte Er- ziehungsziele im Widerspruch zueinander stehen. So lassen sich z.B. Ziele, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft, nur schwer vereinbaren mit Zielvorstellungen, wie Durchsetzungsvermögen oder Wahrung eigener Interessen. Weitere Probleme, die Zielsetzungen mit sich bringen können:
- Die Ausrichtung der Erziehungszielen an unerreichbaren Idealen, die die Weiterentwicklung des Jugendlichen behindern können.
- Die Setzung von Zielen kann die Zukunftsoffenheit verbauen, in dem sie aus- schließlich traditionell orientiert und auf Anpassung ausgerichtet sind oder starr festgelegt werden.
(WEBER, E., 1999, S. 476)
5. Umsetzung in die Praxis (am Beispiel der JSA Schifferstadt)
5.1 Allgemeines zur Jugendstrafanstalt
Die Jugendstrafanstalt ist eine Justizvollzugsanstalt für den Vollzug von Jugend- strafe und Untersuchungshaft an männlichen Gefangenen im Alter von 14-21 Jah- ren.
Sie hat eine Belegungsfähigkeit von 200 Haftplätzen, die auf 4 Unterkunftshäuser verteilt sind.
Der Behandlung, bzw. Erziehung wird im heutigen Jugendstrafvollzug eine zent- rale Bedeutung beigemessen, da die Begehung von Straftaten häufig entwick- lungsbedingt ist. Deshalb stehen in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt Einrich- tungen, sowie professionelles Personal zur Verfügung, um festgestellte Defizite im persönlichen, familiären, sozialen, schulischen und beruflichen Bereich aufzu- arbeiten.
5.2 Einrichtungen für Schule und Beruf
5.2.1 Schulische Maßnahmen
Junge Straftäter, die keinen Hauptschulabschluss besitzen, können in den Berei- chen Holz, Metall und Bau an einem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) teilnehmen, dass durch hauptamtliche Lehrer der Berufsbildenden Schule Speyer durchgeführt wird.
Bei erfolgreichen Abschluss erhalten die Schüler ein dem Hauptschulabschluss gleichkommenden Zeugnis.
Gefangene, die den Hauptschulabschluss besitzen, können an einem Berufsgrund- schuljahr (BGJ) teilnehmen, dass die berufliche Grundbildung vermitteln soll und kann bei erfolgreichem Abschluss auf entsprechende Ausbildungsberufe ange- rechnet werden.
Zum Ausgleich von Defiziten im Schulischen Bereich, wird von anstaltseigenen Lehrern Förderunterricht angeboten.
5.2.2 Maßnahmen zur Berufsvorbereitung
In dreimonatigen Lehrgängen können die Gefangenen verschiedene Berufsfelder in den Bereichen Holz, Metall und Bau kennen lernen. Ziel dieser Maßnahme ist, die Gefangenen zu einer für sie geeigneten Berufswahl zu führen, sowie sie für einen Arbeitsprozess zu motivieren und über die Inhalte der einzelnen Berufsfel- der zu informieren.
5.2.3 Arbeitstherapeutische Maßnahmen
Durch diese Maßnahmen werden junge Gefangene berücksichtigt, denen es an Motivation, Konzentration und Durchhaltevermögen mangelt und somit den Arbeitsanforderungen nicht gerecht werden.
Sie sollen in kleinen Schritten an Arbeitsabläufe herangeführt werden, damit ihre Arbeitsfähigkeit hergestellt wird.
5.3 Freizeit
5.3.1 Wohngruppenverhalten
Die jungen Gefangenen sind in der Regel in Wohngruppen zu je 12-13 Haftplätzen untergebracht und werden dort von Psychologen, Sozialpädagogen und Beamten des mittleren Vollzugsdienstes betreut.
Sie sollen unter deren Anleitung im Umgang miteinander soziale Kompetenzen erwerben. Probleme und Konflikte, die sich aus dem Zusammenleben in einer Wohngruppe ergeben, sollen von den Mitgliedern ohne die Anwendung von Gewalt bewältigt werden.
5.3.2 Sportliche und erlebnispädagogische Veranstaltungen
Neben der Gestaltung der Freizeit auf der Wohngruppe, besteht die Möglichkeit für die Jugendlichen, die Sporthalle und den Sportplatz unter der Aufsicht eines geschulten Mitarbeiters zu nutzen.
Auch dort sollen aus freizeitpädagogischen Gesichtspunkten heraus aufgezeigt werden, wie man seine Freizeit auch nach der Inhaftierung sinnvoll nutzen kann. Im Bereich der Erlebnispädagogik besteht für Gefangene, die Vollzugslockerungen (Ausgang, Urlaub) haben, die Möglichkeit, an Gemeinschaftsveranstaltungen außerhalb der Mauer teilzunehmen.
Diese Maßnahmen sollen Verantwortungsbewusstsein vermitteln und das Selbstwertgefühl der Gefangenen steigern.
5.4 Sonstige Maßnahmen
Neben den bereits erwähnten Maßnahmen während der Freizeit, sowie im schulischen Bereich, besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an besonderen therapeutischen Behandlungsmaßnahmen, wie zum Beispiel:
- Drogentherapie
- Arbeitstherapie (s. Kap. 5.1.3)
- Soziale Trainingskurse mit unterschiedlichen Themengebieten, wie zum Bei- spiel: Schulden, Freizeit, Wohnen, etc.
- Anti-Gewalt-Training
5.5 Sozialpädagogische Aufgabengebiete
Die aufgeführten Maßnahmen erweisen sich gerade im Jugendstrafvollzug als sinnvoll und notwendig, da durch sie eine Anpassung an die Wert -und Normvor- stellungen innerhalb einer Gesellschaft erreicht werden soll und kann. Daraus ergeben sich für alle Mitarbeiter im Strafvollzug eine Fülle von Tätigkei- ten und Aufgabengebiete nicht nur im schulischen und psychologischen, sondern auch im sozialpädagogischen Bereich, die alle die Integration des jugendlichen zum Ziel haben.
Abb. 4 : Aufgaben sozialpädagogischer Arbeit (nach Hobmair, u. a., 1995, S. 317)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6. Schlussbetrachtung
Der Jugendstrafvollzug stellt als “letzte Instanz“ der zur Verfügung stehenden Erziehungsmittel für einen jungen Straftäter eine Möglichkeit dar, durch geschultes Personal und geeignete Einrichtungen, “künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.“ (StVollzG, § 2).
Ein großes Problem, hinsichtlich der Umsetzung dieses Ziels (Vollzugsziel), zeigt sich in Untersuchungen in den siebziger Jahren, die zu dem Ergebnis kamen, dass die Folgen der Haft die Voraussetzungen für eine soziale Existenz des Gefangenen “draußen“ eher verschlechtern.
(vgl.KERSTEN/v. WOLFFERSDORF, 1980, S. 280 f.).
Dies kann zum Beispiel auf jugendliche zutreffen, die zum ersten Mal in Kontakt mit dem Strafvollzug geraten und zunehmend im Verlauf ihrer Freiheitsstrafe von Hafterfahrenen Gefangenen negativ beeinflusst werden.
Zudem kann sich ein kaum mehr zu beseitigender Teufelskreis aus abweichenden Verhalten (Kriminalität) und sozialer Ächtung bilden, da der Vollzug der Freiheitsstrafe zu einer “Stigmatisierung“ führt.
Im reformierten Strafvollzug wird aber durch die erzieherischen Maßnahmen ver- sucht, solchen Prozessen entgegenzutreten, den Integrationsgedanken in den Vor- dergrund zu stellen und somit den negativen Einflüssen des Strafvollzugs entge- genzuwirken.
Bei aller Liberalisierung des Strafvollzugs sollt man dennoch bedenken, dass er sich aus einer vehementen Rechtsgutverletzung anderer Bürger heraus ergibt und als letztes Erziehungsmittel gewählt wurde, da andere bereits verhängte Strafen keinen Erfolg zeigten.
Es erweißt sich aber für wichtig, dass Strafe und Erziehung in einen, für die Ge- sellschaft akzeptablen und den jugendlichen Gefangenen förderlichen, Zusam- menhang zu bringen, um das Auftreten abweichenden Verhaltens in Zukunft zu verhindern.
Literaturverzeichnis
BREZINKA, W.: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft: Analyse, Kritik, Vorschläge. München 1990
BOKELMANN, H.: Pädagogik: Erziehung und Erziehungswissenschaft. In: SPECK, J. und WEHLE, G. (Hrsg.): Handbuch pädagogischer Grundbegriffe, Bd. 2. München 1970
HOBMAIR, H. (Hrsg.): Pädagogik. Köln 1995
HOFSTÄTTER, P.: Psychologie. Frankfurt a. Main 1957
JUGENDGERICHTSGESETZ (JGG), i. d. Fassung v. 11. 12. 1974
KELLER, J. A./NOVAK, F.: Kleines Pädagogisches Wörterbuch: Grundbegriffe
- Praxisorientierungen - Reformideen. Freiburg im Breisgau 1993
KERSTEN, J./v. WOLFFERSDORF-EHLERT, C.: Jugendstrafe: Innenansichten aus dem Knast. Frankfurt a. Main 1980
ROTH, H.: Pädagogische Anthropologie Bd. 1: Bildsamkeit und Bestimmung. Hannover 1966
SCHRÖDER, H.: Grundwortschatz Erziehungswissenschaft: Ein Wörterbuch der Fachbegriffe. München 1985
STRAFVOLLZUGSGESETZ (StVollzG), i. d. Fassung v. 16.03.1976 TRÖGER, W.: Erziehungsziele. München 1974
WEBER, E.: Erziehungsstile. Donauwörth 1976
WEBER, E.: Grundfragen und Grundbegriffe Bd. 1/Teil 3. Donauwörth 1999
WURZBACHER, G.: Beiträge zu Begriff...In: Sharmann, Th. (Hrsg.): Schule und Beruf als Sozialisationsfaktor. Stuttgart 1966
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 (S. 4): Pädagogisches Feld am Beispiel eines jugendlichen Inhaftierten
Abb. 2 (S. 5): Ansprüche von Gesellschaft und Individuum an die Erziehung
Abb. 3 (S. 10): Schematische Darstellung der Zielsetzung
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein umfassender Überblick über ein Thema im Bereich der Pädagogik und des Strafvollzugs, insbesondere des Jugendstrafvollzugs. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, Einführungen in die Thematik, Definitionen wichtiger Begriffe, eine Diskussion verschiedener Erziehungsstile und -ziele, eine praktische Umsetzung am Beispiel der JSA Schifferstadt, eine Schlussbetrachtung, ein Literaturverzeichnis und ein Abbildungsverzeichnis.
Was behandelt die Einführung?
Die Einführung gibt einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Strafvollzugs, von den Anfängen als reine Verwahrung bis hin zu den modernen Ansätzen des Behandlungs- und Erziehungsvollzugs. Sie beleuchtet Reformbewegungen und die Einführung des Jugendgerichtsgesetzes in Deutschland.
Was wird unter "Erziehung als vieldimensionale Faktorenkomplexion" verstanden?
Dieser Abschnitt definiert Erziehung als einen vielschichtigen Prozess, der die Entwicklung des Menschen zur Persönlichkeit fördert. Es wird auf das pädagogische Feld im Jugendstrafvollzug eingegangen und die Ansprüche an die Erziehung von Seiten der Gesellschaft und des Individuums diskutiert. Das pädagogische Feld ist kein eindimensionales Ursache-Wirkungs-Prinzip, sondern umfasst eine Vielzahl von Faktoren.
Welche Erziehungsstile werden behandelt?
Das Dokument behandelt drei ausgewählte Erziehungsstile: den autoritären, den Laissez-faire- und den demokratischen Erziehungsstil. Für jeden Stil werden die Verhaltensmerkmale des Gruppenleiters und die Auswirkungen des Erziehungsstils beschrieben. Es wird auch eine kritische Anmerkung im Hinblick auf die praktische Umsetzung gegeben.
Welche Erziehungsziele werden im Jugendstrafvollzug verfolgt?
Es werden Zielvorstellungen im Jugendstrafvollzug beschrieben, unterteilt in Richtziele (Resozialisierung), Grobziele (z.B. Berufsausbildung, soziale Trainingskurse) und Feinziele (z.B. selbstständiges Aufstehen, Erledigen von Schriftverkehr mit Behörden). Die Problematik hinsichtlich der Zielsetzung, insbesondere der Zielkonflikt durch das "Doppelmandat" (Hilfe zur Resozialisierung vs. Schutz der Allgemeinheit), wird erörtert.
Was ist die JSA Schifferstadt und wie wird dort Erziehung in die Praxis umgesetzt?
Die JSA Schifferstadt ist eine Jugendstrafanstalt für männliche Gefangene im Alter von 14-21 Jahren. Der Text beschreibt die Einrichtungen für Schule und Beruf (schulische Maßnahmen, Maßnahmen zur Berufsvorbereitung, arbeitstherapeutische Maßnahmen), die Freizeitgestaltung (Wohngruppenverhalten, sportliche und erlebnispädagogische Veranstaltungen), sonstige Maßnahmen (Drogentherapie, soziale Trainingskurse) und die sozialpädagogischen Aufgabengebiete. Die JSA Schifferstadt dient als Fallbeispiel für die Umsetzung der Erziehung in die Praxis.
Was ist das Fazit der Schlussbetrachtung?
Die Schlussbetrachtung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jugendstrafvollzug trotz seiner Bemühungen um Resozialisierung auch negative Auswirkungen haben kann (z.B. Stigmatisierung). Es wird die Notwendigkeit betont, Strafe und Erziehung in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen, um abweichendem Verhalten vorzubeugen. Eine zu grosse Liberalisierung des Strafvollzugs könnte die Rechtsgutverletzung anderer Bürger verharmlosen.
Welche Bereiche werden behandelt?
Der Bereich des Jugendstrafvollzugs wird hier umfassend behandelt. Es wird Bezug genommen auf schulische Massnahmen, aber auch Themengebiete wie Therapie und die Rolle der Sozialpädagogen.
- Quote paper
- Christian Schramm (Author), 2001, Pädagogik im Jugendstrafvollzug, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103803