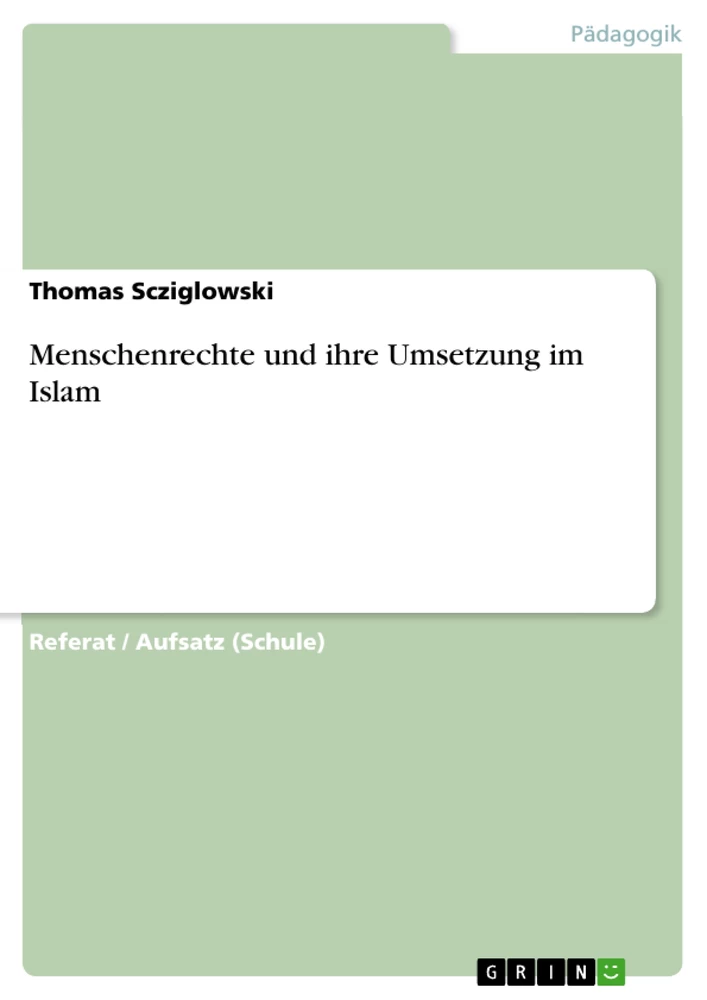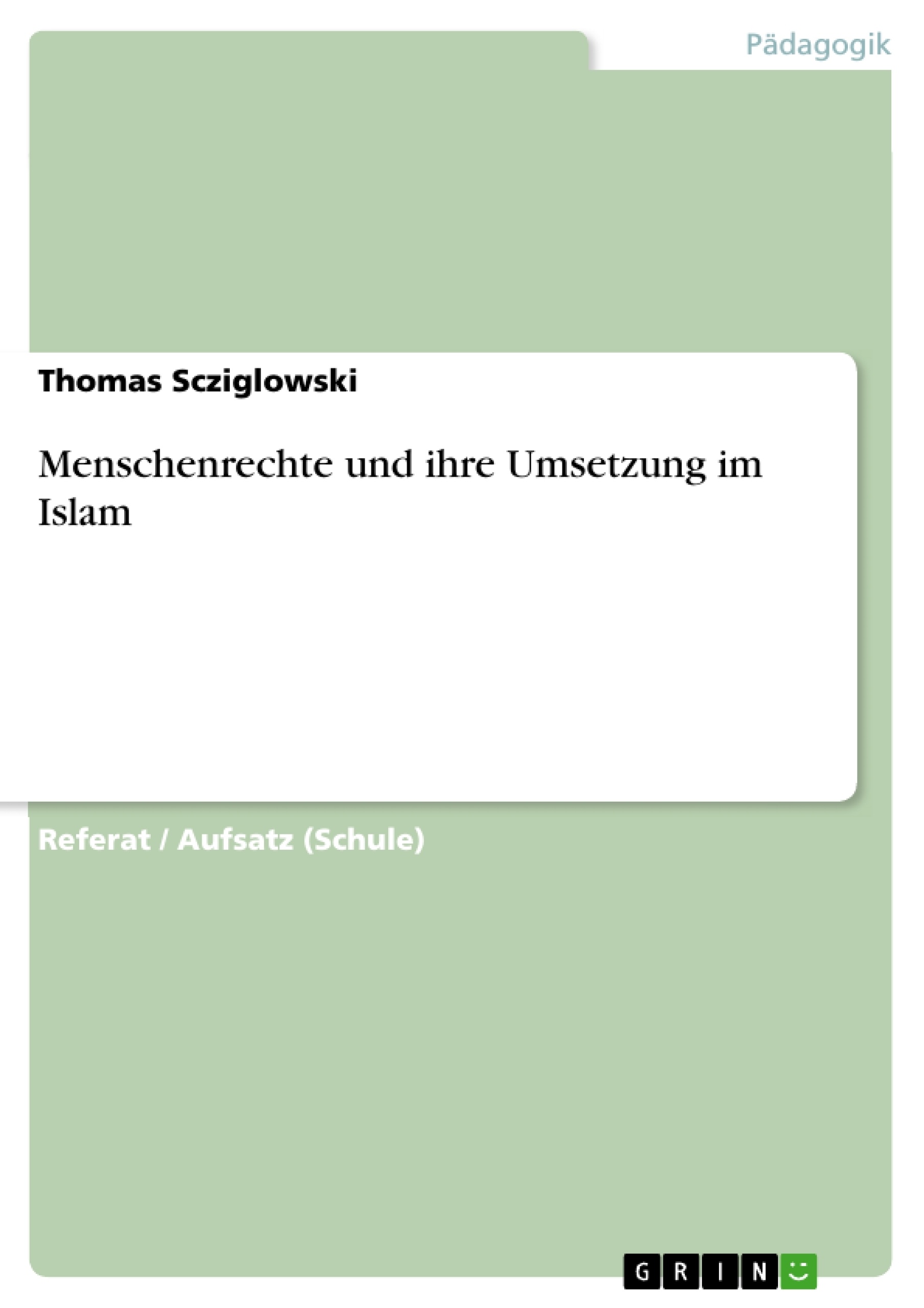In einer Welt, in der kulturelle Unterschiede oft als unüberbrückbare Gräben erscheinen, wagt sich dieses Buch auf ein Terrain, das von Missverständnissen und Vorurteilen geprägt ist: die Schnittstelle von Menschenrechten und Islam. Es ist eine Reise durch die Geschichte der Menschenrechte, von ihren ersten schriftlichen Fixierungen bis zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO, die jedoch lange Zeit die Perspektiven der "Dritten Welt" vernachlässigte. Die Frage, für wen diese Rechte eigentlich gelten, führt zu einer Auseinandersetzung mit der Rolle des Islam, seiner Ursprünge und seiner Prinzipien. Entgegen der oft vereinfachenden Darstellung in den Medien, wird der Islam hier nicht als monolithischer Block betrachtet, sondern in seiner Vielfalt und seinen historischen Wandlungen beleuchtet. Von den Einflüssen des Judentums und Christentums bis hin zu den mystischen Strömungen des Sufismus, offenbart sich ein komplexes Bild einer Religion, die sowohl Quelle von Konflikten als auch von tiefem spirituellem Verständnis sein kann. Das Buch scheut sich nicht, die Konflikte in islamischen Staaten anzusprechen, insbesondere die Religionsfreiheit und die Rechtsstellung der Frau, und analysiert kritisch den Einfluss der Sharia. Doch es zeigt auch Lösungsansätze auf, indem es die Bemühungen von Muslimen hervorhebt, die zwischen den Menschenrechten und den Geltungsansprüchen der Sharia vermitteln wollen. Es ist ein Plädoyer für eine differenzierte Betrachtung, die nicht die Religion selbst, sondern die Traditionen der Religionsausübung und den Einfluss von Fundamentalisten als Kern des Problems identifiziert. Eine Einladung, über den Tellerrand hinauszublicken und zu erkennen, dass Mystik, Sinnlichkeit und Lebensbejahung auch im Islam existieren, oft abseits der ausgetretenen Pfade alteingesessener Gläubigkeit. Ein unverzichtbarer Beitrag zur Debatte um Menschenrechte, kulturelle Vielfalt und die Suche nach einem friedlichen Zusammenleben. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Tradition auf Moderne trifft und der Dialog der Kulturen zur Notwendigkeit wird, um die universellen Werte der Menschenrechte zu bewahren und zu fördern. Dieses Buch ist eine notwendige Lektüre für alle, die sich für Menschenrechte, Islam, interkulturellen Dialog und die Herausforderungen einer globalisierten Welt interessieren. Es bietet fundierte Analysen, Denkanstöße und einen differenzierten Blick auf ein komplexes Thema, das uns alle betrifft.
Menschenrechte und ihre Umsetzung im Islam
Zur Geschichte der Menschenrechte
In schriftlicher Form wurden die Menschenrechte erst am Ende des 18-ten Jahrhundert niedergeschrieben. Genau genommen 1776, in der "Virginia Bill of Rights". Frankreich, 13 Jahre später, demnach also im Jahre 1789 kam dann die erste europäische Festlegung, „Déclaration des droits de l’ homme et du citoyen“, zu Papier. Da waren sie nun, die ersten Menschenrechtserklärungen, eine Auflistung allgemeiner und gleicher Freiheitsrechte mit politischer Verbindlichkeit.
Es waren die MEINUNGSFREIHEIT, RELIGIONSFREIHEIT, pol. MITBESTIMMUNG, Schutz vor WILLKÜRLICHER VERHAFTUNG, die niedergeschrieben wurden.
Dies bedeutet, dass die Menschenrechte nicht selbstverständlich in unserer westlichen Kultur waren.
Wie mit jeder Neuerung gab es natürlich auch Widerstand. Zum Beispiel kam dieser von der Kirche, zumindest was die Religionsfreiheit anbelangte.
Im Mittelalter war die römische Kirche nicht nur der Träger des Wissens und der Kultur schlechthin. Der Großteil der weltlichen Macht ging von ihr, bzw. den Klöstern aus. Mit der Anerkennung anderer Religionen würde die Vormachtstellung in ihrem Herrschaftsbereich Europa eingeschränkt. Die Durchsetzung der Menschenrechte kann demnach einem revolutionären Akt gleichgesetzt werden.
1948 wurden dann die Menschenrechtserklärungen der Vereinten Nationen verfasst. Diese Erklärung war dann der Einstieg in die internationale Verrechtlichung des Menschenrechtsstandards.
Klingt auf jeden Fall erst mal gut. Nur muss berücksichtigt werden, dass zu dieser Zeit noch der größte Teil der „dritten Welt“ unter kolonialer Bevormundung der westlichen Welt stand. Sie wurden, bei der Erklärung nicht berücksichtigt. Als ob diese für die „dritte Welt“ nicht gelten sollten.
Dieser Widerspruch hat sich, wenn nicht ganz, aber doch zum größten Teil gelegt, denn heute sind diese ehemaligen Kolonialstaaten mit in den Vereinten Nationen vertreten.
Welches sind die Menschenrechte der vereinten Nationen von heute überhaupt?
Allgemeine ErklÄrung der Menschenrechte der UNO
(der Länge wegen habe ich die Liste der allgemeinen Menschenrechte rausgelassen, könnten aber auf der Homepage der vereinten Nationen nachgelesen werden)
(Zusammenfassung der Präambel vom 10.12.1948)
- Hier geht es um die Anerkennung der, in jedem Menschen innewohnenden, Würde. Der gleichen und unveräußerlichen Rechte als Grundlage der Freiheit, Gerechtigkeit und des Friedens auf der Welt.
- Die Möglichkeit der Barbarei, welche durch die Missachtung der Menschenrechte entstehen kann, bzw. entsteht, soll vermieden werden.
- Schutz der Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechts, zur Vermeidung des letzten Mittels gegen Tyrannei und Unterdrückung.
- Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den verschiedenen Nationen.
- Verpflichtung der Mitgliedsstaaten zur Mitarbeit.
Für wen gelten die Menschenrechte?
Die von britischem Rechtsanwalt Peter Benenson am 28. Mai 1961, ins Leben gerufene Organisation „Amnesty International“, ist sich intern auch nicht darüber einig, in wie weit die Menschenrechte als Maßstab für alle Kulturen gelten. Bei der Urteilsfällung über Menschenrechtsverletzungen, führt dies sehr leicht zu einer Verurteilung anderer Kulturen.
Eben, weil diese Menschenrechte zum größten Teil nur von der westlichen Kultur geprägt wurden.
Das westliche Menschenrechtsverständnis darf nicht zum Paradigma der Menschenrechte überhaupt werden. Vielmehr müssen die Schwierigkeiten und Widerstände bei der Durchsetzung der doch recht jungen Menschenrechte in unserer eigenen abendländlichen Gesellschaft wieder ins Gedächtnis gerufen werden. Damit ist eine Sensibilisierung für die Missverständnisse und Ängste in anderen Kulturen möglich.
Ein Zusammenleben aller Nationen und Kulturen dieser Erde kann nur gewährleistet werden, wenn die liberalen, politischen, sozialen und kulturellen Menschenrechte anerkannt werden, da ein Rückzug aus der modernen Zivilisation nicht mehr möglich ist.. Es ist wohl die einzige Chance für ein menschenwürdiges Zusammenleben auf dieser Erde.
Natürlich sind sie auch Veränderungen unterworfen, da zum einen auch „dritte Welt-Staaten" in die Vereinten Nationen aufgenommen wurden und werden. Diese damit ihre eigenen Unrechtserfahrungen mit in die lange Liste der MR einbringen können und auch müssen.
Im Zeitalter der Vertechnisierung muss auch die Entwicklung besonders der Informationsmedien berücksichtigt werden. Zum Beispiel um die Manipulierung der Menschen zu vermeiden.
Besonders die Medien in der Funk- und Fernsehwelt oder die, in den letzten Jahren hinzugekommene, Möglichkeit der Internetnutzung, bietet hier sehr große Möglichkeiten.
Der Islam als Beispiel für und wider Menschenrechte Ursprung, Grundsätze des Islam Als Begründer dieser Religion wird, der im 6. nachchristlichen Jahrhundertgelebt habende, Muhammad angesehen.
Er richtete sich vorwiegend an ein nomadisches, viele Götter verehrendes Volk.
Mit dieser neuen Religion schaffte er lokale Götter ab und setzte an deren Stelle eine absolut geistige Gottheit.
Dieser Gott, „Allah“, ist ein reines Geistwesen, der lediglich nur durch den Stein der Kaaba in Mekka symbolisiert wird.
In dieser Religion sind Elemente der jüdischen, der neutestamentarisch-christlichen Lehre sowie der zoroastrischen Tradition vorhanden, besser gesagt setzt sie sich daraus zusammen. Zum Beispiel:
- Die Vorstellung eines streng patriarchalischen Schöpfergottes als Richter über die Menschen aus dem Judentum.
- Die Ethik der Nächstenliebe aus dem Christentum.
- Von beiden, vorgenannten Religionsrichtungen, den strickten Monotheismus.
- Im Gegensatz zum Christentum gibt es keinen Sohn Gottes, da Allah nie menschliche Gestalt annimmt. Im Judentum wird noch heute auf den Messias gewartet. Muhammad ist demnach kein göttliches Wesen.
Das Wort Gottes soll Muhammad vom Erzengel Gabriel empfangen haben.
Wie im Juden- und Christentum gibt es auch hier ein heiliges Buch: „Der Koran“. Dieser setzt sich aus mehreren Teilen zusammen:
- Rational dargestellte Feststellungen über sittliche Gesetze - Gleichnisse einer geheimen, unaussprechlichen Lehre Neben den geoffenbarten Text:
Sunna:
- Das Leben Muhammads als Vorbild für richtiges Verhalten im Alltag eines Muslim. (das Nichtgöttliche)
Hadith:
- Die überlieferten Aussprüche des Propheten. Sharia:
- Enthält ethische Regeln (keine Gesetze(Rechtsregeln) im eigentlichen Sinne)
- Stammt aus den ersten 2 bis 3 Jahrhunderten des Islam.
Über Allah selbst steht nur sehr wenig im Koran, er gilt als das unaussprechliche über das zuschweigen ist. Ähnlich wie in der Bibel: „Du sollst dir kein Bildnis von mir machen!“.
Kurz gesagt gilt der Koran als Dokument, voller Aufzählungen, Anweisungen über das richtige soziale, sittliche Verhalten des wahren Gläubigen.
Während das Christentum auf das Böse blickt, vor dem sich zu schützen ist. Blickt der Islam allein auf die Liebe zu Gott. Es herrscht kein Dualismus zwischen den Welten des Geistes und des Fleisches. Die materielle Welt wird eher als Saatfeld für das Jenseits angesehen.
Das eigene Ego soll dabei nicht ausgelöscht werden, da es ja nicht wesenhaft, sondern nur Einbildung ist. Im Christentum werden hingegen diese Welten getrennt. Mönche oder Nonnen leben zum Beispiel im Zölibat.
Satan, im Islam Iblis, ist ein Engel der sich weigerte Adam zu dienen, da er Gott so sehr liebte.
In der Bibel war der (Erz-)Engel Luzifer, er aus dem „Himmel“ verstoßen wurde.
Es erfolgt keine Bekämpfung des Bösen, da es verdrängt wird, wenn man seine Seele in Allah auflöst. Bedeutet so viel wie, Liebe Gott so sehr und das Böse hat keine Chance.
Das wirklich Böse Prinzip ist die Verweigerung Gott anzubeten.
Durch die geschickte Verbindung von Politik und Religion ist es dem Propheten gelungen ein, in viele Stämme geteiltes, umherwanderndes Volk zu einen.
Sozusagen kann Muhammad als Begründer des ersten theokratischen Staats angesehen werden.
Später spaltete sich der Islam in zwei Hauptrichtungen.
1. Sunna:
Die Verhaltensweisen des Propheten wurden als normative Werte gesehen. Was diese Richtung zu einer streng orthodoxen Tradition macht.
2. Shia:
Diese Richtung brachte den Sufismus hervor, dieser war in Persien verbreitet. Durch die Aufnahme von neuplatonischen, hellenistischen, buddhistischen, christlich-gnostischen Lehren entstand hier eine „All-Einheitsmystik“, die zu einer einzigen geistigen Essenz verschmolz.
Sufi stammt aus dem Arabischen und bedeutet wörtlich „Wolle“, die ausübenden tragen schlichte Wollgewänder. Eine tiefere Interpretation des Wortes besagt, die Ausübenden seien mit Gott verwoben. In Persien und der Türkei werden Sufis Derwische genannt. Bedeutet soviel wie Bettler, was auch aus dem arabischen stammt ist das Wort Faqur (als Ableitung ist Fakir bekannt), steht für Armut.
Zentrales Thema ist immer wieder die alles verzehrende Liebe zum Schöpfergott Allah, die gesamte Schöpfung mit einbezogen, alle Menschen, Tiere, Pflanzen. Der Gedanke der Wiedergeburt taucht hier wiederholt bei islamischen Mystikern auf. Die menschliche Einzelseele, deren Existenz ja Voraussetzung für den Vorgang der Reinkarnation ist, wird allerdings der allumfassenden Subjektivität Allahs untergeordnet.
Islam heute
So wie die Verwirklichung der Menschenrechte in der westlichen Kultur nicht ohne Probleme durchgesetzt wurden, kann auch in anderen Kulturen von auftretenden Problemen ausgegangen werden.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Rechtsempfinden durch Regeln aus den ersten 2-3 Jahrhunderten dieser Religion, also dem 8-9Jahrhundert nach Christus, bestimmt ist. Obendrein muss noch berücksichtigt werden, dass es sich nicht um Gesetze handelt, sondern um ethische Regeln. Deren Auslegung sich im Laufe der Zeit geändert haben.
Besondere Konflikte in Islamischen Staaten sind heute:
1. Die religionsrechtlichen Regelungen(Religionsfreiheit) in einem islamischen Staat.
Es existiert keine praktische Gleichstellung anderer Religionen. Dies betrifft, wenn auch nicht ganz so stark, die monotheistischen Buchreligionen. Den Polytheisten wird, theoretisch, das Existenzrecht aberkannt. Obwohl nach der Verfassung des Staates sie eigentlich Gleichberechtigt sein sollten. Obwohl auch andere Seiten existent sind. Es gibt geschichtliche Beispiele den islamischen Großmut gegenüber christlichen Minderheiten zu belegen, in dem sie diesen Schutz vor Verfolgern gewährten. Schon seit Jahrhunderten und auch noch bis heute leben Hindus und Muslime in Südasien zusammen. Nichtmuslime nehmen eine diskriminierende Sonderrolle ein und werden im Zivilrecht und im öffentlichen Leben benachteiligt. Im Personenrecht ist auch heute noch die Sharia dominierend. Die Rechtsfähigkeit wird Angehörigen anderer Religionen im Iran aberkannt. Besonders hart wird ein Abfall vom Islam geahndet, obwohl offiziell nicht vorgesehen, ist im Sudan und Iran in den letzten Jahren die Todesstrafe vollstreckt worden. Die Menschen deren Ehen zwangsgeschieden werden, das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen wird und die vom Erbrecht ausgeschlossen werden, „kommen wenigstens mit dem Leben davon“.
Recht bekannt geworden ist Khomeinis Todesurteil über Salman Rushdie.
In manchen Ländern können Gläubige andere Religionen keine legale Ehe schließen. Damit möchte ich dann auch zum Zweiten Punkt kommen.
2. Die Rechtsstellung der Frau
Als Frau genießt man nicht unbedingt eine gleichgestellte Position im Muslimstaat.
Interreligiöse Ehen sind ohnehin nicht möglich, außer ein muslimischer Man heiratet eine anders religiöse Frau.
Aus Sicht der Menschenrechte ist dies sicher das Hauptproblem, weil die „Regeln“ dem Koran entnommen und damit am Mittelalter angelehnt sind. Die Menschen haben sich weiterentwickelt, die Heiligen Schriften nicht, sie blieben unverändert.
Allerdings stellt sich ein Widerspruch zum Koran ein. Denn nach der Sharia ist die Frau als Rechtsperson anzusehen. Dennoch gilt der Mann als Familienoberhaupt, was zu einer Unterordnung der Frau führt.
Frauen sind in der Muslime Welt durch das ausgeübte Scheidungsrecht benachteiligt, im Gegensatz ist die einseitige Verstoßung der Frau schon im Koran missbilligt worden.
In einigen Staaten ist die Gleichberechtigung zwar verfassungsmäßig verankert, wird aber nur allmählich umgesetzt und dies auch nur unter Rückschlägen in anderen Rechtsbereichen Im Iran gilt eine staatliche Kleidervorschrift (Tschador), Verstöße werden mit Inhaftierung und/oder sogar Auspeitschung bestraft.
In Saudi-Arabien werden die Frauen ganz aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen.
Diese Entwicklungen sind dem Wirken von Fundamentalisten zu zuschreiben. Die als Fanatiker bekanntlich in jeder Religion zu Prüderie neigen. Scheinbar kennen die ihre eigenen „Meister“ nicht. Dschunaid, ein Sufi-Lehrer empfahl, wohl gemerkt nur empfohlen, sexuelle Enthaltsamkeit nur während der Lehrjahre als Übung zur Schärfung der Sinne. Danach sollte ein Derwisch heiraten, „denn eine Frau erfordert ein hohes Maß an schonender Rücksichtnahme, edler Weisheit, Güte, Freigiebigkeit, freundlicher Art und freundlichen Worten“.
In der arabischen Welt hat sich nie eine Tradition der Trennung von Sexualität und Religiosität durchsetzen können. (Siehe „Tausend und eine Nacht“) Ähnlich wie im Tantrismus wird auch im Sufismus empfohlen die sexuellen Energien nicht zu vergeuden, sonder sie zu nutzen um höhere Bewusstseinebenen zu erreichen. Wobei sexuelle Energie nicht mit Geschlechtsverkehr gleichzusetzen ist. Der Bauchtanz zielt darauf ab sexuelle Erregungen hervorzurufen, ohne das es dabei zum Geschlechtsverkehr kommt.
3. Sharia
Da, wenn auch nicht offiziell als Staatsgesetz, die Sharia großen Einfluss auf die Rechtsprechung in der arabischen Welt hat, möchte ich, nicht ausführlich, aber doch wenigstens kurz auf diesen Teil des Korans eingehen.
Aufgrund ihres Alters sind die Strafformen recht mittelalterlich, es sind nicht als Hauptbestandteil, aber eben doch grausame Körperstrafen darin enthalten.
Zum Beispiel das Handabschlagen bei Diebstahl, Auspeitschungen bei Alkoholgenuss, Steinigung von Ehebrechern. Diese sind in der Vergangenheit nur selten angewendet worden. Sie sind in den meisten Ländern nicht mehr in Gebrauch. Doch gibt es Ausnahmen, z.B. wurde die Amputationsstrafe in den Ländern Sudan, Jemen, Saudi-Arabien, Iran, Pakistan mit dem Fundamentalismus wieder eingeführt. Steinigungen sind in letzter Zeit „nur“ in Saudi-Arabien und Iran bekannt geworden. Die Prügelstrafe ist noch über die genannten Staaten hinaus verbreitet.
In den Staaten Arabiens sind immer wieder Berichte von nicht fair geführten Gerichtsverhandlungen und Folterungen in der Haft zu hören, diese haben allerdings keinen religiösen Bezug, vielmehr sind diese auf einen „inneren Notstand“ zurück zuführen.
Konfliktlösung
Es gibt Muslime, die versuchen zwischen den Menschenrechten und den Geltungsansprüchen der Sharia zu vermitteln.
Allerdings „verdrehen“ Fundamentalisten ganz gern die Menschenrechte. Die Verschleierung der Frau als Schutz der weiblichen Keuschheit oder mit dem staatl. Schutz vor der Versuchung des Glaubenswechsels. Letzteres ist als eine Negation der Religionsfreiheit zu werten.
Internationale islamische Organisationen legen islamische Menschenrechte vor, die allerdings schon in den eigenen Reihen nicht die gesamte Zustimmung finden. Obendrein sind diese nicht eindeutig, dies bedeutet sie in liberalen, konservativen oder gar in fundamentalistischen Sichtweisen interpretieren zu können.
Abgesehen von den Fundamentalisten setzt sich im Islam eine Entwicklung durch, die ähnlich dem der christlichen Theologie ist. Gemeint ist eine neue Gewichtung der Koranauslegung auf dem Bewusstseinsstand des modernen Menschen.
Im Koran steht in Sure2,256: „Es gibt keinen Zwang in der Religion.“, Dies ist auch in der neuen islamischen Menschenrechtserklärung zitiert..
Dies zeigt die Bereitschaft der, leider nur, einiger, reformierten Muslime die Sharia zu überarbeiten, sie vom mittelalterlichen denken zu befreien.
Dadurch erhoffen sie sich eine Wiedergewinnung der ursprünglichen Sharia, die der eigentlichen Bedeutung des Wortes(Wegweiser) näher kommt. Schließlich sollte sie lediglich nur zur Orientierung dienen. Zur Orientierung für einen Lebensweg in Freiheit den der Gläubige selbst finden und beschreiten muss.
Nach der Aussage Muhammad Salim Abdullahs betont der Koran in seinen Grundaussagen die Würde der Menschen, Mann genau wie die der Frau. Ebenso gilt auch ein prinzipielles Verbot des Zwangs in Glaubensfragen.
Eine gewisse pragmatisch Annäherung hat sich in Fragen der Sklaverei und der Polygamie schon ergeben,
Eine pragmatische Annäherung deshalb, weil diese Punkte nie geändert wurden, sie werden lediglich nicht mehr erwähnt und übergangen.
Die Polygamie erlaubt der Koran nur, wenn alle Frauen absolut gleich gehandelt werden. Durch diese Einschränkung des Koran ist dies fast nicht möglich, sozusagen ein indirektes Verbot. Richtig verboten ist es nur in Tunesien.
Auch sind die allgemeinen Menschenrechtserklärungen des Islamrates für Europa, bezogen auf Themen wie Ehefrau, Familie, Ehe in Singular verfasst.
Demnach ist die Einehe auch hier ein gängiges Modell.
Sollte sich das Rechtsempfinden der Muslime, geführt von den „modernen“ Muslimen, weiter in die eingeschlagene Richtung entwickeln, wird sich eine Anpassung an das geltende Menschenrechtsempfinden des Abendlandes von ganz allein einstellen. Das Problem der Menschenrechtsverletzungen stellt nicht der Koran, sondern vielmehr die Traditionen der Religionsausübung bis hin zu den immer stärker werdenden Fundamentalisten. Die in ihrer Rolle als Fanatiker, genau das Gegenteil bewirken.
Indem sie sogar ihre traditionellen Überlieferungen wie „Tausend und eine Nacht“ verteufeln. In meiner Arbeit möchte ich kein Urteil fällen.
Vielmehr versuchte ich zu zeigen, dass das Problem der Menschenrechtsverletzungen nicht an der Religion, sondern an der Tradition der Ausübung im Alltag liegt
Ähnlich wie im Christentum finden wir auch bei den Moslems Mystik, Sinnlichkeit, Lebensbejahung und Respekt vor Frauen eher abseits der ausgetretenen Pfade alteingesessener Gläubigkeit. Genug Beispiele von Körperübungen und Gesängen die auffordern Erotik und Gefühle auszuleben und Gott auf dem Grund der eigenen Seele aufzuspüren.
Quellen:
Mai-Ausgabe 03/2001 Connection: „Allahs sinnenfrohe Tänzer - mystische Wege und Rituale der Sufis““ von Georges Shanteem
Ingrid Holzhausen: „Weisheit der Völker - Lesebuch aus drei Jahrtausenden“
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Menschenrechte und ihre Umsetzung im Islam"?
Der Text behandelt die Geschichte der Menschenrechte, beginnend mit den ersten schriftlichen Fixierungen im 18. Jahrhundert, über die Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen 1948, bis hin zur Frage ihrer universellen Gültigkeit und Umsetzung, insbesondere im Kontext des Islam.
Wie entstand die Idee der Menschenrechte laut dem Text?
Die Idee der Menschenrechte, wie sie heute verstanden wird, ist relativ jung. Sie entwickelte sich aus westlichen philosophischen und politischen Ideen, wobei die "Virginia Bill of Rights" (1776) und die "Déclaration des droits de l’homme et du citoyen" (1789) wichtige Meilensteine waren.
Welche Kritikpunkte werden an der Menschenrechtserklärung der UNO von 1948 geäußert?
Der Text kritisiert, dass die Erklärung der Menschenrechte 1948 erfolgte, als der Großteil der "dritten Welt" noch unter Kolonialherrschaft stand und deren Perspektiven daher nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
Welche Rolle spielt die westliche Kultur bei der Definition von Menschenrechten?
Der Text betont, dass das westliche Verständnis von Menschenrechten nicht als einzig gültiges Paradigma betrachtet werden darf. Es wird davor gewarnt, andere Kulturen aufgrund eines rein westlich geprägten Menschenrechtsverständnisses zu verurteilen.
Welche Bedeutung hat der Islam im Zusammenhang mit Menschenrechten?
Der Text untersucht, inwieweit islamische Grundsätze mit den Menschenrechten vereinbar sind. Dabei werden Ursprung, Lehren und verschiedene Strömungen des Islam betrachtet.
Was sind die Hauptquellen des Islam?
Die Hauptquellen des Islam sind der Koran (das Wort Gottes, empfangen von Muhammad), die Sunna (das Leben Muhammads als Vorbild), der Hadith (überlieferte Aussprüche des Propheten) und die Sharia (ethische Regeln).
Welche Konflikte entstehen bei der Umsetzung von Menschenrechten in islamischen Staaten?
Der Text nennt drei Hauptkonflikte: 1. Religionsrechtliche Regelungen und die mangelnde Gleichstellung anderer Religionen. 2. Die Rechtsstellung der Frau. 3. Die Anwendung der Sharia, insbesondere in Bezug auf Strafen.
Welche Rolle spielt die Sharia in der heutigen islamischen Welt?
Die Sharia hat in vielen islamischen Ländern großen Einfluss auf die Rechtsprechung, auch wenn sie oft nicht offiziell als Staatsgesetz gilt. Dies führt zu Konflikten, insbesondere in Bezug auf Strafrecht und die Rechte von Frauen und religiösen Minderheiten.
Welche Konflikte existieren im Islam in Bezug auf Religionsfreiheit?
Es gibt Konflikte hinsichtlich der Gleichstellung anderer Religionen. Obwohl einige Verfassungen Gleichberechtigung versprechen, werden Nicht-Muslime oft diskriminiert, besonders im Personenrecht und öffentlichen Leben. Abfall vom Islam kann hart bestraft werden.
Wie ist die Rechtsstellung der Frau im Islamischen Recht?
Die Frau genießt nicht immer eine gleichgestellte Position. Interreligiöse Ehen sind oft eingeschränkt, und das Scheidungsrecht kann Frauen benachteiligen. In einigen Ländern gibt es staatliche Kleidervorschriften, und Frauen werden aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen.
Was sind die Herausforderungen und Konfliktlösungen bei der Umsetzung von Menschenrechten im Islam?
Es gibt Versuche, zwischen Menschenrechten und der Sharia zu vermitteln, aber Fundamentalisten verdrehen oft die Menschenrechte. Es gibt auch neue islamische Menschenrechtserklärungen, aber diese sind nicht eindeutig. Einige reformierte Muslime setzen sich für eine Überarbeitung der Sharia ein.
Welche Lösungsansätze werden für die Konflikte zwischen Menschenrechten und islamischen Traditionen vorgeschlagen?
Der Text sieht eine mögliche Lösung in der Anpassung des Rechtsempfindens der Muslime an das geltende Menschenrechtsempfinden des Abendlandes, insbesondere durch eine moderne Auslegung des Korans und eine Abkehr von fundamentalistischen Traditionen.
Welche Rolle spielen Sufismus und Mystik im Islam in Bezug auf Frauen und Sinnlichkeit?
Der Text weist darauf hin, dass abseits der etablierten Gläubigkeit mystische Strömungen wie der Sufismus Sinnlichkeit, Lebensbejahung und Respekt vor Frauen betonen. Es gibt Beispiele für Körperübungen und Gesänge, die dazu auffordern, Erotik und Gefühle auszuleben.
Wie beeinflusst Fundamentalismus die Wahrnehmung von Menschenrechten im Islam?
Fundamentalismus führt zu einer Verschärfung der Traditionen und zu einer restriktiveren Auslegung der Sharia. Dies wirkt sich negativ auf die Menschenrechte aus, insbesondere auf die Rechte von Frauen und religiösen Minderheiten.
- Quote paper
- Thomas Scziglowski (Author), 2001, Menschenrechte und ihre Umsetzung im Islam, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103784