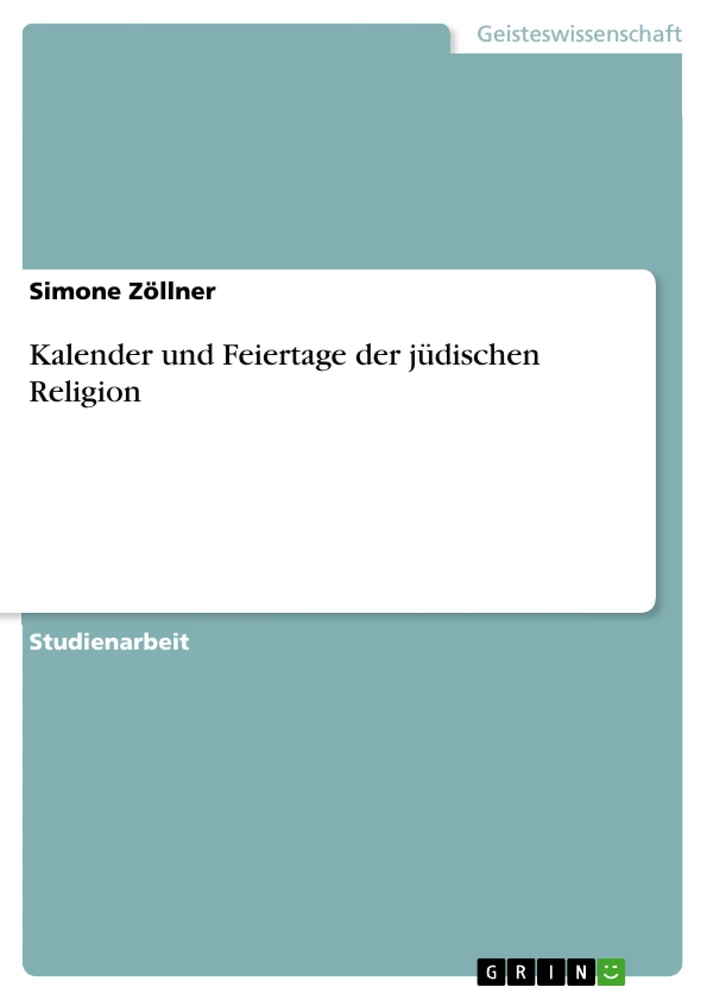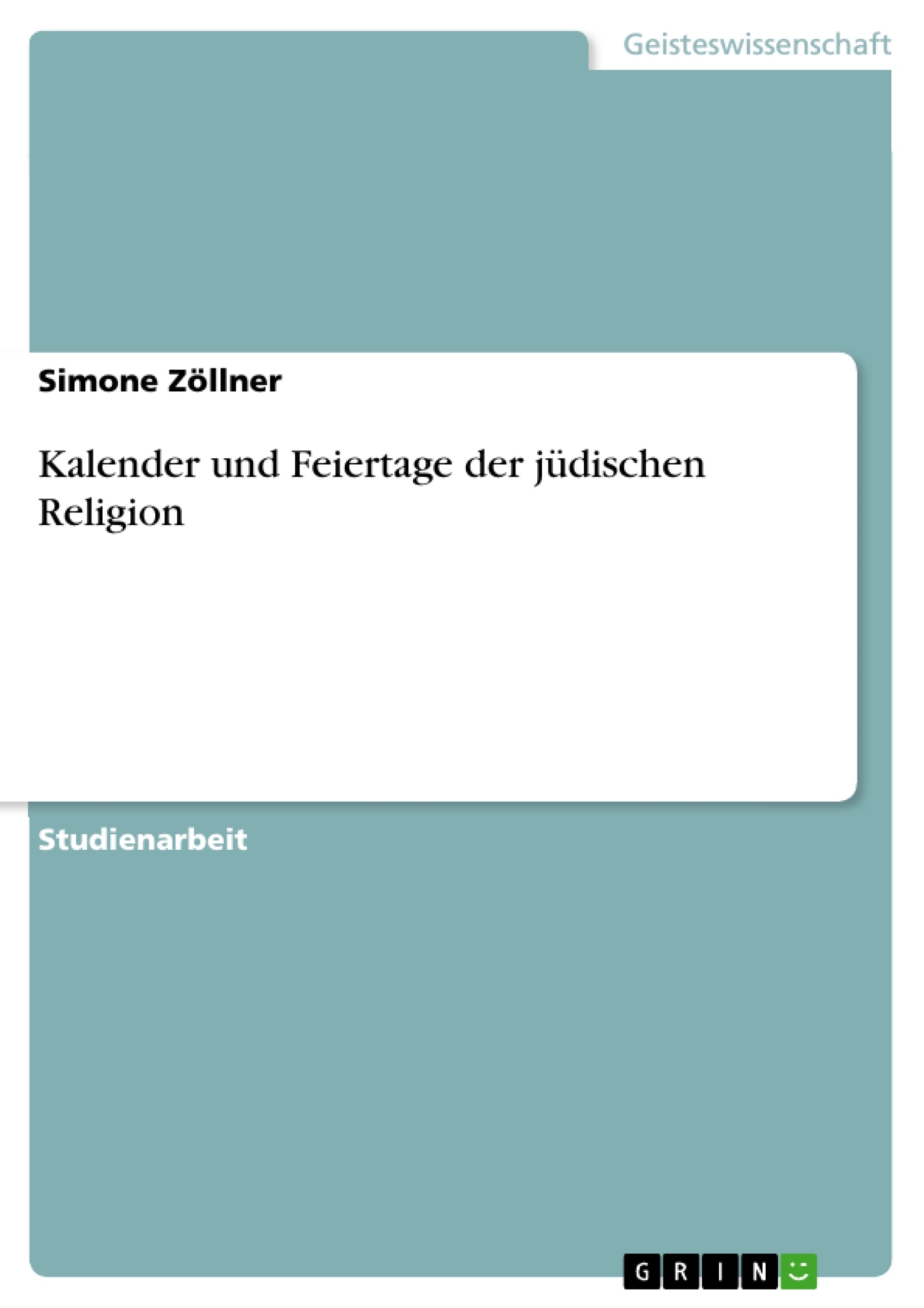Begeben Sie sich auf eine faszinierende Reise durch das jüdische Jahr und entdecken Sie die tiefgründigen Wurzeln und lebendigen Traditionen, die das Herz des Judentums bilden. Dieses Buch enthüllt die Geheimnisse des jüdischen Kalenders, von den beweglichen Mondphasen bis zur Bedeutung der Schaltmonate, und wie diese den Rahmen für ein Jahr voller spiritueller Einkehr und festlicher Begehung schaffen. Tauchen Sie ein in die prachtvollen Feierlichkeiten von Rosch Haschana, dem Neujahrsfest, einer Zeit der Selbstprüfung und Neuausrichtung, und erleben Sie die ergreifende Stille von Jom Kippur, dem Versöhnungstag, an dem die Gläubigen in Demut vor Gott treten. Erkunden Sie die fröhliche Atmosphäre von Sukkot, dem Laubhüttenfest, das an die Wanderung durch die Wüste erinnert, und lassen Sie sich von der strahlenden Freude von Chanukka, dem Lichterfest, erleuchten, das den Triumph des Lichts über die Dunkelheit feiert. Entdecken Sie die verborgenen Bedeutungen hinter Purim, dem Losfest, einer ausgelassenen Erinnerung an die Rettung des jüdischen Volkes, und erfahren Sie die tiefe Symbolik von Pessach, dem Paschafest, das die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten zelebriert. Erfahren Sie mehr über Schavuot, das Wochenfest, das die Gabe der Tora am Berg Sinai würdigt, und die heilige Ruhe des Sabbats, einem wöchentlichen Refugium der Besinnung und Erneuerung. Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in die jüdische Liturgie, die Rituale und Bräuche, die diese heiligen Tage prägen, und beantwortet die grundlegenden Fragen nach dem "Wie?", "Warum?", "Wie lange?" und "Woher?" dieser tief verwurzelten Traditionen. Es ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die das Judentum in seiner ganzen Vielfalt und Tiefe verstehen möchten, und bietet sowohl spirituelle Einsichten als auch praktische Anleitungen zur Gestaltung eines erfüllten jüdischen Lebens. Tauchen Sie ein in die reiche Geschichte, die berührenden Geschichten und die zeitlosen Werte, die diese Feste so bedeutsam machen, und lassen Sie sich von der jahrtausendealten Weisheit des jüdischen Glaubens inspirieren. Erleben Sie die Freude, die Besinnlichkeit und die Gemeinschaft, die diese Feiertage ausmachen, und entdecken Sie, wie sie auch heute noch das Leben von Juden auf der ganzen Welt bereichern. Von den festlichen Mahlzeiten bis zu den ergreifenden Gebeten, von den farbenprächtigen Traditionen bis zu den tiefgründigen spirituellen Lehren, dieses Buch ist ein Schlüssel zum Verständnis des jüdischen Herzens und eine Einladung, die Schönheit und Tiefe des jüdischen Glaubens zu entdecken.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der jüdische Kalender
2.1. Allgemeine Angaben
2.2. Im Kalender eingetragene Feste:
3. Das Neujahrsfest - Rosch Haschana
4. Der Versöhnungstag - Jom Kippur
5. Das Laubhüttenfest - Schukkot
5.1. Ursprung und Besonderheiten
5.2. Der Bau einer Hütte
6. Das Weihe- und Lichterfest - Chanukka
6.1. Die biblischen Grundlagen
6.2, Der Leuchter des Lichterfestes
7. Das Losfest - Purim
7.1. Die Geschichte aus der Bibel
7.2. Vorbereitung und Durchführung
8. Das Paschafest
8.1. Die Hintergründe des Festes
8.2. Praktische Durchführung des Festes
8.3. Der Sederabend
9. Das Wochenfest - Schavuot
10. Das Fest der Ruhe - Sabbat
10.1. Vorbereitungen am Freitag
10.2. Das Freitagabendgebet
10.3. Der Abend im Familienkreis
10.4. Die Toralesungen am Sabbat
10.5. Der Samstagabend
11. Anhang
12. Quellenangaben
1. Einleitung
Aus dem Angebot der Blockwoche des 3. Semesters entschied ich mich für das Thema „Judentum Zwischen Reform und Orthodoxie“ bei Frau Dr. Su- sanne Galley. Ihre sehr interessanten und umfangreichen Ausführungen nahm ich zum Anlaß mich mit der Geschichte des jüdischen Glaubens zu beschäftigen. Beeindruckt hat mich aber nicht nur Thematik an sich, sondern auch die von Frau Dr. Galley sehr bildhaft dargestellte Lebenswelt der Ju- den.
Bereits während des Seminars stand für mich fest, daß ich mich erst einmal mit den Grundlagen des jüdischen Glaubens beschäftigen muß, um mich tiefgründig in die Geschichte des Judentum einarbeiten zu können. Zu diesen Auseinandersetzungen gehören u.a. die Lebensweise, die Glaubensbekenntnisse, die Rituale und Bräuche usw.
Fakten, Begriffe und Gegenüberstellungen wie
- Orthodoxie - Liberale
- Haskala - Wurzeln in der Aufklärungspsychologie
- Anpassung (Kleidung, Sprache usw.)
- Emanzipation - politische Gleichberechtigung
- Gebiet der Erziehung und Ausbildung usw.
wirkten auf mich sehr fremd und faszinierend zugleich. Auf Grund meiner eigentlichen Ausbildung in den Fächern Physik und Mathematik gehen die geschichtlichen Voraussetzung „gleich gegen Null“. Also beschloß ich, mich erst einmal mit diesen grundlegenden Voraussetzungen zu beschäfti- gen.
Aus den sehr umfangreichen Bereichen des jüdischen Glaubens nehme ich mir die jüdische Liturgie und die immer wiederkehrenden Fest- und Feierta- ge eines Kalenderjahres heraus. Das Feiern bzw. Begehen dieser besonderen Tage im Alltag der jüdischen Menschen ist auch immer verknüpft mit den Fragen nach dem „Wie?“, „Warum?“, „Wie lange?“ und „Woher?“.
2. Der jüdische Kalender
2.1. Allgemeine Angaben
Der jüdische Kalender wurde ungefähr um das Jahr 350 nach moderner Zeit- rechnung errechnet und festgelegt. Er richtet sich nach den Mondphasen und zieht dadurch eine Verschiebung gegenüber dem Sonnenzyklus nach. Diese Verschiebung ergibt sich aus den 12 jüdischen Monaten, die im Durch- schnitt nur 29 bzw. 30 Tage haben Das Angleichen an den Sonnenzyklus erfolgt durch das Einschieben eines Schaltmonats (Adar II) bzw. innerhalb von 19 Jahren werden 7 Schaltjahre eingefügt, um das Manko des reinen Mondkalenders auszugleichen.
Die Zählung der Jahre basiert auf einer aus dem Alten Testament stammenden Berechnung des Zeitpunkts der Erschaffung der Welt. Man muß, um auf das richtige Datum im jüdischen Kalender zu kommen, einfach zur Jahreszahl unseres Kalenders die Zahl 3760 hinzuzählen.
So z.B. für das Jahr 1999: 1999 + 3760 = 5759
Das jüdisch liturgische Jahr beginnt im September, so daß zur Zeit der Ü- bergang vom Jahr 5759 zum Jahr 5760 stattfindet. 1999 begann der jüdische Kalender am 11. September unserer Kalenderrechnung. Aus den grafischen Darstellungen im folgenden vergleiche ich nun die Monate unseres Kalenders mit denen des jüdischen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hinweise zum Lesen der Kalender:
Die Kalenderblätter befinden sich im Anhang als Anlage 1!
- Der blaue Rand gibt den gewöhnlichen Kalender mit den Monaten Januar bis Dezember und die Tageszählung vom 1. bis 31 Tag an.
- Die Zahlenabgaben, die unterhalb der Monatsangaben stehen, bezeichnen die Wochentage des jeweils jüdischen Monats.
- Fettgedruckte Zahlen sind die Tage des Sabbat.
- Der jeweilige Monatsbeginn ist durch einen blauen Balken gekennzeich- net.
2.2. Im Kalender eingetragene Feste:
Rot eingetragen:
Rosch Haschana
11. und 12. September 1999 unseres Kalenders
1. und 2. Tishri 5759 des jüdischen Kalenders
Neujahr, Zeit der Prüfung vor Gott und den Mitmenschen
Jom Kippur
20. September 1999 unseres Kalenders
10. Tishri 5759 des jüdischen Kalenders Versöhnungstag, höchster Festtag Grün eingetragen:
Pasche
20. bis 27. April 2000 unseres Kalenders
15. bis 22. Nisan 5760 des jüdischen Kalenders Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten
Schavuot
9. und 10 Juni 2000 unseres Kalenders
6. und 7. Sivan 5760 des jüdischen Kalenders
Erntefest und Erinnerung an die Sinai-Offenbarung
Sukkot
25. September bis 3. Oktober 1999 unseres Kalenders
15. bis 23. Tishri 5759 des jüdischen Kalenders
Laubhüttenfest, Erntefest und Dank für Gottes Güte bei der 40-jährigen Wüstenwanderung
Simchat Tora
3. Oktober 1999 unseres Kalenders
23. Tishri 5759 des jüdischen Kalenders Fest der Gesetzesfreude,
Dank für die Gabe des Gesetzes, Tora-Freudenfest
Blau eingetragen:
Chanukka
4. bis 11. Dezember 1999 unseres Kalenders
25. Kislev bis 2. Tevet 5759 des jüdischen Kalenders Lichterfest
Erinnerung an die neue Weihe des zweiten Tempels
Purim
21. März 2000 unseres Kalenders
14. Adar II 5760 des jüdischen Kalenders Erinnerung an die Ereignisse im Buch Ester
In den folgenden Ausführungen werde ich auf die einzelnen jüdischen Festund Feiertage eingehen.1
3. Das Neujahrsfest - Rosch Haschana
Rosch Haschana heißt wörtlich übersetzt „Kopf des Jahres“. Mit diesem Fest werden die „Zehn Bußtage“ eröffnet.
„Das jüdische Jahr, ein Mondjahr, beginnt im September/Oktober mit dem Neujahrsfest, Rosch Haschana (Jahresanfang), das mit einem besonders fei- erlichen Gottesdienst begangen wird. An diesem Tag wird man, nach dem Volksglauben, ins Buch des Lebens eingetragen - oder nicht.“2 An diesem Tag wird Rückblick gehalten, es wird Rechenschaft über die Taten abgelegt, die Sünden werden überdacht und neue Vorsätze für das kommende Jahr werden gefasst.
Morgens und abends gehen die Gläubigen in die Synagoge. Sie tragen als Zeichen der Gleichheit aller Menschen vor Gott und der Reinheit von Sün- den weiße Kleidung. Während des Gottesdienstes wird der Schofar (das Widderhorn) geblasen. Diese Zeremonie erinnert an die Wanderung durch die Wüste, die mit einem Signal der Schofar zum Aufbruch gegann. „Es soll zu Reue und Besserung aufrufen, erinnert und gemahnt wird, aber auch an die Zurückweisung des Menschenopfers durch Gott, als Abraham gehorsam seinen Sohn Isaak darbot. Ein Widder, ein Tieropfer, trat ein für allemal an die Stelle des Menschenopfers.“3 Zu diesem Gottesdienst werden aus Über- lieferung spezielle Gebete aus der Tora vorgelesen.
Z.B. über die Geburt Isaaks 21,1-8:
1 Der Herr nahm sich Saras an, wie er gesagt hatte, und er tat Sara so, wie er versprochen hatte.2 Sara wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angegeben hatte.3 Abraham nannte den Sohn, den ihm Sara gebar, Isaak.4 Als sein Sohn Isaak acht Tage alt war, beschnitt ihn Abraham, wie Gott ihm befohlen hatte.5 Abraham war hundert Jahre alt, als sein Sohn Isaak zur Welt kam.6 Sara aber sagte: Gott ließ mich lachen; jeder, der davon hört, wird mit mir la- chen.
7 Wer, sagte sie, hätte Abraham zu sagen gewagt, Sara werde noch Kinder stillen? Und nun habe ich ihm noch in seinem Alter einen Sohn geboren. 8 Das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Als Isaak entwöhnt wurde, veranstaltete Abraham ein großes Festmahl.
Die Prüfung Abrahams 22,1-19 (Auszüge)
1 Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham! Er antwortete: Hier bin ich.
2 Gott sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Morija, und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar.3 Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte sei- nen Esel, holte seine beiden Jungknechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Opfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte.4 Als Abraham am dritten Tag aufblickte, sah er den Ort von weitem.5 Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten: Bleibt mit dem Esel hier! Ich will mit dem Knaben hingehen und anbeten; dann kommen wir zu euch zurück.
9 Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham den Altar, schichtete das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz.10 Schon streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten.11 Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich.12 Jener sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus, und tu ihm nichts zuleide! Denn jetzt weiß ich, daß du Gott fürchtest; du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten.13 Als Abraham auf- schaute, sah er: Ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar.14 Abraham nannte jenen Ort Jah- we-Jire (Der Herr sieht), wie man noch heute sagt: Auf dem Berg läßt sich der Herr sehen.
15 Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweitenmal vom Himmel her zu
16 und sprach: Ich habe bei mir geschworen - Spruch des Herrn: Weil du das getan hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast,17 will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nach- kommen sollen das Tor ihrer Feinde einnehmen.18 Segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast.19 Darauf kehrte Abraham zu seinen Jungknechten zurück. Sie machten sich auf und gingen miteinander nach Beerscheba. Abraham blieb in Beer- scheba wohnen.
Der Rabbi Jehuda sagt im Talmud:
„Alles wird an Neujahr gerichtet, und das Urteil eines jeden wird zu seiner Zeit besiegelt: [am Pascha] über das Getreide, am Schlußfest über die Baumfrüchte, am Hüttenfest über das Wasser. Der Mensch aber wird an Neujahr gerichtet, und sein Urteil wird am Versöh- nungstag besiegelt.“4
4. Der Versöhnungstag - Jom Kippur
Für diesen Tag gibt es folgende
Besonderheiten:
- Am 10. Tischri ist der höchste und heiligste Feiertag der Juden.
- Er wird auch der „Sabbat der Sabbate genannt.
- Die Versöhnung mit Gott ist nur möglich, wenn man sich mit seinen Mitmenschen versöhnt hat und selbst entsündigt ist.
- An diesem Tag tragen alle Gläubigen weiße Gewänder.
- Als Zeichen der Demut trägt man Stoff- oder Filzschuhe.
- Er ist ein Fasttag und der Tag, an dem der Hohepriester sich, die Priester und das Volk für alle Vergehen entsühnt.
- Nur an diesem Tag darf er das Allerheiligste des Tempels betreten
- Es ist auch der einzige Tag des Jahres, an dem der Hohepriester den Got- tesnamen Jahwe aussprechen darf. (Aus Ehrfurcht vor der Mächtigkeit Gottes, sprechen die meisten Juden bis heute den Gottesnamen nicht aus. Geschrieben wird er in der jüdischen Literatur als „G`tt“.)
- In der Synagoge werden Bußgebete und Sündenbekenntnisse gesprochen.
Der Entsühnung liegt ein uralter „Sünden- bock“- Ritus zugrunde, der in der Bibel Lev 16 folgendermaßen beschreiben wird:
1 Nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, die umgekommen waren, als sie vor den Herrn hintraten, redete der Herr mit Mose.2 Der Herr sprach zu Mose: Sag deinem Bruder Aaron, er soll nicht zu jeder beliebigen Zeit das Heiligtum hinter dem Vorhang vor der Deckplatte der Lade betreten. Dann wird er nicht sterben, wenn ich über der Deckplatte in einer Wolke erschei- ne.3 Aaron darf nur so in das Heiligtum kommen: mit einem Jungstier für ein Sündopfer und einem Widder für ein Brandopfer.4 Ein geweihtes Leinengewand soll er anhaben, leinene Beinkleider tragen, sich mit einem Leinengürtel gürten und um den Kopf einen Leinenturban binden. Das sind heilige Gewänder; deshalb soll er seinen ganzen Körper in Wasser baden und sie erst dann anlegen.5 Von der Gemeinde der Israeliten soll er zwei Ziegenböcke für ein Sündopfer und einen Widder für ein Brandopfer erhalten
15 Nachher soll er den Bock schlachten, der als Sündopfer für das Volk be- stimmt ist, und sein Blut hinter den Vorhang tragen. Er soll es mit diesem Blut ebenso machen wie mit dem Blut des Jungstiers und es auf die Deck- platte und vor die Deckplatte spritzen.16 So soll er das Heiligtum von den Unreinheiten der Israeliten, von all ihren Freveltaten und Sünden entsüh- nen, und so soll er mit dem Offenbarungszelt verfahren, das bei ihnen inmit- ten ihrer Unreinheiten seinen Sitz hat.17 Kein Mensch darf im Offenba- rungszelt sein, wenn er in das Heiligtum eintritt, um die Sühne zu vollzie- hen, bis er es wieder verläßt. Hat er sich, sein Haus und die ganze Gemein- de Israels entsühnt,18 so soll er zum Altar vor dem Herrn hinausgehen und ihn entsühnen. Er soll etwas Blut des Jungstiers und des Bockes nehmen und es auf die Hörner rings um den Altar tun.19 Etwas von diesem Blut soll er mit seinem Finger siebenmal auf den Altar spritzen. So soll er ihn von den Unreinheiten der Israeliten reinigen und ihn heiligen.
20 Hat er so die Entsühnung des Heiligtums, des Offenbarungszeltes und des Altars beendet, soll er den lebenden Bock herbringen lassen.
21 Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockes legen und über ihm alle Sünden der Israeliten, alle ihre Frevel und alle ihre Fehler bekennen. Nachdem er sie so auf den Kopf des Bockes geladen hat, soll er ihn durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste treiben lassen,22 und der Bock soll alle ihre Sünden mit sich in die Einöde tragen. Hat er den Bock in die Wüste geschickt,23 dann soll Aaron wieder in das Offenbarungszelt gehen, die Leinengewänder, die er beim Betreten des Heiligtums angelegt hat, ablegen und sie dort verwahren.
24 Er soll seinen Körper in Wasser an einem heiligen Ort baden, wieder seine Kleider anlegen und hinausgehen, um sein Brandopfer und das des Volkes darzubringen. Er soll sich und das Volk entsühnen25 und das Fett des Sündopfers auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen
29 Folgendes soll euch als feste Regel gelten: Im siebten Monat, am zehnten Tag des Monats, sollt ihr euch Enthaltung auferlegen und keinerlei Arbeit tun, der Einheimische und ebenso der Fremde, der in eurer Mitte lebt.30 Denn an diesem Tag entsühnt man euch, um euch zu reinigen. Vor dem Herrn werdet ihr von allen euren Sünden wieder rein.31 Dieser Tag ist für euch ein vollständiger Ruhetag, und ihr sollt euch Enthaltung auferlegen. Das gelte als feste Regel
34 Das soll für euch als feste Regel gelten: Einmal im Jahr sollen die Israeliten von allen ihren Sünden entsühnt werden. Und man tat, wie es der Herr dem Mose befohlen hatte.
Ohne Unterbrechung dauert der Gottesdienst vom Morgens bis zum Abends. „Der Abendgottesdienst beginnt mit einem Kol Nidre Gesang, einer großen Bitte um Vergebung,...Kol Nidre allein bezieht sich auf die Verpflichtungen, die man sich selbst auferlegt hat, die man aber beim besten Willen nicht einhalten konnte.“5
5. Das Laubhüttenfest .- Schukkot
5.1. Ursprung und Besonderheiten
Genau ein halbes Jahr nach dem Pesachfest, genau zum Jahreszeitenwechsel und wie dieses sieben Tage lang, feiern die Juden das Laubhüttenfest. Ur- sprünglich war dieses Fest ein Erntedankfest bzw. Herbst- und Weinlesefest, welches nachträglich mit der Erinnerung an die Zeit der Wüstenwanderung verbunden wurde.
In den Vorschriften im dritten Buch (Lev 23, 39.43) wird vorgeschrieben:
39 Am fünfzehnten Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes erntet, feiert sieben Tage lang das Fest des Herrn! Am ersten und am achten Tag ist Ruhetag.40 Am ersten Tag nehmt schöne Baumfrüchte, Palmwedel, Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachweiden, und seid sieben Tage lang vor dem Herrn, eurem Gott, fröhlich!41 Feiert dieses Fest zur Ehre des Herrn jährlich sieben Tage lang! Das gelte bei euch als feste Re- gel von Generation zu Generation. Ihr sollt dieses Fest im siebten Monat feiern.42 Sieben Tage sollt ihr in Hütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Hütten wohnen,43 damit eure kommenden Generationen wissen, daß ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten herausführte. Ich bin der Herr, euer Gott.
- am ersten und achten Tag der Festwoche ist Arbeitsruhe einzuhalten .
- während dieser Tage sollen sie in Hütten wohnen
Das Leben in diesen Hütten soll den Nachkommen übermittelt werden, damit sie erfahren, „wie ich die Kinder Israels habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägypten herausführte“ (Lev 23, 43)
In verschiedenen Ländern der Erde sind die klimatischen, staatlichen und gesellschaftlichen Bedingungen sehr verschieden, so das die religiösen Traditionen angepaßt werden müssen. Für das Leben in einer Hütte werden diese wie folgt dargestellt:
„Wo möglich, errichtet man eine Hütte, deren Dach mit Zweigen und Laub gedeckt ist, im Garten oder auf dem Balkon; eine Laubhütte im Hof der Syn- agoge dient jenen, die daheim keine Möglichkeit haben, eine solche Hütte zu errichten. An sich sollte man in der Hütte während dieser Woche schlafen schlafen und essen; in unserem Klima bemüht man sich, soweit es das Wet- ter erlaubt, in der Hütte zumindest am ersten Tag zu essen.“6
Das Laubhüttenfest ist ein Fest besonderer Freude, welches sich auch in den Äußerlichkeiten widerspiegelt. Feststräuße aus Palmenwedel, Myrtenzweige und Bachweiden schmücken die festliche Zeremonie. Sie werden auch Lu- lav genannt. Diese werden beim Rezitieren der Psalmen in der rechten Hand gehalten. Die Zitrusfrucht, auch Etrog genannt, hält man in der linken Hand. „Zur Zeit des Tempels pilgerte man an jedem Tag des Festes, ..., sie- benmal um den Tempel. In der Synagoge prozessiert man noch heute am siebten Tag um die bima, das Tora-Lesepult, um den alten Brauch leben- dig zu halten.“7
An diesem letzten Tag des Sukkot-Festes wird das Freudenfest, auch Simchat-Tora genannt, gefeiert. Es wird dadurch begründet, daß an diesem Tag der Tora-Lesezyklus zu Ende geht, es wird das Schlußkapitel des fünften Buch Mose/Deuteronomium gelesen, und mit dem ersten Buch Mose/Genesis im Folgenden fortgesetzt.
Die Torarollen werden aus dem Schrein genommen und siebenmal durch die Synagoge getragen. Nicht selten auch tanzend; man freut sich über das Geschenk Gottes - über die Tora.
Es gibt ein Lied über die Torahfreude:
„Freut euch und jubelt an Torahfreude und gebet Ehre der Torah heute.
Besser als aller Erwerb ist`s, sie zu erwerben, köstlicher ist sie als Gold und Perlen. Wir jubeln, der Torah freuen wir uns, denn sie ist Kraft und Licht für uns.“8
5.2. Der Bau einer Hütte
Die strengen Vorschriften zum der Bau einer Hütte und zum Benutzen die- ser sind in ständiger Diskussion unter den Gelehrten. In der Tora z.B. wird beschrieben, daß der Aufenthalt in einer Hütte 7 Tage dauern soll. Während der sieben Tage wird die Hütte zum dauernden und das Haus bzw. die Woh- nung zum gelegentlichen Wohnort erklärt. Vierzehn Mahlzeiten müssen in der Hütte eingenommen werden. Vorgeschlagen wird eine Mahlzeit am Tag und eine in der Nacht.
Interessanterweise sind zur Hütte und deren Bau in der Mischna sehr genaue Vorschriften festgelegt. Aus der Sukka I. 1.5.6.9.11a; und Sukka II. 4.6-9 dargestellten Bestimmungen zum Hüttenbau werde ich in Kurzfassung einige hervorbenswerten aufstellen:
Die Hütte darf nicht genutzt werden, wenn sie
- in einer Höhe von über 10 Metern errichtet wird,
- weniger als 1 Meter hoch ist,
- weniger als drei Wände hat,
- mehr Sonne als Schatten auf sie scheint
- 30 Tage vor dem Fest hergestellt wurde
- nicht eigens für dieses Fest aufgebaut worden ist - kegelförmit ist
- direkt an einer Mauer angelehnt wird,
Einige allgemeine Bauanweisungen:
- als Baumaterialien darf man Stroh, Holz bzw. Reisig verwenden, wenn diese entbündelt wurden, also z.B. keine Strohpuppen oder Heuschober
- die Decke kann aus Brettern hergestellt werden
- die Bretter dürfen aber nicht kürzer als 80 cm sein, ansonsten sind diese unbrauchbar
- die Seitenwände sind ohne Fenster errichtet9
Die Abbildung einer Hütte befindet sich im Anhang als Anlage 2!
6. Das Weihe- und Lichterfest - Chanukka
6.1. Die biblischen Grundlagen
Chanukka, ein acht Tage währendes Lichterfest zur Zeit der Wintersonnen- wende, hat seine historische Begründung in der Makkabäerzeit. Dieses Fest ist besonders für die Kinder ein sehr erfreuliches Erlebnis. Als Fest im Hauskreis erhalten sie, ähnlich dem christlichen Weihnachtsfest, Geschenke. An diesen Tagen sind Arbeit und Vergnügen erlaubt, da es ein Fest der Freude und Fröhlichkeit ist.
Der Ursprung dieser Feierlichkeit:
1. das Weihefest- geht zurück auf die Wiedereinweihung des zweiten Tem- pels unter Judas Makkabäus im Jahr 164 v. Ch. und
2. das Lichterfest- geht zurück auf ein Wunder, dass der Ölvorrat eines Tages für acht Tage gereicht hat.
„Der Seleukidenkönig Antiochus IV. Epiphanes hatte zuvor den Tempel entweiht und dort eine Kultstätte für Zeus Olympios errichtet. Die Juden sollten dieser heidnischen Gottheit im Tempel und an anderen Heiligtümern Opfer darbringen. Daraufhin kam es zur makkabäischen Erhebung.“10
Die geschichtliche Beschreibung der Entwei- hung wird in Makkabäer 1, 16-28 festgehalten:
16 Der Angriff der Heiden auf den Tempel: Als Antiochus sah, daß sich seine Herrschaft gefestigt hatte, faßte er den Plan, auch König von Ägypten zu werden und so über zwei Reiche zu herrschen.17 Er drang mit vielen Soldaten in Ägypten ein, mit Streitwagen und Kriegselefanten, mit Reitern und einer großen Flotte,18 und führte Krieg gegen Ptolemäus, den König von Ägypten. Ptolemäus wurde von ihm geschlagen und mußte fliehen, nachdem viele seiner Leute im Kampf gefallen waren.
19 Die befestigten Städte Ägyptens wurden erobert und das Land geplündert.
20 Antiochus wandte sich nach seinem Sieg über Ägypten im Jahr 143 gegen Israel und rückte mit zahlreichen Truppen hinauf vor Jerusalem.21 In sei- ner Vermessenheit betrat er sogar das Heiligtum; er raubte den goldenen Rauchopferaltar, den Leuchter samt seinem Zubehör,22 den Tisch für die Schaubrote, die Opfer- und Trinkschalen, die goldenen Rauchfässer, den Vorhang, die Kronen und den goldenen Schmuck von der Vorderseite des Tempels. Von allem ließ er das Gold abschlagen.23 Dann nahm er das Silber, das Gold, die kostbaren Geräte, und was er von den versteckten
Schätzen finden konnte,24 und ließ alles in sein Land schleppen. Er richtete ein Blutbad an und führte ganz vermessene Reden.
25 Da kam große Trauer über das ganze Land Israel.26 Die Vornehmen und Alten stöhnten; die Mädchen und jungen Männer verloren ihre Kraft, und die Schönheit der Frauen verfiel.27 Jeder Bräutigam stimmte die Totenklage an, die Braut saß trauernd in ihrem Gemach.28 Das Land zitterte um seine Bewohner. Das ganze Haus Jakob war mit Schande bedeckt.
Drei Jahre später konnte Judas Makkabäus die Tempel eins und zwei wieder einrichten und reinigen. Dabei greift er auf das Ritual des Hüttenfestes zurück, womit erklärbar ist, warum das Chanukkafest ebensolang wie das Hüttenfest - acht Tage- ist.
Die Reinigung und Weihe des Tempels wird in 1 Makkabäer 4, 36-61 beschrieben: (Auszüge)
36 Judas und seine Brüder aber sagten: Unsere Feinde sind nun vernichtend geschlagen. Wir wollen nach Jerusalem hinaufziehen, den Tempel reinigen und ihn neu weihen.37 Das ganze Heer versammelte sich also und zog zum Berg Zion hinauf.38 Da sahen sie das Heiligtum verödet daliegen. Der Brandopferaltar war entweiht; die Tore hatte man verbrannt. In den Vorhö- fen wuchs Unkraut wie in einem Wald oder auf einem Berg, und die Neben- gebäude waren verfallen.39 Da zerrissen sie ihre Gewänder, begannen laut zu klagen und streuten sich Staub auf das Haupt.40 Sie warfen sich nieder, mit dem Gesicht zur Erde. Sie bliesen die Signaltrompeten und schrien zum Himmel
48 Auch das Heiligtum und die Innenräume des Tempels bauten sie wieder auf und reinigten die Vorhöfe.49 Sie fertigten neue heilige Geräte an und stellten den Leuchter, den Rauchopferaltar und den Tisch in den Tempel.50 Dann brachten sie auf dem Altar ein Rauchopfer dar, zündeten die Lichter an dem Leuchter an, so daß der Tempel hell wurde,51 legten Schaubrote auf den Tisch und hängten den Vorhang auf. So beendeten sie alle Arbeiten, die sie sich vorgenommen hatten.52 Am Fünfundzwanzigsten des neunten Mo- nats - das ist der Monat Kislew - im Jahr 148 standen sie früh am Morgen auf53 und brachten auf dem neuen Brandopferaltar, den sie errichtet hatten, Opfer dar, so wie sie das Gesetz vorschreibt.54 Zur gleichen Zeit und am selben Tag, an dem ihn die fremden Völker entweiht hatten, wurde er neu geweiht, unter Liedern, Zither- und Harfenspiel und dem Klang der Zim- beln.55 Das ganze Volk warf sich nieder auf das Gesicht, sie beteten an und priesen den Himmel, der ihnen Erfolg geschenkt hatte.56 Acht Tage lang feierten sie die Altarweihe, brachten mit Freuden Brandopfer dar und schlachteten Heils- und Dankopfer.57 Sie schmückten die Vorderseite des Tempels mit Kränzen und kleinen Schilden aus Gold; sie erneuerten die To- re und auch die Nebengebäude, die sie wieder mit Türen versahen
6.2, Der Leuchter des Lichterfestes
Sie brachten auf dem Altar ein Rauchopfer dar, zündeten die Lichter am Leuchter an, damit der Tempel hell erleuchtet wurde. Erst im Talmud wird die Geschichte des Lichtes erzählt. Nach der Überlieferung gab es nur einen Krug mit Öl für das ewige Licht. Die Ölmenge reichte aber nur für einen Tag. Wie durch ein Wunder reichte das Öl aber acht Tage lang. Sowohl zu Hause als auch in der Synagoge wird jeden Tag auf dem achtar- migen Leuchter ein Licht angezündet. Dieser Leuchter ist der Menora sehr ähnlich. Die Menora ist ein sechsarmiger Leuchter und ein Kultgerät für das Heiligtum.
Im zweiten Buch Moses 25, 31ff wird der Leuchter wie folgt beschrieben:
31 Verfertige auch einen Leuchter aus purem Gold! Der Leuchter, sein Gestell, sein Schaft, seine Kelche, Knospen und Blüten sollen aus einem Stück getrieben sein.32 Von seinen Seiten sollen sechs Arme ausgehen, drei Leuchterarme auf der einen Seite und drei auf der anderen Seite 37 Dann mach für den Leuchter sieben Lampen, und setze seine Lampen so auf, daß sie das Licht nach vorn fallen lassen.
Bei der Menora gibt es noch einen Leuchterarm mehr und mit diesem wer- den die anderen Lichter angezündet. Angelehnt an diese Festlegungen wurde auch der Chanukka-Leuchter mit einem neunten Arm in der Mitte ausgestat- tet. An jedem Abend des Festes wird -meist von den Kindern- ein Licht mehr angezündet, bis schließlich alle acht brennen. „Vor dem Anzünden der Lichter betet man: „Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt hat durch seine Gebote und uns geboten hat, ein Licht der Einweihung anzuzünden. Gepriesen seiest du, Herr, unser Gott, König der Welt, der Wunder getan hat unserer Väter in jenen Tagen um diese Zeit.“11
Die Abbildung des Leuchters befindet sich im Anhang als Anlage 3!
7. Das Losfest - Purim
7.1. Die Geschichte aus der Bibel
Der Name des Festes ist durch die Tatsache entstanden, dass der Wesir Haman, ein Judenfeind, den Zeitpunkt der Vernichtung durch das Los entschieden hat. Diesem Festtag wird das „Buch Ester“ zugrunde gelegt. Sehr detailliert und anschaulich werden das Leben und die Taten der Jüdin Ester in der gleichnamigen Verfilmung dargestellt:
- die Jüdin Ester und ihr Onkel Mordechai auf der einen, König Artaxerxes und Haman auf der anderen Seite sind die Hauptpersonen
- es geht um die Abwendung einer drohenden Judenverfolgung im Perser- reich
- der geschichtlichen Hintergrund ist die schon in alter Zeit praktizierte Judenverfolgungen
- Ester, die Pflegetochter Mordechais, wird anstelle der von Artaxerxes verstoßenen Waschti zur Königin
- Mordechai hat durch die Aufdeckung einer Verschwörung dem König das Leben gerettet
- Haman, der zweite Mann im Reich, haßt aus Mißgunst gegen Mordechai die Juden und erwirkt einen königlichen Erlaß zu ihrer Ausrottung
- diese wird durch das Los (pûr) auf den 13. Adar (Februar- März) festge- setzt
- auf Veranlassung Mordechais geht Ester unter Lebensgefahr zum König - sie erlangt sein Wohlwollen und erreicht den Sturz Hamans, welcher ge- hängt wird
- Mordechai tritt an Hamans Stelle
- Ester erhält Hamans Besitz und erwirkt gegen den ersten Erlaß des Kö- nigs einen zweiten, der den Juden erlaubt, sich ihrer Feinde zu erwehren
- das geschieht am 13. Adar im Perserreich und am 14. Adar in der Haupt- stadt Susa, worauf der 14. Adar für die Juden in den Provinzen und der 15. für die in Susa lebenden Juden zum Festtag erklärt wird
- Mordechai und Ester rufen in Briefen zur Feier dieses Festes
7.2. Vorbereitung und Durchführung
Bereits am Vortag beginnt diese Festlichkeit mit dem Fasten, so wie es Ester vor ihrem Bittgang zum König Artaxerxes getan hat. Abends in der Synagoge ist es ein Verpflichtung das Buch Ester zu lesen. Jedesmal, wenn der Name des Judenverfolgers „Haman“ fällt, erzeugen die anwesenden Kinder als auch Erwachsene fröhlichen Lärm mit Holzrasseln oder stampft mit den Füßen, um somit den Namen unhörbar werden zu lassen.
Am 14. Adar feiert man sehr ausgelassen. Wie im Karneval werden Umzü- ge, Tanzveranstaltungen und Festspiele durchgeführt. Viele Menschen ver- kleiden sich. An diesem Tag ist das Betrinken mit Alkohol sogar rechtens. „Dies ist nach dem Urteil eines Rechtsgelehrten erlaubt, der an diesem Tag den Frommen zubilligt, soviel zu trinken, bis sie nicht mehr wissen, was der Unterschied ist zwischen „gesegnet sei Mordechai“ und „verflucht sei Ha- man“.“12
Im Buch Ester 9, 22-23 sind für dieses Fest alle Festlegungen getroffen:
Mordechai schrieb alles auf, was geschehen war. Er schickte Schreiben an alle Juden in allen Provinzen des Königs Artaxerxes nah und fern
21 und machte ihnen zur Pflicht, den vierzehnten und den fünfzehnten Tag des Monats Adar in jedem Jahr als Festtag zu begehen.22 Das sind die Ta- ge, an denen die Juden wieder Ruhe hatten vor ihren Feinden; es ist der Monat, in dem sich ihr Kummer in Freude verwandelte und ihre Trauer in Glück. Sie sollten sie als Festtage mit Essen und Trinken begehen und sich gegenseitig beschenken, und auch den Armen sollten sie Geschenke geben.
23 So wurde bei den Juden das, was sie damals zum erstenmal taten und was Mordechai ihnen vorschrieb, zu einem festen Brauch.
Traditionell werden Mohntaschen gebacken, die sogenannten Haman-Ohren, die dann auch als Purim-Geschenk verteilt werden. Den Armen schickt man zusätzlich Geld und andere Geschenke. Zu Hause feiert man mit einem großen Festmahl, für das man an nichts sparen sollte. Insgesamt ist es eine volksfestartige Feierlichkeit, ein großes Freudenfest.
8. Das Paschafest
8.1. Die Hintergründe des Festes
Pascha heißt „Vorübergang, Verschonung“ und erinnert an den Auszug aus Ägypten als erste Bedeutung und desweitern ist es ein Früherntefest im Ernterythmus der Bauern. Es wird im Jahr 5760/61 vom 15. bis 22. Nisan des jüdischen Kalenders und im Jahr 2000 vom 20. bis 27. April des christlichen Kalenders gefeiert. Aus der biblischen Überlieferung im alten Testament ist das christliche Osterfest entstanden.
„In den biblischen Texten tritt es meist zusammen mit einem zweiten Fest, dem Mazzotfest, dem Fest der ungesäuerten Brote. Doch die Überlieferungen lassen erkennen, daß es sich ursprünglich um zwei selbständige Feste gehandelt hat, die erst in einem späteren geschichtlichen Stadium zu einem Fest verschmolzen wurden“13
Zusammen sind sie Wallfahrts- und Tempelfeier zugleich. Da im Verlauf der jüdischen Geschichte umwälzende Veränderungen vorgingen, z.B. Machtwechsel, Verfolgungen usw. änderten sich die Riten und Bräuche die- ses Festes sehr stark. Als erstes fällt auf, daß die Örtlichkeit der Zeremonien, ob im Tempel oder im Familienkreis, zeitlich sehr verschieden war. Deswei- teren werden in den geschichtlichen Grundlagen dieses Festes unterschiedli- che Wichtungen beschrieben, z.B. über die Arten der Tiere, die Bedeutung des Blutes usw.
Nach allen innerlichen und äußerlichen Veränderungen wird jetzt das Pa- schafest ausschließlich im Familienkreis begangen. Es entstanden sehr fest- gelegte Rituale, die sogenannte Seder (feste Ordnung) Alle notwendigen Festlegungen wurden in einem Buch, der sogenannten „Pesach-Haggada“ aufgeschrieben. Haggada bedeutet „Nichtreligionsgesetzliche Überlieferun- gen, Legenden, Sagen, Anekdoten“14 Dieses Buch erfreut sich großer Be- liebtheit und ist neben der Bibel und dem Gebetsbuch ein Lieblingsbuch der Juden.
8.2. Praktische Durchführung des Festes
Im 2. Mose -Ex 12- wird die praktische Ausführung des Festes ausführlich beschrieben: (Auszüge)
- 3 Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am Zehnten dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus.
- 4 Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zu- sammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müßt ihr berücksichtigen, wieviel der einzelne essen kann.
- 5 Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein, das Junge eines Schafes oder einer Ziege müßt ihr nehmen.
- 6 Ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren. Gegen Abend soll die ganze versammelte Gemeinde Israel die Lämmer schlachten.
- 7 Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man das Lamm essen will.
- 8 Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen.
- 9 Nichts davon dürft ihr roh oder in Wasser gekocht essen, sondern es muß über dem Feuer gebraten sein. Kopf und Beine dürfen noch nicht vom Rumpf getrennt sein.
- 10 Ihr dürft nichts bis zum Morgen übriglassen. Wenn aber am Morgen noch etwas übrig ist, dann verbrennt es im Feuer!
- 11 So aber sollt ihr es essen: eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Fü-ßen, den Stab in der Hand. Eßt es hastig! Es ist die Paschafeier für den Herrn.
- 13 Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage.
- 15 Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Gleich am ers- ten Tag schafft den Sauerteig aus euren Häusern! Denn jeder, der zwischen dem ersten und dem siebten Tag Gesäuertes ißt, soll aus Israel ausgemerzt werden.
- 16 Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung einberufen und ebenso eine heilige Versammlung am siebten Tag. An diesen beiden Tagen darf man keinerlei Arbeit tun. Nur das, was jeder zum Essen braucht, dürft ihr zubereiten.
- 18 Im ersten Monat, vom Abend des vierzehnten Tags bis zum Abend des einundzwanzigsten Tags, eßt ungesäuerte Brote!
- 19 Sieben Tage lang darf sich in euren Häusern kein Sauerteig befin- den; denn jeder, der Gesäuertes ißt, sei er fremd oder einheimisch, soll aus der Gemeinde Israel ausgemerzt werden.
- 43 Der Herr sprach zu Mose und Aaron: Folgende Regel gilt für das Pascha: Kein Fremder darf davon essen;44 aber jeder Sklave, den du für Geld gekauft hast, darf davon essen, sobald du ihn beschnitten hast.
-45 Halbbürger und Lohnarbeiter dürfen nicht davon essen.
-46 In einem Haus muß man es essen. Trag nichts vom Fleisch aus dem Haus! Und ihr sollt keinen Knochen des Paschalammes zerbrechen.
Gemäß Ex 12, 15 darf man kein gesäuertes Brot essen. Es darf auch kein gesäuertes Brot im Haus sein. Nicht einmal das mit diesem in Verbindung gekommene Geschirr, Kleidung usw. darf im Haus bleiben. Das bringt un- weigerlich eine Hausreinigung mit sich, die am Vortag des beginnenden Paschafestes durchgeführt wird. „Kein Brotrest darf bleiben, kein Krümel in einer Lade oder Hosentasche. Am Vorabend des Festes, wenn das Großrei- nemachen schon vorbei ist, durchsucht der Hausvater als Verantwortlicher nach einem Segensspruch mit den Kindern die Wohnung nach letzten Res- ten von Gesäuertem nicht nur Brot und Backwaren, sondern z.B. auch Bier- entfernt, nichtjüdischen Nachbarn geschenkt, im Notfall verbrannt werden. Geschirr, das mit Gesäuertem verwendet wurde, wird mit kochen- dem Wasser koscher...“15
8.3. Der Sederabend
Am Sederabend, sieht der festlich gedeckte Tisch so aus:16
- drei ungesäuerte Brote (Mazzen), die man teils nach der Gliederung des Volkes als Priester, Leviten und Israel bezeichnet, teils als das zweifache Brot wie sonst am Sabbat und Festtag betrachtet, zu dem als drittes das ´Brot des Elends` in Ägypten hinzukommt, das zerbrochen wird, um es von den anderen zu unterscheiden;
- Kräuter, z.B. Petersilie oder Sellerie, die früher gewöhnlich als Deli- katesse oder als Appetitanreger verwendet wurden (Karpas) und
- Salzwasser, in das man die Kräuter vor dem Essen tunkt;
- Bitterkräuter (Endivien, Meerrettich o.ä.) und
- Charoset, eine Mischung von Äpfeln, Mandeln, Gewürz und Wein, in die man die Bitterkräuter tunkt und die der Talmud einmal als medizinisches Mittel gegen die Wirkung der Bitterkräuter beurteilt, ein anderes Mal als Symbol für die Ziegel und den Lehm, aus dem die Israeliten die Ziegel anfertigten mußten;
- ein Knochen mit wenig Fleisch daran und
- ein Ei -beide geröstet und Symbol für die ´zwei Gerichte`, die in der Zeit des Tempels üblich waren: das Passa-Opfer und das Festopfer
- vier Becher Wein, die an diesem Abend getrunken werden
Der Ablauf des Sederabends:17
1. Der Hausvater spricht den Segen über den ersten Becher Wein.
2. Er wäscht seine Hände mit Wasser.
3. Er tunkt von den Kräutern in das Salzwasser, ißt nach einem Segens- spruch davon und reicht sie den Tischgenossen, die ebenfalls einen Segen sprechen.
4. Er teilt von den drei ungesäuerten Broten eines in zwei ungleiche Stü- cke. Der größere Teil wird eingehüllt und zur Seite gelegt. Erst am Ende essen es die Teilnehmer als Nachspeise. Sinn dieses Brauches ist, daß die Mahlzeit mit Ungesäuertem beendet wird.
5. Nun verliest der Hausvater die Geschichte der Befreiung aus Ägypten.
Die Tischgemeinschaft wird miteinbezogen, indem sie sich mit der Erzählung stark identifiziert. Der jüngste Teilnehmer stellt die Frage: „Wodurch unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen Nächten?“ Der Hausvater antwortet, indem Stationen der Heilsgeschichte in Er- innerung gerufen werden.
6. Nach dem Segen über den zweiten Becher Wein waschen die Teil- nehmer ihre Hände.
7. Es folgen Segenssprüche über das ungesäuerte Brot. Der Hausvater ißt von einem der Mazzen.
8. Nach einem Segen über das Bitterkraut wird es eine Art Sirup (Chara- set) getrunken und gegessen.
9. Man nimmt Mazze und Bitterkraut und ißt sie.
10. Nun folgt das eigentliche Mal.
11. Als Nachspeise wird das zur Seite gelegte Stück Mazze verzehrt.
12. Ein Tischgebet wird gesprochen und der dritte Becher Wein gesegnet und getrunken.
13. Nach einem Psalmengesang segnet man den vierten Becher Wein und beendet mit ihm den Weingenuß.
14. Mit weiteren Gesängen ist der Sederabend beendet.
9. Das Wochenfest - Schavuot
Der Name „Wochenfest“ kommt daher, dass es nach Vollendung von sieben Wochen, 50 Tage nach dem Paschafest, gefeiert wir.
Vom Tag nach dem Sabbat, an dem ihr die Garbe für die Darbringung gebracht habt, sollt ihr sieben volle Wochen zählen. (Ex 34,22)
Im jüdischen Kalender 5760/61 findet es am 6. und 7. Sivan statt. Im christlichen Kalender entspricht dieses Datum dem 9. Und 10 Juni 2000 und ist gleichzusetzen mit dem Pfingstfest, welches 50 Tage nach Ostern festgelegt ist. Die Bedeutung dieses Feste ist wieder zweigeteilt. Es ist einmal eine Art Erntedankfest auf die Erstlingsfrüchte von der Weizenernte und zum anderen die Erinnerung an die Gesetzgebung auf dem Berg Sinai.
In der Bibel Ex 34, 22 und Num 28, 26 liest man:
22 Du sollst das Wochenfest feiern, das Fest der Erstlingsfrüchte von der Weizenernte, und das Fest der Lese an der Jahreswende. Num 28, 26
26 Auch am Tag der Erstlingsfrüchte, wenn ihr dem Herrn das Speiseopfer vom neuen Getreide darbringt, an eurem Wochenfest, sollt ihr die heilige Versammlung abhalten; auch an diesem Tag dürft ihr keine schwere Arbeit verrichten;
Das Bundesangebot Gottes -Ex 19,1-25: (Auszüge)
2 Sie waren von Refidim aufgebrochen und kamen in die Wüste Sinai. Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. Dort lagerte Israel gegenüber dem Berg.3 Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden:
5 Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, wer- det ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde,6 ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein hei- liges Volk gehören. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst.
7 Mose ging und rief die Ältesten des Volkes zusammen. Er legte ihnen alles vor, was der Herr ihm aufgetragen hatte.8 Das ganze Volk antwortete einstimmig und erklärte: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes.
17 Mose führte es aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Unten am Berg blie- ben sie stehen.18 Der ganze Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgestiegen. Der Rauch stieg vom Berg auf wie Rauch aus einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte gewaltig,19 und der Hörner- schall wurde immer lauter. Mose redete, und Gott antwortete im Donner.
23 Mose entgegnete dem Herrn: Das Volk kann nicht auf den Sinai steigen. Denn du selbst hast uns eingeschärft: Zieh eine Grenze um den Berg, und erklär ihn für heilig!24 Doch der Herr sprach zu ihm: Geh hinunter, und komm zusammen mit Aaron wieder herauf! Die Priester aber und das Volk sollen nicht versuchen, hinaufzusteigen und zum Herrn vorzudringen, sonst reißt er in ihre Reihen eine Bresche.25 Da ging Mose zum Volk hinunter und sagte es ihnen.
An diesem Berg verlieh Gott den Israeliten die Tora. Die Nacht des Wo- chenfestes steht ganz im Zeichen dieser. „Man liest Anfänge und Enden aller Wochenabschnitte der Tora und dann aller anderen biblischen Bücher, schließlich auch noch die Anfänge aller Traktate der Mischna. Damit betont man die umfassende Einheit der Tora: Nicht nur die zehn Gebote wurden Mose Sinai offenbart, sondern die gesamte Tora; ja auch die ganze übrige Bibel...“18
Im Allgemeinen ist dieses Fest aber kein besonders mit Symbolen und ande- ren besonderen Merkmalen gefeiertes Fest. Es wird lediglich die Synagoge mit Blumen geschmückt, um die Bedeutung als Erntedank auszudrücken19.
10. Das Fest der Ruhe - Sabbat
10.1. Vorbereitungen am Freitag
Sabbat ist der siebente Wochentag, gedacht als Ruhetag für Mensch und Vieh im alten Israel und im heutigen Judentum. Er dauert von Freitagabend bis Samstagabend. Innerhalb der 10 Gebote gibt Gott die Anweisung, den Sabbat zu halten und zu heiligen.
Im zweiten Buch Mose 20, 8 -11 heißt es:
8 Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig!9 Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun.10 Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat.11 Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört; am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt.
Als Vorbereitung am Freitag müssen mindestens drei Mahlzeiten vorbereitet sein:
- die Mahlzeit für den Freitagabend
- das Frühstück am Sabbatmorgen und
- die dritte Sabbatmahlzeit für den Spätnachmittag am Sabbat
Zu allen Mahlzeiten muß Wein bereitgestellt werden. Wer sich für diese Feiertage keinen guten Rotwein leisten kann, nimmt eine billige Sorte oder auch Weißwein. Dazu bäckt man aus Weizenmehl vier Sabbatbrote - die berühmten Challoth. Für jedes Brot werden Teigzöpfe miteinander verfloch- ten. Auf den Brotrücken wird noch ein kleiner, dünner Zopf gelegt. Sie wer- den mit Eiweiß bestrichen oder mit Mohnsamen bestreut. Vom Teig wird nach dem Kneten ein Stückchen abgenommen, ein Segensspruch gesprochen und das Stück wird dem Feuer geopfert.
Im 4. Mose 15, 18 - 21 steht die Begründung dafür:
18 Wenn ihr in das Land kommt, in das ich euch bringe,19 und wenn ihr vom Brot des Landes eßt, dann sollt ihr eine Abgabe für den Herrn entrichten.
20 Als Erstlingsgabe von eurem Brotteig sollt ihr einen Kuchen abgeben. Ihr sollt ihn wie die Abgabe von der Tenne abliefern.21 Von dem ersten Gebäck aus eurem Teig sollt ihr dem Herrn eine Abgabe entrichten, von Generation zu Generation.
Desweiteren wird am Freitag die Wohnung wie zu einem Fest hergerichtet. Alle Geräte werden geputzt und der Tisch wird weiß gedeckt. Man badet und zieht frische Kleidung an. Das Geld und alles andere was man sonst noch in den Taschen hat wird herausgenommen, um sich auf den Sabbat vorzubereiten, an dem nicht gehastet und nicht gearbeitet wird, an dem kein Geschäft und keine Alltagssorgen existieren. Schon sehr früh, noch bevor es dunkel wird, sind alle notwendigen Vorbereitungen abgeschlossen.
10.2. Das Freitagabendgebet
Die Frauen erledigen noch die letzten Handgriffe, während die Männer, Jungen und Mädchen zum Abendgebet gehen.
Für das Abendgebet sind die Lichter heller erleuchtet als an anderen Aben- den, die Gebete sind ausführlicher und feierlicher. Das Abendgebet besteht aus drei Teilen:
Teil 1 - Begrüßung des Sabbat
Es fängt mit Psalmen (95 - 99 und 29) an, die die Vorbeter und die Gemeinde wechselweise vortragen.
In den Psalmen geht es inhaltlich um:
95 Aufruf zur Treue gegen Gott
96 Der Herr, König und Richter aller Welt
97 Aufruf zur Freude über den Herrscher der Welt
98 Ein neues Lied auf den Richter und Retter
99 Der heilige Gott auf dem Zion
29 Gottes Herrlichkeit im Gewitter
Dann folgt das berühmte Schabbatlied Lecha Dodi.
In der letzten Strophe des Lieder heißt es:
Komm, mein Freund, der Braut entgegen, wir wollen den Schabbat empfangen.
Die versammelte Gemeinde wendet sich bei dieser Strophe zum Eingang, verneigt sich und begrüßt so symbolisch die einziehende Sabbat-Braut. Anschließend werden die Psalme 92 und 93 gesprochen.
In den Psalmen geht es inhaltlich um:
92 Ein Loblied auf die Treue Gottes
93 Das Königtum Gottes
Teil 2 - Lob- und Segenssprüche:
Das bedeutendste Gebet der religiösen Juden ist das Schma Israel. Es besteht aus drei verschiedenen Bibelstellen:
- aus Dtn 6 -Die Grundforderung Gottes: Liebe und Furcht- Abschnitte 4 bis 9
- aus Dtn 11 -Bundestreue und Ernte- Abschnitte 13 bis 21
- aus Num 15 -Opfer und Sühne- 37 bis 41
Anschließend werden Bekenntnisse ausgesprochen und ein Gebet um den göttlichen Schutz während der Nacht.
Teil 3 - Das Siebengebet
Die Tefilla, ein Siebengebet, wird leise gesprochen, mit der Bitte um Heiligung des Sabbats. Besonders innig und laut wiederholt werden folgende Abschnitte aus der Bibel (Gen 2, 1 - 3):
1 So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge.2 Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte.3 Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig; denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte.
Nach einem letzten eindrucksvollen Segensspruch geendet man die Zeremonie und wünscht sich zum Abschluß: Schabbat Schalom
10.3. Der Abend im Familienkreis
Zu Hause angekommen beginnt die Feier im Familienkreis. Die Hausfrau prüft noch einmal, ob alles recht geordnet ist und kommt zündet die Kerzen an. Sie hebt die Hände gegen die Lichter und spricht mit geschlossenen Au- gen den Kerzensegen auf hebräisch. Anschließend breitet sie die Hände nach rechts und links aus, um das Sabbatlicht symbolisch in alle Winkel des Zim- Zimmers zu verteilen. Der Hausvater segnet die Kinder mit den Worten:
„Gott mach dich wie Ephraim und Nanasse bzw. Sara, Rebekka und Lea“. Es folgt der Priestersegen (Num 6, 24 -26:
24 Der Herr segne dich und behüte dich.25 Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig.26 Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil.
An diesem Tag wird besonders die Hausfrau mit einem Gedicht gelobt:
„Lob der tüchtigen Hausfrau“
(Spr 31, 10 - 31)
Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie, und es fehlt ihm nicht an Gewinn.
Sie tut ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens.
Sie sorgt für Wolle und Flachs und schafft mit emsigen Händen. Sie gleicht den Schiffen des Kaufmanns:
Aus der Ferne holt sie ihre Nahrung.
Noch bei Nacht steht sie auf, um ihrem Haus Speise zu geben Sie überlegt es und kauft einen Acker, v om Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg.
Sie gürtet ihre Hüften mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie spürt den Erfolg ihrer Arbeit, auch des Nachts erlischt ihre Lampe nicht. Nach dem Spinnrocken greift ihre Hand, ihre Finger fassen die Spindel. Sie öffnet ihre Hand für den Bedürftigen und reicht ihre Hände dem Armen.
Ihr bangt nicht für ihr Haus vor dem Schnee; denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Sie hat sich Decken gefertigt,
Leinen und Purpur sind ihr Gewand.
Ihr Mann ist in den Torhallen geachtet, wenn er zu Rat sitzt mit den Ältesten des Landes. Sie webt Tücher und verkauft sie,
Gürtel liefert sie dem Händler.
Kraft und Würde sind ihr Gewand, s ie spottet der drohenden Zukunft. Öffnet sie ihren Mund, dann redet sie klug, und gütige Lehre ist auf ihrer Zunge. Sie achtet auf das, was vorgeht im Haus, und ißt nicht träge ihr Brot.
Ihre Söhne stehen auf und preisen sie glücklich, auch ihr Mann erhebt sich und rühmt sie: Viele Frauen erwiesen sich tüchtig, doch du übertriffst sie alle.
Trügerisch ist Anmut, vergänglich die Schönheit, nur eine gottesfürchtige Frau verdient Lob. Preist sie für den Ertrag ihrer Hände, ihre Werke soll man am Stadttor loben.
Nun kommt man zur feierlichsten Handlung des Freitagabend. Alle stehen um den Tisch, der wie ein Altar geheiligt wird. Der Hausvater erhebt den Kidduschbecher, der mit Wein bis zum Rand gefüllt ist und spricht den Kiddusch (Segen). Anschließend trinken alle vom Wein und segnet ihn. Dann wäscht man sich die Hände. Jetzt wird das in einem Tuch eingewickelte Brot herausgenommen und gesegnet. Ein Sabbatbrot wird angeschnitten und in Stücke gebrochen. Das Salz, in welches die Brotstücke gestippt wird darf auf dem Tisch nicht fehlen. (3. Mose 2, 13):
3 Jedes Speiseopfer sollst du salzen, und deinem Speiseopfer sollst du das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen; jede deiner Opfergaben sollst du mit Salz darbringen.
Das ist der Beginn der festlichen Malzeit, die sehr reich ist und mindestens einen Gang mehr als an einem Wochentag hat. Nach dem Essen werden zu Ehren des Schabbats Lieder gesungen. Den Abschluß bildet Psalm 126:
2 Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den andern Völkern: «Der Herr hat an ihnen Großes getan.»3 Ja, Großes hat der Herr an uns getan. Da waren wir fröhlich.4 Wende doch, Herr, unser Geschick, wie du versiegte Bäche wieder füllst im Süd- land.5 Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.6 Sie gehen hin unter Tränen und tragen den Samen zur Aussaat. Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Garben ein.
Nach der Mahlzeit sitzt die ganze Familie an diesem Abend zusammen, ent- spannt sich, trinkt Tee oder Kaffe, knabbert Süßigkeiten usw. Es kommt eine Zufriedenheit zum Tragen, die vom Ende einer geschäftigen Woche herrührt. Die verbleibende Zeit wird nicht selten zum Lesen religiöser Bü- cher genutzt.
Die Sabbatruhe geht einher mit dem Verbot von 39 Arten der Arbeit, z.B. Feuer anzünden, einen Knoten binden, backen, reinigen oder schreiben usw.
10.4. Die Toralesungen am Sabbat
Am Sabbattag gibt es drei Gottesdienste, am Morgen, am Nachmittag und am Abend. Alle verlaufen äußerlich gleich. Inhaltlich unterscheiden sie sich durch die verschiedenen Gebete.
So unterteilt sich z.B. das Morgengebet in:
- das erweiterte Morgengebet,
- die Lesung des Torawochenabschnittes mit Hafraralesung (Schlußle- sung) und
- das Musafgebet (Zusatzgebet)
Zum Nachmittagsgebet gehören:
- die Eröffnung mit Psalm 145
- die Keduscha de Sidra -Heiligung des Schriftrollenabschnitts aus der Tora
- die Toralesung selbst und
- das Siebengebet
Das Abendgebet gliedert sich in:
- die Eröffnung mit Psalmen 144 und 67
- das Achtzehn-Bittengebet
- die Keduscha de Sidre -Psalme und Schriftworte der Verheißung, ver- bunden mit der Bitte um Segen für den neuen Tag
- dem Havdala (Unterscheidungssegen)
Der äußerliche Ablauf eines Gottesdienstes sieht so aus:
Der Vorbeter geht zum geöffneten Toraschrein in dem sich vier Schriftrol- len, gehüllt in bestickten Toramäntelchen, befinden und die entsprechende Torarolle heraus. Mit besonderer Feierlichkeit umfängt er sie mit beiden Händen und singt dabei. Die Gemeinde wiederholt dabei Vers um Vers: (5. Mose 6, 4) Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Ebenso feierlich trägt der Vorbeter die Tora zum Leserpult, legt sie darauf und rollt sie auf. Während des gesamten Vorgangs spricht die Gemeinde leise Gebete.
Nun folgt die Vorlesung aus der Tora. Die Tora, die fünf Bücher Mose, ist für die Lesungen in 54 Abschnitte geteilt, so dass für jeden Sabbat des Jahres ein Abschnitt festgelegt ist. Jeder Abschnitt ist, da am Sabbat acht Männer -am Montag und Donnerstag nur drei- zur Toralesung aufgerufen werden, in acht Teilabschnitte gegliedert. Der Aufgerufene tritt vor, betet seinen Segensspruch und liest dann den nächsten Abschnitt. Anschließend wird die zugeordnete Prophetenlesung vorgetragen. Diese wird wieder von Segenssprüchen umrahmt. Sind alle acht aufgerufenen Männer fertig, wird die Tora emporgehoben und zusammengerollt. Wieder mit feierlichen Gesängen vom Vorbeter wird sie in die heilige Lade eingehoben.
Den Abschluß des Gottesdienstes bildet das Zusatzgebet, ein siebenteiliges Gebet, welches zwischen Vorbeter und Gemeinde gesprochen wird.
10.5. Der Samstagabend
Während man am Freitag so früh wie möglich zum Abendgebet geht, um dann schnell zum Sabbat zu kommen, versucht man am Samstag so spät wie es nur geht zum Abendgebet zu kommen, um den Sabbat möglichst lange zu behalten. Das Sabbatende klingt mit dem Havdala (Unterscheidungssegen) aus. Dieser soll die Trennung zwischen der Heiligkeit des Sabbats und dem nachfolgenden gewöhnlichen Tag zum Ausdruck bringen.
Nach dem Gottesdienst muß der Hausvater zu Hause die Havdala wiederho- len.
Zur Havdala sind notwendig:
- Wein oder ein anderes Getränk, etwa Bier oder Milch (nur kein Was- ser), womit man den Becher oder das Glas übervoll gießt (so übervoll möge Gott uns das Maß des Guten für die beginnende Woche messen)
- Bessamin, das sind wohlriechende Gewürze, und zwar mindestens zweierlei Art, gewöhnlich Zimt und Nelken, die in besonderen Beso- mimbüchsen bewahrt werden (die Wohlgerüche sollen die Trauer über das Sabbatende gewissermaßen hinwegscheuchen und Alltagsseele er- quicken, wenn die Sabbatseele uns verläßt)
- die Havdalakerze, gewöhnlich aus gelbem Wachs mit mehreren Doch- ten (breit und hell soll uns die Flamme leuchten)
Alle Anwesenden haben die Pflicht die Havdala zu hören. Dem jüngsten Kind gibt man das Licht zum Halten. Der Hausvater selbst nimmt in die rechte Hand den Becher Wein und in die linke Hand die Besomimbüchse, während er den Vorspruch der Havdala spricht. Dann segnet er das Getränk. Danach stellt der Hausvater den Becher zurück, öffnet die Besomimbüchse, nimmt sie in seine rechte Hand und segnet die Gewürze. Nun riecht und erquickt er sich an ihrem Wohlgeruch und reicht das feine Gefäß den ande- ren herum, bis jeder daran gerochen hat. Seine Hände nähern sich dem Licht, betrachtet diese dort und segnet die Flamme des Lichte. Dann hebt der Hausvater nochmals den Becher und spricht den Unterscheidungssegen:
Lob nun, ja Lob dir o´Gott, unser Gott und König des All, du! Der scheidet Weihe und Welt, das Licht aus Dunkel, dein Volk und die Völker, den siebenten Tag und die sechs Werktage. Lob drum, ja Lob dir o´Gott, der scheidet Weihe und Welt.
Man trinkt nun vom Wein, löscht mit dem Rest des Weins die Kerzen und wünscht sich eine gute Woche.
Quellenangaben
1. Stemberger, Günter: Jüdische Religion; Verlag C. H. Beck; München 1995; 2. Auflage 1996
2. Then, Reinhold: Das Judentum Teil A und B; Religionspädagogisches Seminar der Diözese Regensburg;1991; 3. Auflage 1998
3. Diekmann/Kaden/Schoeps: Jüdisches Leben in Brandenburg; Medienpä- dagogisches Zentrum; 1996
4. Czech/Loth/Trzaskalik/Tworuschka: Judentum; Verlage Diester- weg/Kösel;1978
5. Fromm, Erich: Das jüdische Gesetz;Wilhelm Heyne Verlag München; Schachbuch-Nr. 19/5053; 1996
6. Schweer/Braun: Religionen der Welt; Wilhelm Heyne Verlag München; Sachbuch_Nr. 19/4077; 4. Auflage 1995
7. Nachum T. Gidal: Die Juden in Deutschland von der Römerzeit bis zur Weimarer Republik; Könemann Verlagsgesellschaft mbH; 1997
8. NEOMEDIA Verlagsgesellschaft mbH: Lebnsgestaltung 2; Lehr- und Lernmittel 1995
9. Elaine MCCreery: Religionen kenn lernen - Judentum (ab Klasse 5); Ver- lag an der Ruhr 1998
[...]
1 vgl. „Das Judentum“, Religionspädagogisches Seminar der Diözese Regensburg, 3. Auflage 1998, S. 104 ff
2 Nachum T. Gidal: Die Juden in Deutschland von der Römerzeit bis zur Weimarer Republik; Könemann Verlagsgesellschaft mbH; 1997, S. 188
3 s.o. S. 188/189
4 vgl. „Das Judentum“, Religionspädagogisches Seminar der Diözese Regensburg, 3. Auflage 1998, S. 134
5 Schweer/Braun: Religionen der Welt; Wilhelm Heyne Verlag München; Sachbuch_Nr. 19/4077; 4. Auflage 1995, S. 270
6 Stemberger, Günter: Jüdische Religion, C. H. Beck`sche Verlagsbuchhandlung, München 1995. S. 39
7 „Das Judentum“, Religionspädagogisches Seminar der Diözese Regensburg, 3. Auflage 1998, S. 149
8 Weltreligionen: Judentum, Diesterweg-Kösel-Verlag, 1978,S. 58
9 vgl. „Das Judentum“, Religionspädagogisches Seminar der Diözese Regensburg, 3. Auflage 1998, S. 40 u. 138
10 Then, Reinhold: Das Judentum Teil A und B; Religionspädagogisches Seminar der Diözese Regensburg;1991; 3. Auflage 1998, S. 149
11 Stemberger, Günter: Jüdische Religion; Verlag C. H. Beck; München 1995; 2. Auflage 1996, S. 40
12 Czech/Loth/Trzaskalik/Tworuschka: Judentum; Verlage Diesterweg/Kösel;1978, S. 59
13 Then, Reinhold: Das Judentum Teil A und B; Religionspädagogisches Seminar der Diözese Regensburg;1991; 3. Auflage 1998, S. 136
14 Czech/Loth/Trzaskalik/Tworuschka: Judentum; Verlage Diesterweg/Kösel;1978, S. 146
15 Stemberger, Günter: Jüdische Religion; Verlag C. H. Beck; München 1995; 2. Auflage 1996, S. 36
16 Then, Reinhold: Das Judentum Teil A und B; Religionspädagogisches Seminar der Diözese Regensburg;1991; 3. Auflage 1998, S. 141f
17 Then, Reinhold: Das Judentum Teil A und B; Religionspädagogisches Seminar der Diözese Regensburg;1991; 3. Auflage 1998, S. 142f
18 Stemberger, Günter: Jüdische Religion; Verlag C. H. Beck; München 1995; 2. Auflage 1996, S. 87
Häufig gestellte Fragen
Was ist der jüdische Kalender und wie funktioniert er?
Der jüdische Kalender wurde um das Jahr 350 n. Chr. festgelegt und richtet sich nach den Mondphasen. Dies führt zu einer Verschiebung gegenüber dem Sonnenzyklus, die durch das Einfügen eines Schaltmonats (Adar II) in bestimmten Jahren ausgeglichen wird. Die Jahreszählung basiert auf der Berechnung des Zeitpunkts der Weltschöpfung im Alten Testament; man addiert 3760 zur Jahreszahl des Gregorianischen Kalenders, um die jüdische Jahreszahl zu erhalten.
Welche jüdischen Feste werden im Kalender erwähnt?
Die im Kalender erwähnten Feste sind Rosch Haschana (Neujahrsfest), Jom Kippur (Versöhnungstag), Pascha, Schavuot (Wochenfest), Sukkot (Laubhüttenfest), Simchat Tora (Fest der Gesetzesfreude), Chanukka (Lichterfest) und Purim (Losfest).
Was ist Rosch Haschana und wie wird es gefeiert?
Rosch Haschana bedeutet "Kopf des Jahres" und eröffnet die "Zehn Bußtage". Es ist eine Zeit der Rückschau, Rechenschaft und Vorsätze für das kommende Jahr. Gläubige tragen weiße Kleidung als Zeichen der Gleichheit vor Gott. Der Schofar (Widderhorn) wird geblasen, um zur Reue aufzurufen.
Was ist Jom Kippur und wie wird es begangen?
Jom Kippur ist der Versöhnungstag, der höchste und heiligste Feiertag der Juden, auch als "Sabbat der Sabbate" bekannt. Es ist ein Fasttag, an dem man sich mit Gott und seinen Mitmenschen versöhnen soll. Alle Gläubigen tragen weiße Gewänder, und es werden Bußgebete und Sündenbekenntnisse gesprochen. Der Hohepriester entsühnt sich, die Priester und das Volk.
Was ist das Laubhüttenfest (Sukkot) und was sind seine Ursprünge?
Sukkot ist ein Erntedankfest und erinnert an die Zeit der Wüstenwanderung. Es dauert sieben Tage. Während dieser Zeit sollen die Juden in Hütten wohnen. Die Hütte soll an die Behausung der Vorfahren während der Wanderung durch die Wüste erinnern.
Was ist Chanukka und warum wird es gefeiert?
Chanukka ist ein achttägiges Lichterfest, das an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels unter Judas Makkabäus im Jahr 164 v. Chr. erinnert. Die Geschichte des Lichts bezieht sich auf ein Wunder: Nur ein Krug mit Öl reichte für acht Tage, normalerweise nur für einen Tag. Jeden Tag wird ein Licht auf dem achtarmigen Leuchter angezündet.
Was ist Purim und wie wird es gefeiert?
Purim ist ein Losfest. Es beruht auf dem "Buch Ester". Es wird gefeiert, um die Rettung der Juden im Perserreich vor dem Judenfeind Haman zu feiern. Das Fest wird mit Fasten, Lesen des Buches Ester in der Synagoge, Festspielen, Umzügen und dem Verteilen von Geschenken gefeiert. Der Name Haman wird bei der Lesung durch laute Geräusche übertönt.
Was ist das Paschafest und woran erinnert es?
Pascha bedeutet "Vorübergang, Verschonung" und erinnert an den Auszug aus Ägypten und ist ein Früherntefest. Man darf kein gesäuertes Brot essen, und es darf auch kein gesäuertes Brot im Haus sein.
Was ist Schavuot und was wird gefeiert?
Schavuot wird 50 Tage nach Pascha gefeiert. Es ist eine Art Erntedankfest und erinnert an die Gesetzgebung auf dem Berg Sinai.
Was ist der Sabbat und wie wird er begangen?
Der Sabbat ist der siebente Wochentag und ein Ruhetag für Mensch und Vieh. Er dauert von Freitagabend bis Samstagabend. Am Freitag werden Mahlzeiten vorbereitet, und die Wohnung wird für den Sabbat hergerichtet. Die Frau zündet die Kerzen an und betet. Es gibt Lesungen aus der Tora.
- Quote paper
- Simone Zöllner (Author), 1999, Kalender und Feiertage der jüdischen Religion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103783