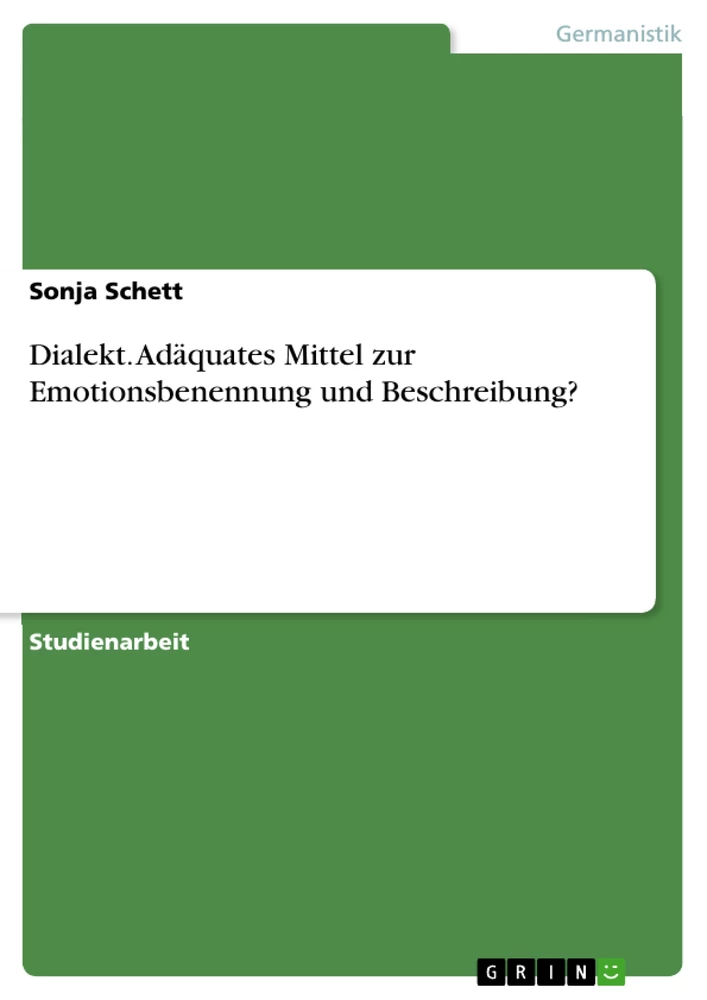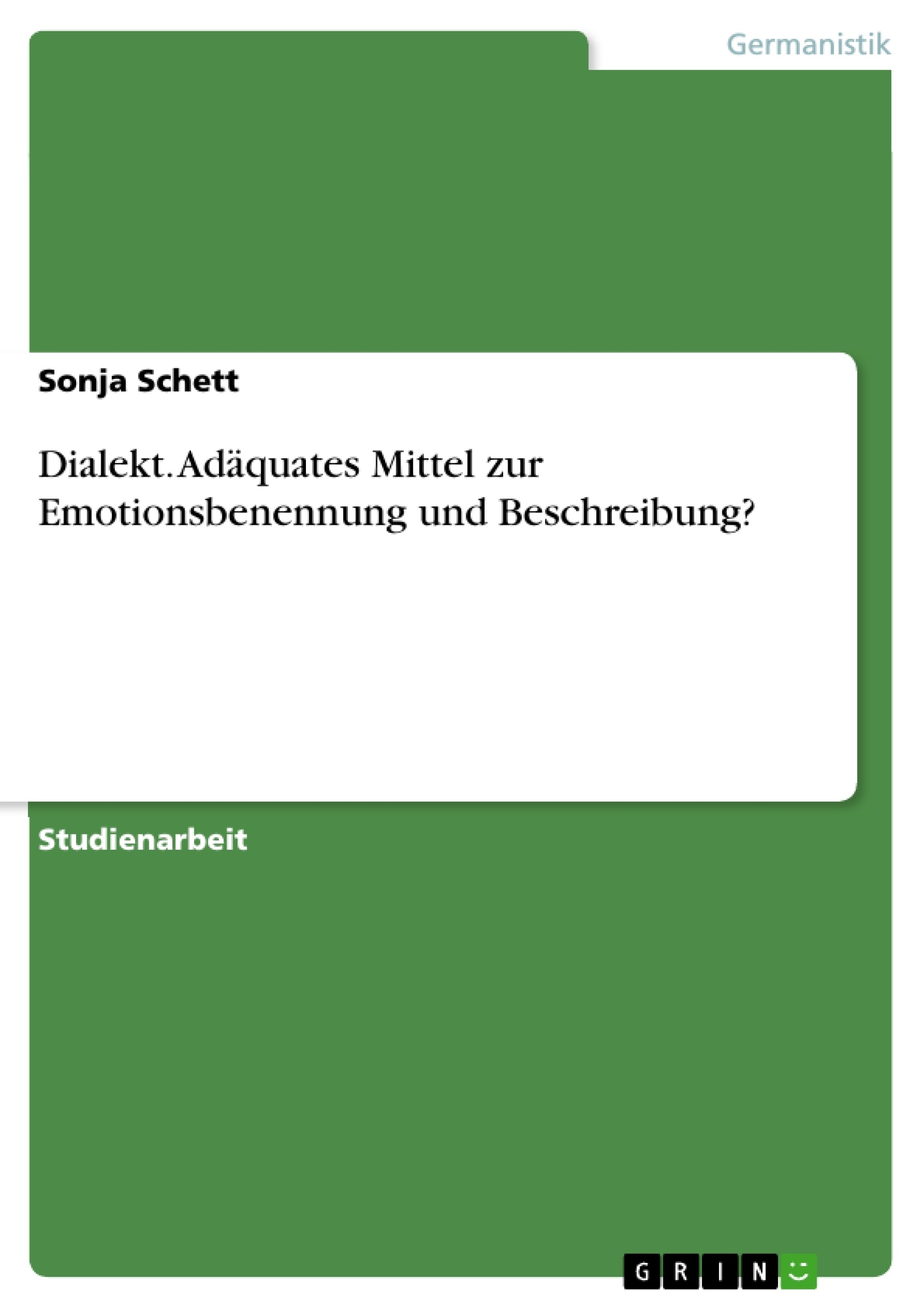Haben Dialekte ausgedient, wenn es um das Ausdrücken tiefster Gefühle geht, oder offenbaren sich gerade in ihnen die authentischsten Emotionen? Diese intriguerende Frage steht im Zentrum dieser linguistischen Untersuchung, die sich auf eine spannende Spurensuche nach dem Emotionswortschatz im Dialekt begibt. Anhand einer empirischen Studie, die sowohl dialektale als auch standardsprachliche Äußerungen analysiert, wird der Frage nachgegangen, inwiefern der Dialekt als adäquates – oder sogar überlegenes – Mittel zur Benennung und zum Ausdruck von Emotionen dienen kann. Die Studie beleuchtet nicht nur die lexikalische Vielfalt und Eigenheiten des Dialekts im emotionalen Kontext, sondern untersucht auch, welche Rolle affektive Redewendungen, Empfindungswörter und emotionale Interjektionen spielen. Dabei werden die subjektiven Einschätzungen der Sprecher ebenso berücksichtigt wie der linguistische Status des Dialekts im Verhältnis zur Standardsprache. Ob Wut, Freude, Trauer oder Überraschung – wie klingt Emotion im Dialekt, und welche sprachlichen Besonderheiten prägen den Gefühlsausdruck? Die Ergebnisse dieser Arbeit bieten faszinierende Einblicke in die emotionale Sprachlandschaft des Dialekts und liefern wertvolle Erkenntnisse für die Sprachwissenschaft, die Psycholinguistik und alle, die sich für die facettenreiche Beziehung zwischen Sprache und Gefühl interessieren. Eine fesselnde Lektüre für alle, die sich fragen, ob ein "gscheids Diandl" wirklich "liab" sein kann und ob man seine "Wut" besser auf "oidaweis" Art rauslässt. Tauchen Sie ein in die vielschichtige Welt des emotionalen Dialekts, und entdecken Sie, wie unsere Gefühle unsere Sprache prägen – und umgekehrt. Welche Rolle spielen regionale Unterschiede und soziale Kontexte bei der Verwendung des Dialekts zur Artikulation von Emotionen? Diese essentielle Lektüre bietet nicht nur einen Überblick über die theoretischen Grundlagen der Emotionsforschung und Dialektologie, sondern präsentiert auch eine detaillierte Analyse konkreter Sprachdaten, die verblüffende Einblicke in die komplexen Zusammenhänge zwischen Dialekt, Emotion und Identität gewährt.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Dialekt und Emotion. Ein Beispiel.
2. Einleitung
3. Definitionen
3.1. Emotion
3.2. Dialekt
4. Methodik
4.1. Stichprobe
4.2. Datenerhebung mittels schriftlicher Befragung
4.3. Kategorien für die Erfassung des Emotionswortschatzes
5. Darstellung des Emotionswortschatzes
6. Analyse der Daten. Beschreibende Statistik.
6.1. Ergebnis in absoluten Zahlen
6.1.1. Beschreibung/Interpretation
6.2. Emotionsbenennung im Verhältnis zu Emotionsausdruck
6.2.1. Beschreibung/Interpretation
6.3. Emotionswortschatz im Detail
6.3.1. Beschreibung/Interpretation
6.4. Gesamte Nennungen in Prozent
6.4.1. Beschreibung/Interpretation
7. Dialekt, Umgangssprache oder Standardsprache?
7.1. Umgangssprachliche und dialektale Elemente in den
hochsprachlichen Texten
7.2. Dialekt oder Variantenvielfalt?
8. Zusammenfassung
Anhang
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Dialekt und Emotion. Ein Beispiel.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten1
2. Einleitung
„Du musst darüber reden, dann geht’s Dir besser“ – Ein Satz, den wir immer wieder als gut gemeinten Rat von Freunden, Eltern, Partnern... hören. Die „Ratgeber“ sind selbsternannte „Laienpsychologen“, die davon überzeugt sind, dass man über Gefühle (eben darüber) reden sollte. Dass das nicht immer ganz einfach ist, stellen wir spätestens dann fest, wenn wir diesem Rat Folge leisten und uns im sprichwörtlichen Sinne auf die „Couch“ begeben. Wie sagt man, was man fühlt? Was hält unser Sprachrepertoire für solche Fälle bereit? Und - was uns im Rahmen dieser Arbeit besonders interessiert: Redet mann/frau im Dialekt, wenn die Emotionen hochgehen, oder bietet die Standardsprache das nötige Inventar?
Wir wollen im Laufe dieser Arbeit der Frage nachspüren, ob Dialekt ein adäquates Mittel ist, um Emotionen zu benennen und auszudrücken.
Zunächst wollen wir einmal annehmen, dass der Dialekt zumindest ein adäquates sprach- liches Mittel darstellt. Vielleicht ist er sogar besser dazu geeignet, über Gefühlsangelegen- heiten zu sprechen? Aufgrund rein subjektiver Erfahrung (auch wir haben schon über Gefühle gesprochen – vorwiegend im Dialekt), aber auch aufgrund der Merkmale des linguistischen Begriffes „Dialekt“ (siehe Abschnitt 3), formulieren wir folgende Arbeitshypothese:
Dialekt stellt ein adäquates sprachliches Mittel dar, um Emotionen zu benennen und auszudrücken. Darüber hinaus wird in weiten Teilen Österreichs dem Dialekt der Vorzug gegeben, wenn man Gefühle nicht nur benennt, sondern sie sprachlich ausdrückt.
Ob sich diese These halten lässt, soll eine Untersuchung zeigen, die wir mit den Teilnehmern des Seminars durchgeführt haben. Zu Beginn möchten wir den Begriff „Dialekt“ näher klären und die Fachliteratur heranziehen, um unsere Hypothese zu stützen. In Abschnitt 4 geben wir dann einen Einblick in das methodische Vorgehen bei unserer Untersuchung. Im Hauptteil der Arbeit stellen wir unsere kleine Forschungsstudie vor, zeigen wie der Emotionswortschatz kategorisiert wurde und präsentieren schließlich eine beschreibende Statistik. Die Untersuchung ist so angelegt, dass wir sowohl dialektale als auch standardsprachliche2 Daten erhalten. Ein Vergleich sollte zeigen, welche Sprachebene wieviel leistet, wenn Emotionen unser Sprechen beeinflussen.
„Hochsprache“, da dieser der tatsächlichen Sprachwirklichkeit besser gerecht wird.
3. Definitionen
3.1. Emotion
Den bereits im Seminar besprochenen Definitionen möchten wir an dieser Stelle eine Definition aus einem der Standardwerke der Allgemeinen Psychologie hinzufügen:
„Emotion: Komplexes Muster von Veränderungen, das physiologische Erregung, Gefühle, kognitive Prozesse und Verhaltensweisen einschließt, die in Reaktion auf eine Situation auftreten, welche als persönlich bedeutsam wahrgenommen worden ist.“3
3.2. Dialekt:
Dialekt wird einerseits als „Phänomen der deutschen Sprachwirklichkeit“ und andererseits als4
„Begriff der germanistischen Linguistik“ verstanden.5 Löffler geht zunächst der geschicht- lichen Entwicklung der Begriffe „Dialekt“ und „Mundart“ nach. „Sowohl im wissenschafts- sprachlichen als auch im umgangssprachlichen Gebrauch wurden jedoch bereits im 19. Jh. beide Ausdrücke synonym verwendet.“6
Löffler versucht, einer Definition von „Dialekt“ bzw. „Mundart“ durch das Aufzeigen von mehreren Merkmalsbereichen (Aspekten) näher zu kommen und trifft dabei die Voraussetzung, dass „der Dialektbegriff [...] immer relational zu Nicht-Dialekt zu bestimmen“ ist.7 Wollen wir die Leistungsfähigkeit von Dialekt im Rahmen emotionalen Sprechens beurteilen, ist es deshalb unumgänglich, den Vergleich mit der Standard- bzw. Hochsprache anzutreten.
Mit folgenden Merkmalen versucht Löffler, den Begriff „Dialekt“ näher zu bestimmen:
a) „genetisch-historischer Aspekt“
„Dialekt ist [...] Begriff einer historisch-systematischen Gliederung einer Sprache oder einer Sprachfamilie [...]“8
b) räumliche Verbreitung – geographische Lagerung (Dialektographie)
Die Dialektographie beschäftigt sich mit Fragen der Existenz von Dialekträumen und deren Grenzen, der Benennung der Sprachareale und der Außenumgrenzung und Binnengliederung von Großdialekten.9
c) Verwendungsebene – Benutzerschichten
Dialekt definiert sich nicht zuletzt über seine Verwendungsebene und seine Benutzer. Löffler konstatiert mehrere Kriterien von Dialekt, die sich im Laufe der Forschungsgeschichte herauskristallisiert haben10:
- Dialekt ist „die Sprache der ungekünstelten Natürlichkeit“
- Dialekt definiert sich über „Mündlichkeit“ („Mundart“ als Komplement zu „Schreibart“)
- Dialekt behandelt „Themen des gewöhnlichen einfachen Lebens von geringem Öffentlichkeitsgrad“
- „Dialekt ist auf momentane Spontaneität und Gesprochenheit hin angelegt“
Betrachten wir diese Merkmale von Dialekt im Hinblick auf unsere Untersuchung, dann dürfen wir annehmen, dass auch emotionales Sprechen vorwiegend im Dialekt erfolgt. Entsprechend sollten die Ergebnisse zugunsten der Dialektproben ausfallen. Ohne psychologisieren zu wollen, stellen wir fest, dass Emotionalität etwas „Natürliches“ ist, nicht vordergründig der Öffentlichkeit zugänglich ist, im mündlichen Verkehr eine wesentliche Rolle spielt und ein wichtiges „Thema des gewöhnlichen Lebens“ darstellt. Da Emotionen laut vorangehender Definition „als Reaktion auf eine Situation auftreten“, darf auch Spontaneität vorausgesetzt werden
– ein weiteres Merkmal von Dialekt!
d) linguistischer Status
„Der linguistische Status des Dialekts hängt am meisten vom komplementären System der Hochsprache [...] ab.“11 Je größer die Distanz zur „Übersprache“, desto eher kann von Dialekt gesprochen werden. „Im Extremfall ist Dialekt ein eigenes Sprachsystem mit eigener, insbesondere phonologischer Struktur, mit eigenen morphologischen Systemen (Flexion) oder zumindest exklusiver Besetzung der Strukturen (im Wortbildungsbereich) und eigenen Restriktionen im Syntaxbereich und einer teilweise umfassenden lexikalischen Sonderausstattung mit nur geringer Gemeinsamkeit im sogenannten Funktions- oder Basiswortschatz.“12
In den von uns untersuchten Dialektproben müssten wir demzufolge beim Erfassen des Emotionswortschatzes lexikalische Sonderausstattung vorfinden, die sich mit Hilfe diverser Dialekt-(Mundart-)Wörterbücher nachweisen lässt.
e) kommunikative Leistungsfähigkeit
Die kommunikative Leistungsfähigkeit des Dialekts im Rahmen von emotionalem Sprechen zu beweisen oder zu widerlegen, sollte das Ziel dieser Arbeit sein.
Löffler trifft eine wesentliche Unterscheidung. Die kommunikative Leistungsfähigkeit des Dialekts ist abhängig vom „Ausbau der einzelnen sprachlichen Ebenen“. Ausbau meint demnach die linguistische Ausstattung einer Sprachebene. Im besten Fall ist Dialekt ein vollausgebautes System mit der gleichen kommunikativen Leistungsfähigkeit wie die Einheitssprache. Bei hohem Verbreitungsgrad und gehobenem Sozialprestige kann Dialekt der Einheitssprache sogar überlegen sein. Ein Dialekt mit defizitärer linguistischer Ausstattung muss Lücken durch hochsprachliche Elemente komplettieren und gilt demnach als „kommunikativ restringierter Sprechcode“. Der linguistische „Ausstattungsgrad“ ist abhängig von pragmatischem Status, Größe des Benutzerkreises und der Häufigkeit der Verwendung.13
Die Probanden unserer Untersuchung stammen zum größten Teil aus Gebieten Tirols. Sowohl Benutzerkreis, pragmatischer Status und Häufigkeit der Verwendung lassen auf ein vollausgebautes Dialektsystem schließen, da der Dialekt in Tirol zudem über ein hohes Sozialprestige verfügt. Die volle kommunikative Leistungsfähigkeit müsste sich also in der Untersuchung bestätigen.
f) subjektive Einschätzung
Eine interessante Feststellung Löfflers ist der Aspekt der subjektiven Definition von Dialekt. Neben objektiv feststellbaren Merkmalen spielt es eine Rolle, ob Sprache und was daran als Dialekt zu gelten hat. Die subjektive Einschätzung drückt eine soziale Wertschätzung des Dialekts aus.14 Vielleicht kann dieser Punkt erklären, warum es der Forschung so schwer fällt, eine eindeutige Definition von Dialekt zu liefern.
Die genannten Merkmalsbereiche erlauben zwar keine allgemeine Definition des Begriffes
„Dialekt“ – dennoch fügt Löffler seinen Ausführungen eine Definition an:
„Mundart ist stets eine der Schriftsprache vorangehende, örtlich gebundene, auf mündliche Realisierung bedachte und vor allem die natürlichen alltäglichen Lebensbereiche einbeziehende Redeweise, die nach eigenen, im Verlauf der Geschichte durch nachbar-mundartliche und hochsprachliche Einflüsse entwickelten Sprachnormen von einem großen heimatgebundenen Personenkreis in bestimmten Sprechsituationen gesprochen wird.“15
4. Methodik
- Auswahl der Stichprobe
- Erhebung der Sprachdaten mittels schriftlicher Befragung
- Transkription der handschriftlichen Sprachproben
- Datenanalyse mit Hilfe eines Kategorienschemas
- Beschreibung bzw. Interpretation
4.1. Stichprobe
Die für unsere Untersuchung gewählte Stichprobe umfasst die Teilnehmer des Seminars
„Sprache und Emotion“, abgehalten im WS 1997/98. Streng statistisch gesehen, ist die Stichprobe nicht relevant (keine Zufallsstichprobe!). Da zum Zeitpunkt der Erhebung einige Seminarteilnehmer fehlten, war auch keine Vollerhebung für die Gruppe möglich. Die Stichprobe setzt sich aus Probanden unterschiedlicher Herkunftsorte, unterschiedlichen Alters und unterschiedlichen Geschlechts zusammen. Homogen zeigt sich die Gruppe insofern, als es sich nur um Studenten handelt.
Aufgrund dieser Tatsachen, kann eine Analyse des Datenmaterials nur Aufschluss über die Sprachgewohnheiten dieser Versuchsgruppe geben. Rückschlüsse auf eine vielschichtigere Sprachgemeinschaft, wie sie uns in der Realität begegnet, sind nicht möglich.
Was kann die Untersuchung dennoch leisten:
Eine beurteilende Statistik ist aufgrund der fehlenden Voraussetzungen nicht möglich. Möglich ist jedoch eine beschreibende Statistik, die vielleicht Tendenzen erkennen lässt, die in einer statistisch relevanten Untersuchung geprüft werden könnten.
4.2. Datenerhebung mittels schriftlicher Befragung
Da Dialekt laut vorangehender Definition (vgl. Abschnitt 3.2.) vorwiegend dem mündlichen Gebrauch vorbehalten ist, bieten sich für eine Datenerhebung Methoden der Gesprächslinguistik an:
Um für unsere Untersuchung relevante Daten zu erhalten, war es notwendig, bestimmte Äußerungen zu provozieren. Ein standardisierter Text sollte den „Stimulus“ für die sprachlichen Reaktionen der Probanden bilden. Diese Methode des „elicting“ wird in der
Gesprächslinguistik angewendet, damit „[...] Informanten gezielt zur Produktion von Äußerungen angeregt werden."16
Textvorlage für die Befragung:
Stelle dir bitte folgende Situation vor:
Du hast ein Seminar besucht. Die schriftliche Arbeit musste zu einem bestimmten Termin abgegeben werden. Dabei war die Zeit relativ kurz bemessen. Nach Ablauf der Frist aber wäre die Arbeit vom Professor / von der Professorin nicht mehr angenommen worden. Das war sehr stressig für dich. Du hast dich also sehr bemüht und konntest die Seminararbeit gerade noch rechtzeitig abliefern. - Nun sind schon zwei Monate ins Land gezogen. Du brauchst dringend das Zeugnis. Doch der / die Prof. lässt nichts von sich hören. Die einzige Antwort, die du auf deine Nachfragen erhältst, lautet: „Bald!“ – und das schon seit knapp einem Monat.- Einem Studienkollegen erzählst du, was du jetzt fühlst.
Die Teilnehmer des Seminars wurden dann von uns aufgefordert, schriftlich Stellung zu nehmen. Zwei Gruppen wurden gebildet: Die Versuchspersonen der ersten Gruppe sollten hochsprachlich antworten, die der zweiten Gruppe in ihrem jeweiligen Dialekt. Die Gruppen wurden von uns so eingeteilt, dass acht Personen hochsprachlich und neun Personen im Dialekt antworten sollten. Da die Seminarteilnehmer unseren Anweisungen leider nicht so genau Folge geleistet haben, hat sich letztlich eine Ungleichverteilung ergeben (Hochsprache: 7 Personen, Dialekt: 10 Personen).
Jürgen Eichhoff weist auf die Problematik der schriftlichen Befragung hin, vor allem da „die Aufzeichnung [...] mit Hilfe des gewöhnlichen Alphabets in ‚Laienschreibung‘ erfolgen“ muss.17 Da es in unserer Untersuchung aber vorrangig um eine Wortschatzuntersuchung geht, kann eine schriftliche Erhebung „brauchbare“ Daten liefern.18Außerdem dürfen wir davon ausgehen, „[...] daß die Antwort in der großen Mehrzahl der Fälle der sprachlichen Norm entspricht, die in der Kommunikationsgemeinschaft, der der Sprecher angehört, anerkannt ist.“19
Eine Einschränkung muss jedoch auch hier gelten: Der vorgelesene Text zielt auf ganz bestimmte Emotionen ab. Die Situation, die sich die Seminarteilnehmer vorstellen sollten, ruft Ärger, Wut, Zorn – kurz: Unmutsgefühle - hervor. Der Gefühlswortschatz, den wir aus diesen Sprachzeugnissen erhalten, ist also jener der Gefühle Ärger, Wut, Zorn... Alle Aussagen und Ergebnisse, die aus dem Datenmaterial gewonnen werden, können sich somit nur auf die sprachliche Darstellung dieser Gefühle beziehen. Wieweit die Ergebnisse im Hinblick auf emotionales Sprechen im Allgemeinen gedeutet werden können, lässt sich von uns hier nicht festgestellen.
4.3. Kategorien für die Erfassung des Emotionswortschatzes
Um den Emotionswortschatz unserer Textproben zu erfassen und auswerten zu können, ist es nötig, ein Schema zu entwickeln, das möglichst alle sprachlichen Elemente erfasst, die Emo- tionen benennen oder ausdrücken. Wir halten uns dabei an die im Seminar besprochenen Autoren und lehnen uns im Besonderen an Fritz Hermanns an. Dem Trend folgend, dass bei allen im Seminar behandelten Autoren20zwischen „Emotion bezeichnenden“ (Péter), „nicht- egologischen“ (Jäger/Plum), „beschreibenden“ (Hermanns), „Emotion thematisierenden“ (Fiehler) Wörtern einerseits und „Emotion ausdrückenden“ Wörtern und Wendungen Hermanns, Fritz: Kognition, Emotion, Intention. Dimensionen lexikalischer Semantik. In: Gisela Harras (Hrsg.): Die Ordnung der Wörter. Kognitive und lexikalische Strukturen. Berlin – New York 1995. (= Institut für deutsche Sprache; Jahrbuch 1993). S. 138 – 178.
Jäger, Ludwig / Plum, Sabine: Historisches Wörterbuch des deutschen Gefühlswortschatzes. Theoretische und methodische Probleme. In: Jäger, Ludwig (Hrsg.): Zur historischen Semantik des deutschen Gefühlswortschatzes. Aspekte, Probleme und Beispiele seiner lexikographischen Erfassung. Aachen 1988. S. 5 – 55.
Péter, Mihály: Das Problem des sprachlichen Gefühlsausdrucks in besonderem Hinblick auf das Bühlersche Organon-Modell. In: Eschbach, Achim (Hrsg.): Bühler-Studien. Bd. 1. Frankfurt a.M 1984 (= stw 481). S. 239 – 260. andererseits unterschieden wird, nehmen wir zunächst die zwei Pole Emotionsbenennungen und Empfindungswörter in unser Kategorienschema auf. Da sich die von Hermanns getroffene Einteilung sehr gut eignet, Wörter und Wendungen in Texten (also nicht im Gespräch) zu erfassen, übernehmen wir im Wesentlichen seine Kategorien:
a) Emotionsbenennungen
In dieser Kategorie spricht Hermanns von „quasi-psychologischen Vokabeln“.21 Gemeint sind Vokabeln, die der vordergründig deskriptiven Benennung von Gefühlen dienen. Hermanns zieht den Vergleich der „Diagnose“ heran. „ Peter ist verliebt, das unterscheidet sich, was seine Expressivität betrifft, wohl kaum von Peter ist erkältet. “22Unter die Kategorie „quasi- psychologische Vokabel“ fallen für Hermanns vor allem Wendungen/Sätze, die sich dadurch auszeichnen, „[...] daß im Bühlerschen Modell die Positionen für den Sprecher und die Gegenstände/Sachverhalte gleich besetzt sind; daß der Sprecher selber Gegenstand der eigenen Rede ist, so wie beim du der Hörer.“23 Ein Beispiel dafür wäre der Satz Ich ärgere mich.
Während Hermanns das Verb im Satz Das ärgert mich in die Kategorie „affektive Verben“ einordnen würde, ist dieser Satz auch ein Beispiel für eine „Emotionsbenennung“. Obwohl Hermanns den „quasi-psychologischen Vokabeln“ sekundär die Rolle des Ausdrückens von Gefühlen zuerkennt, ordnet er dennoch Gefühlswörter, die in ihrer besonderen Art eine affektive Haltung ausdrücken, den Kategorien „affektive Adjektive“, „affektive Verben“ usw. zu.24Dadurch wird eine Einteilung für die Datenanalyse sehr schwierig, weil häufig mehrere Zuordnungen möglich wären. Deshalb haben wir immer dann, wenn ein Gefühl benannt wird
– egal ob in Form eines Verbs, Adjektivs oder Substantivs – die Kategorie „Emotionsbe- nennungen“ herangezogen. Dass es sich hier nicht immer um rein deskriptive Emotionsbe- nennung handelt, zeigen die Beispiele in Abschnitt 5.
b) Empfindungswörter
Den Gefühlswortschatz, der primär dem Ausdruck von Gefühlen dient, ordnen wir der Kategorie „Empfindungswörter“ zu. Hermanns nennt unter „Empfindungswörter“ zunächst die „Schimpf-und Kosenamen“ und „Partikeln“. Für alle weiteren expressiven Vokabeln bildet er eigene Kategorien wie „affektive Adjektive“, „kausative Adjektive“, „affektive Substantive“ (worunter wieder die Schimpf- und Kosenamen fallen) und „affektive Verben“.25 In unserem Raster gliedern wir die Kategorie „Empfindungswörter“ weiter auf und fassen darunter „Schimpfnamen“, „affektive Adjektive“, „affektive Verben“ „emotional- expressive Partikeln und Interjektionen“ zusammen. Der Zusatz „affektiv“ meint, dass diese Wörter Emotionen ausdrücken, indem sie dem Schema „x bewirkt, dass ich die und die Gefühle habe“ folgen.26
Auf eine Unterscheidung zwischen „affektiven Adjektiven“ und „kausativen Adjektiven“27 verzichten wir. Unter „kausativen Adjektiven“ versteht Hermanns Partizipien oder partizip- ähnliche Adjektive, die jedoch letztlich ebenso „affektive Adjektive“ sind.28
Da es sich bei den von Hermanns erwähnten Partikeln eigentlich um Interjektionen handelt, haben wir diese Kategorie „emotional-expressive Partikeln und Interjektionen“ genannt.
Gemeint sind Wörter wie „ach“, „pfui“, „au“, die „[...] non-verbal und para-sprachlich eingebunden sind in eine ganzheitliche Zeigehandlung.“29Die Wörter selbst sind im Rahmen einer Sprachhandlung betrachtet Ausdruck einer Emotion. Belege dafür finden sich auch in der Grammatik: „Die Interjektionen können nach dem subjektiven Kriterium der von ihnen ausgedrückten Gefühlswerte (Freude, Schmerz, Zweifel usw.) eingeteilt werden.“30
c) Affektive Redewendungen und Formeln
Emotionales Sprechen geschieht nicht nur durch die Verwendung bestimmter Vokabeln. Oft sind es ganze Phrasen, Redewendungen bzw. formelhafte Wendungen, die dem Ausdruck von Gefühlen dienen. Einer über bloße Wörter hinausreichenden Erfassung des Emotionswort- schatzes wird vor allem Reinhard Fiehler gerecht.31Auch wir haben in unserem Textmaterial mehrfach Redewendungen und formelhafte Wendungen gefunden, die ein Gefühl ausdrücken. Deshalb erweitern wir die Einteilung von Hermanns um die Kategorie „Affektive Redewendungen/Formeln“. Den Zusatz „affektiv“ wählen wir auch hier, weil ebenso in Redewendungen und Formeln der affektive Aspekt zum Tragen kommt.
[...]
1 Trojer, Texte aus dem Nachlaß. S. 132.
2 Im Laufe dieser Arbeit verwenden wir immer wieder den Begriff „Standardsprache“ anstelle von
3 Zimbardo, Psychologie. S. 609.
4 vgl. zu diesem Abschnitt auch Löffler, Gegenstandskonstitution. S. 441 – 462.
5 Löffler, Dialekt. S. 453.
6 Löffler, Dialekt. S. 454.
7 Löffler, Dialekt. S. 454.
8 Löffler, Dialekt. S. 454.
9 vgl. Löffler, Dialekt. S. 454f.
10 Löffler, Dialekt. S. 455.
11 Löffler, Dialekt. S. 455.
12 Löffler, Dialekt. S. 455.
13 vgl. Löffler, Dialekt. S. 456.
14 vgl. Löffler, Dialekt. S. 456
15 Sowinski, zit. nach Löffler, Dialekt. S. 457
16 Brinker / Sager, Linguistische Gesprächsanalyse. S. 13.
17 Eichhoff, Erhebung von Sprachdaten. S. 550.
18 vgl. Eichhoff, Erhebung von Sprachdaten. S. 550.
19 Wiegand/Harras, zit. nach Eichhoff, Erhebung von Sprachdaten. S. 553.
20 Fiehler, Reinhard: Kommunikation und Emotion. Theoretische und empirische Untersuchungen zur Rolle von Emotionen in der verbalen Interaktion. Berlin – New York 1990. (= Grundlagen der Kommunikation und Kognition)
21 Hermanns, Kognition. S. 144.
22 Hermanns, Kognition. S. 145.
23 Hermanns, Kognition. S. 145.
24 vgl. Hermanns, Kognition. S. 147ff.
25 vgl. Hermanns, Kognition. S. 145ff.
26 vgl. Ortner, Lorelies, Thesenblatt / Exzerpt zur Seminarliteratur.
27 vgl. Hermanns, Kognition. S.147ff.
28 vgl. Hermanns, Kognition. S. 149f.
29 Hermanns, Kognition. S. 147.
30 Helbig / Buscha, Deutsche Grammatik. S. 530.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schwerpunktthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Er befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Dialekt und Emotion.
Was sind die Hauptbestandteile des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst Punkte wie Dialekt und Emotion am Beispiel, Einleitung, Definitionen von Emotion und Dialekt, Methodik (Stichprobe, Datenerhebung), Darstellung des Emotionswortschatzes, Analyse der Daten mit beschreibender Statistik, die Rolle von Dialekt, Umgangssprache oder Standardsprache, Zusammenfassung, Anhang und Literaturverzeichnis.
Wie definiert der Text Emotion?
Der Text zitiert eine Definition von Emotion aus einem Standardwerk der Allgemeinen Psychologie als ein komplexes Muster von Veränderungen, das physiologische Erregung, Gefühle, kognitive Prozesse und Verhaltensweisen einschließt, die in Reaktion auf eine Situation auftreten, welche als persönlich bedeutsam wahrgenommen wurde.
Wie wird Dialekt definiert?
Dialekt wird als "Phänomen der deutschen Sprachwirklichkeit" und als "Begriff der germanistischen Linguistik" verstanden. Der Text geht auf die geschichtliche Entwicklung der Begriffe "Dialekt" und "Mundart" ein und betont, dass der Dialektbegriff immer relational zum Nicht-Dialekt zu bestimmen ist.
Welche methodischen Aspekte werden behandelt?
Die Methodik umfasst die Auswahl der Stichprobe, die Erhebung der Sprachdaten mittels schriftlicher Befragung, die Transkription der handschriftlichen Sprachproben, die Datenanalyse mit Hilfe eines Kategorienschemas und die Beschreibung bzw. Interpretation der Ergebnisse.
Welche Hypothese wird in der Einleitung aufgestellt?
Die Arbeitshypothese lautet, dass Dialekt ein adäquates sprachliches Mittel darstellt, um Emotionen zu benennen und auszudrücken. Darüber hinaus wird in weiten Teilen Österreichs dem Dialekt der Vorzug gegeben, wenn man Gefühle nicht nur benennt, sondern sie sprachlich ausdrückt.
Was sind die Kategorien zur Erfassung des Emotionswortschatzes?
Die Kategorien zur Erfassung des Emotionswortschatzes umfassen Emotionsbenennungen, Empfindungswörter (mit Unterkategorien wie Schimpfnamen, affektive Adjektive, Verben, Partikeln und Interjektionen) und affektive Redewendungen und Formeln.
Welche Rolle spielt die Standardsprache im Vergleich zum Dialekt?
Der Text untersucht, ob Dialekt ein adäquates Mittel ist, um Emotionen auszudrücken, im Vergleich zur Standardsprache. Es wird analysiert, welche Sprachebene wie viel leistet, wenn Emotionen unser Sprechen beeinflussen.
Wie wurde die Datenerhebung durchgeführt?
Die Datenerhebung erfolgte mittels schriftlicher Befragung. Die Teilnehmer des Seminars wurden aufgefordert, schriftlich zu beschreiben, welche Gefühle sie in einer bestimmten simulierten Situation empfinden würden. Eine Gruppe sollte in Hochsprache antworten, die andere im Dialekt.
Welche Einschränkungen hat die Untersuchung?
Die Untersuchung hat Einschränkungen, da die Stichprobe nicht statistisch relevant ist und die erhobenen Daten sich auf die Darstellung von bestimmten Emotionen (Ärger, Wut, Zorn) beschränken. Die Ergebnisse sind somit nur auf die Sprachgewohnheiten der Versuchsgruppe beziehbar.
- Quote paper
- Sonja Schett (Author), 1999, Dialekt. Adäquates Mittel zur Emotionsbenennung und Beschreibung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103762