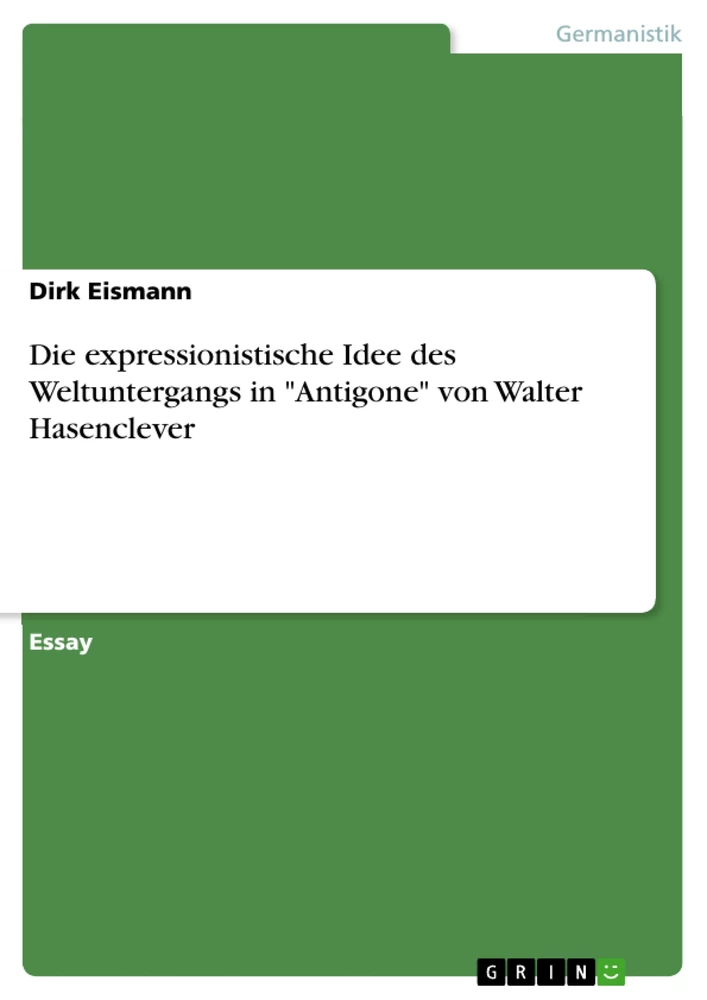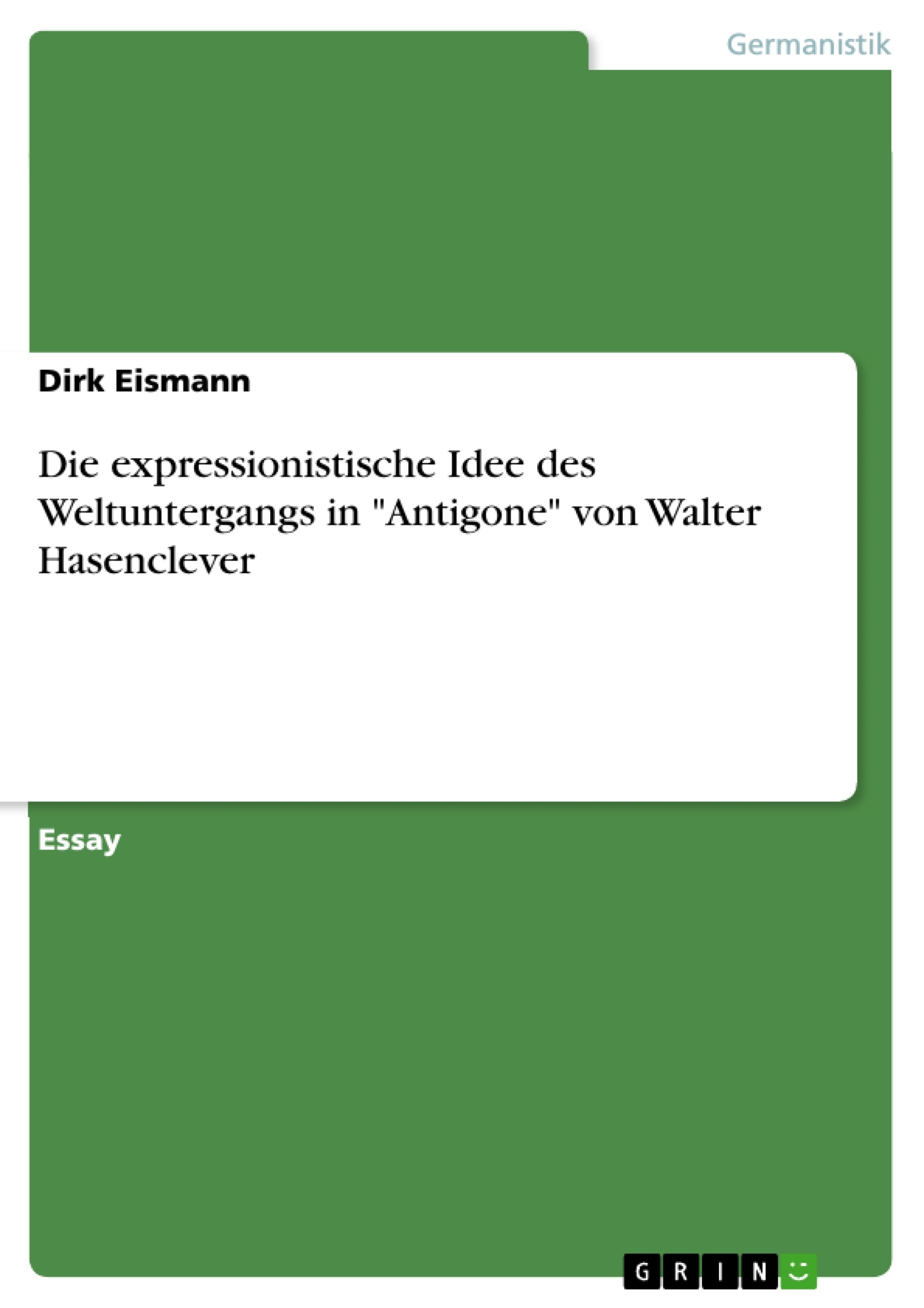Das Werk "Antigone" wurde im Jahre 1917 von Walter Hasenclever geschrieben und ist auf die altgriechische gleichnamige Tragödie des Dichters Sophokles zurückzuführen. Ziel dieser Arbeit es, folgender These nachzugehen: In Walter Hasenclevers "Antigone" findet man die (expressionistische) Idee des Weltuntergangs. Anhand einer Interpretation sollen die Pro- und Contra-Argumente dieser These dargelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung und Themenschwerpunkte
- Zusammenfassung der Kapitel
- Anfang der Geschichte: Der Hass auf das Alte
- Antigone und die Liebe zum Mitmenschen
- Expressionismus und die Idee des Weltuntergangs
- Der Krieg und seine Folgen
- Der Konflikt zwischen Antigone und Kreon
- Schlüsselwörter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Walter Hasenclevers Antigone (1917) mit dem Ziel, die expressionistische Idee des Weltuntergangs im Stück zu beleuchten. Die Analyse soll Pro- und Contra-Argumente dieser These aufzeigen und eine Schlussfolgerung sowie eine Stellungnahme zur zentralen These liefern. Das Werk wird dabei in einem literarischen Kontext analysiert, insbesondere im Hinblick auf den Expressionismus.
- Der Expressionismus und seine Merkmale
- Die Idee des Weltuntergangs in der expressionistischen Literatur
- Der Konflikt zwischen Tradition und Moderne
- Die Rolle des Hasses und der Liebe im Stück
- Die Auswirkungen des Kriegs auf die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Anfang der Geschichte: Der Hass auf das Alte
Die Geschichte beginnt mit einem starken Hass auf das Alte, welcher sich in der Figur des neuen Königs Kreon und seinem Volk manifestiert. Dieser Hass richtet sich gegen den toten Feind Polyneikes, der während des Krieges die Herrschaft über Theben anstrebte. Kreon verbietet die Bestattung Polyneikes und droht mit dem Tod jedem, der dieses Verbot übertritt.
Antigone und die Liebe zum Mitmenschen
Im Gegensatz zu Kreon steht Antigone, Polyneikes' Schwester, für die Liebe zum Mitmenschen und den Respekt für den Toten. Sie ist nicht bereit, den Befehl Kreons zu befolgen und bestattet ihren Bruder Polyneikes heimlich. Sie verkörpert die Werte der Menschlichkeit und Empathie, die im Konflikt mit dem autoritären Machtstreben des Königs stehen.
Expressionismus und die Idee des Weltuntergangs
Die Analyse zeigt die Verbindung von Hasenclevers Antigone mit der expressionistischen Strömung. Die Idee des Weltuntergangs, die in der expressionistischen Literatur eine zentrale Rolle spielt, spiegelt sich im Stück in der düsteren Stimmung, der Darstellung des Hasses und der Angst sowie der Konfrontation mit dem Untergang der alten Welt wider.
Der Krieg und seine Folgen
Der Erste Weltkrieg, in dem das Stück entstanden ist, hat einen großen Einfluss auf die Geschichte. Der Krieg wird als ein Ereignis dargestellt, das tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlässt und zu einer Krise führt. Der Hass, die Gewalt und die Zerstörung, die durch den Krieg verursacht werden, prägen das Stück und spiegeln sich in den Figuren und ihren Entscheidungen wider.
Der Konflikt zwischen Antigone und Kreon
Der Konflikt zwischen Antigone und Kreon steht im Zentrum der Geschichte. Antigone repräsentiert die Liebe und die Menschlichkeit, während Kreon für die Macht und die Autorität steht. Der Konflikt zwischen den beiden zeigt die Unvereinbarkeit dieser beiden Prinzipien und führt zu einem tragischen Ausgang.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Expressionismus, Weltuntergang, Antigone, Kreon, Krieg, Hass, Liebe, Tradition, Moderne, Krise, Gesellschaft, Tragödie.
- Citar trabajo
- Dirk Eismann (Autor), 2015, Die expressionistische Idee des Weltuntergangs in "Antigone" von Walter Hasenclever, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1037181