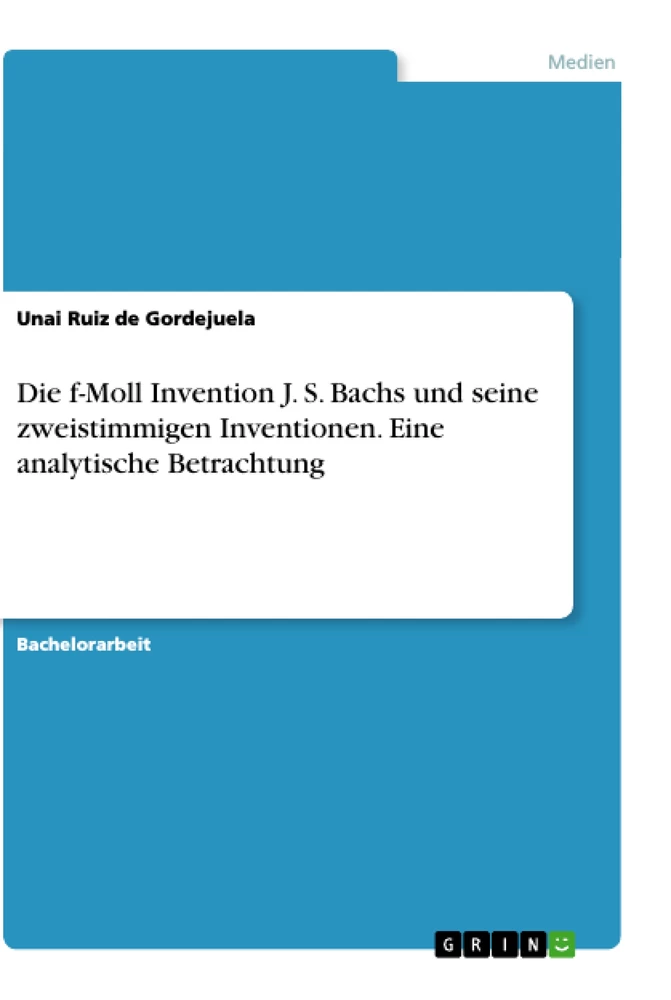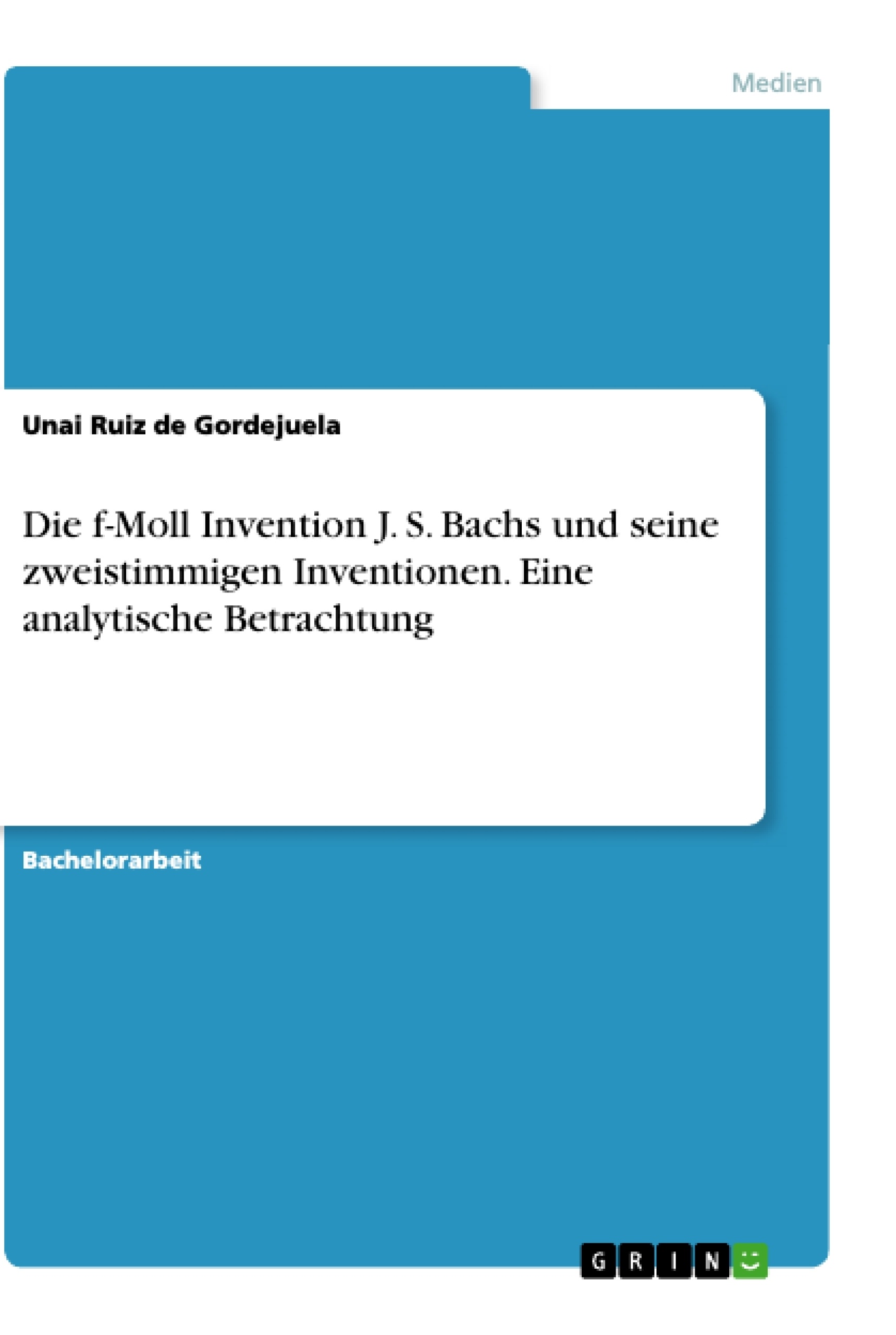Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht eine tiefgehende Analyse der neunten Invention in f-Moll.
Der innere Reichtum dieses Stücks, sowie die Tatsache, dass es in der Literatur bisher wenig behandelt wurde, sind Gründe, die die Autorin zur Auseinandersetzung mit diesem Stück geführt haben. Hier wird versucht den analytischen Ansatz von Fritz Jöde einerseits zu erproben, anderseits weiterzuentwickeln. Dafür werden jenseits des von Fritz Jödes Buch gegebenen ersten Impulses eine Menge weiterer Ideen verwendet, sowie eigene Methoden und Gedanken der Autorin.
Ein anderer wichtiger Aspekt ist, inwieweit unser Verständnis der Inventionen und die Art und Weise, mit der wir sie betrachten, der Anschauung der Zeit, in der diese Stücke entstanden sind, entspricht. Dies wäre ein Grund, einen Teil der Literatur zu den Inventionen infrage zu stellen. Obwohl das Verständnis einer Musik, das auf ihrer zeitgenössischen Theorie und Praxis beruht, ein vernünftiger Ausgangspunkt zu sein scheint, könnten Denkweisen anderer Art unsere Anschauung dieser Musik, und damit ihr Potenzial, deutlich vergrößern. Es sollte bei der Analyse ein Gleichgewicht zwischen der phänomenologischen Betrachtung einer Musik und der Berücksichtigung ihres historisch-musikalischen Kontextes herrschen. Eine bloße phänomenologische Betrachtung würde dazu führen, historisch relevante Tatsachen zu vernachlässigen, während das Gegenteil eine zu restriktive Anschauung mit sich brächte.
Der Umfang der Inventionen ermöglicht eine tiefgreifende Analyse, die auf die verschiedensten Aspekte zielt. Wäre der Gegenstand ein Stück einer größeren Dauer und anderer Art (z. B. eine Toccata oder ein Konzert), müsste man selbstverständlich die angewandte Verfahrensweise anpasst werden.
Der erste Arbeitsschritt der Analyse konzentrierte sich zunächst auf die Darstellung verschiedener Grundaspekte, wie Tonarten, Taktgruppen, Harmonik, Kontrapunkt, etc. Es ging darum, Erkenntnisse über das Stück zu gewinnen, auf denen sich allmählich eine detaillierte Analyse aufbauen liess. Beim zweiten Schritt der Analyse lag der Schwerpunkt auf der Darstellung weiterer Aspekte, wie Metrik, Melodik, Motivik, Dissonanzen, Satzmodelle, etc. Die zuletzt erwähnten Aspekte unterscheiden sich im Prinzip nicht von denen der ersten Phase, sie vertreten lediglich einen höheren Komplexitätsgrad.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1- Praeambula: zur Entstehung der 15 zweistimmigen Inventionen
- 1.1. Das Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach
- 1.2. Praeambulum
- 1.3. Musikgeschichtlicher Hintergrund der 15 praeambula
- 1.4. Inventio(n)
- 1.5. Die 15 zweistimmigen Inventionen
- 1.6. Die ursprüngliche Ordnung der Inventionen und ihr Sinn
- 2- Überblick zur Literatur zu den Inventionen
- 2.1. Einleitung
- 2.2. Allgemeiner Überblick zur Literatur
- Fritz Jöde
- Johann Nepomuk David
- Erwin Ratz
- Schenkersche Analyse
- Rhetorische Musikanalyse
- 2.3. Ausgewählte Werke im Detail und Vergleich ihrer Ansätze
- Fritz Jöde: Die Kunst Bachs: dargestellt an seinen Inventionen
- Erwin Ratz: Einführung in die musikalische Formenlehre
- Laurence Dreyfuss: Bach and the Patterns of Invention
- 2.4. Zusammenfassung: Ziel bisheriger Analysen
- 3- Analyse der neunten Invention in f-Moll
- I Erster Abschnitt
- II Formaler Überblick
- III Die Anschauung der Inventionen nach Ratz
- IV Stimmführung vor den Themenanfängen
- V Modifikationen im Übergangsteil
- VI Harmonik
- VII Fritz Jödes Musikbetrachtung und der hypothetische Keim
- VIII Die Takte 25-28
- IX Eine musikalisch-rhetorische Anschauung
- Zusammenfassung
- 4- Ausblick: Nachläufer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die 15 zweistimmigen Inventionen Johann Sebastian Bachs, insbesondere die neunte Invention in f-Moll. Ziel ist es, verschiedene analytische Ansätze zu erproben und zu erweitern, um ein vertieftes Verständnis dieser Werke zu erreichen. Dabei wird sowohl der musikgeschichtliche Kontext berücksichtigt als auch die Rezeption der Inventionen in der musiktheoretischen Literatur beleuchtet.
- Musikgeschichtlicher Kontext der Inventionen
- Analyse verschiedener musiktheoretischer Ansätze (Jöde, Ratz, Dreyfus)
- Detaillierte Analyse der neunten Invention in f-Moll
- Entwicklung eines erweiterten analytischen Ansatzes
- Vergleich der verschiedenen analytischen Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert die besondere analytische Relevanz der zweistimmigen Inventionen Bachs aufgrund ihres geringen Umfangs und der sparsamen Verwendung von Material. Es wird die pädagogische Natur der ursprünglich "Praeambula" genannten Stücke hervorgehoben, die Bach für seinen Sohn Wilhelm Friedemann schrieb. Der Autor beschreibt seinen Weg zur Wahl dieses Forschungsthemas, ausgehend von einer ursprünglichen Idee, die Präludien der Cellosuiten zu analysieren, hin zur Auseinandersetzung mit den Inventionen, inspiriert durch Fritz Jödes Werk. Die Bedeutung verschiedener Autoren wie Erwin Ratz und Laurence Dreyfus für die vorliegende Arbeit wird angedeutet, ebenso die zentrale Frage nach dem Ziel und dem Ablauf einer solchen Analyse.
1- Praeambula: zur Entstehung der 15 zweistimmigen Inventionen: Dieses Kapitel untersucht den musikgeschichtlichen Kontext der Entstehung der Inventionen. Es beleuchtet das "Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach", den Begriff "Praeambulum" und den musikhistorischen Hintergrund dieser Stücke. Der Begriff "Invention" wird definiert und die 15 zweistimmigen Inventionen selbst werden im Detail vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion über die ursprüngliche Ordnung der Inventionen und deren Bedeutung.
2- Überblick zur Literatur zu den Inventionen: Kapitel 2 bietet einen umfassenden Überblick über die musiktheoretische Literatur zu Bachs zweistimmigen Inventionen. Es werden die Ansätze von bedeutenden Autoren wie Fritz Jöde, Johann Nepomuk David, Erwin Ratz und Laurence Dreyfus vorgestellt und verglichen. Der Fokus liegt auf der Darstellung unterschiedlicher analytischer Methoden und der jeweiligen Zielsetzung der verschiedenen Autoren. Die Zusammenfassung am Ende des Kapitels fasst die bisherigen Forschungsansätze zusammen und benennt deren Stärken und Schwächen.
3- Analyse der neunten Invention in f-Moll: Das Kernstück der Arbeit ist die detaillierte Analyse der neunten Invention in f-Moll. Das Kapitel ist in verschiedene Abschnitte gegliedert, die verschiedene Aspekte des Werkes untersuchen: formale Struktur, Stimmführung, Harmonik, und die Anwendung der analytischen Methoden von Fritz Jöde und anderen Musiktheoretikern. Es werden spezifische Passagen detailliert analysiert, um die komplexen musikalischen Beziehungen aufzuzeigen und ein tiefes Verständnis der Komposition zu erreichen. Die verschiedenen Analyse-Ebenen, von der Betrachtung einzelner Elemente bis hin zur Gesamtstruktur, werden miteinander verknüpft.
4- Ausblick: Nachläufer: Dieses Kapitel gibt einen Ausblick auf die Nachwirkung und den Einfluss der Inventionen Bachs auf spätere Komponisten und Kompositionstechniken. Es wird die Bedeutung der Inventionen im Kontext der Musikgeschichte beleuchtet und der Einfluss auf die Entwicklung des "kleinen Klavierstücks" in der Klassik und Romantik untersucht.
Schlüsselwörter
Johann Sebastian Bach, zweistimmige Inventionen, f-Moll Invention, Musiktheorie, Musikanalyse, Fritz Jöde, Erwin Ratz, Laurence Dreyfus, Kompositionstechnik, Form, Harmonik, Stimmführung, musikalische Rhetorik, historisch-musikalischer Kontext, phänomenologische Betrachtung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der neunten Invention in f-Moll von Johann Sebastian Bach
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die 15 zweistimmigen Inventionen von Johann Sebastian Bach, mit besonderem Fokus auf die neunte Invention in f-Moll. Sie untersucht verschiedene analytische Ansätze und erweitert diese, um ein vertieftes Verständnis der Werke zu erreichen. Der musikgeschichtliche Kontext und die Rezeption in der musiktheoretischen Literatur werden berücksichtigt.
Welche analytischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit vergleicht und wendet verschiedene musiktheoretische Ansätze an, darunter die Methoden von Fritz Jöde, Erwin Ratz und Laurence Dreyfus. Sie entwickelt zudem einen erweiterten analytischen Ansatz, der verschiedene Analyse-Ebenen (formale Struktur, Stimmführung, Harmonik etc.) miteinander verknüpft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Ein Kapitel zur Entstehung der Inventionen und ihrem musikgeschichtlichen Kontext, ein Kapitel zum Überblick der relevanten Literatur und verschiedenen Analysemethoden, eine detaillierte Analyse der neunten Invention in f-Moll und ein Ausblick auf die Nachwirkung der Inventionen.
Was wird im Kapitel zur Entstehung der Inventionen behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet das "Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach", den Begriff "Praeambulum", den musikhistorischen Hintergrund der Stücke, die Definition von "Invention" und die ursprüngliche Ordnung der 15 zweistimmigen Inventionen und deren Bedeutung.
Was wird im Literaturüberblick (Kapitel 2) behandelt?
Kapitel 2 bietet einen umfassenden Überblick über die musiktheoretische Literatur zu Bachs zweistimmigen Inventionen. Es werden die Ansätze von Fritz Jöde, Johann Nepomuk David, Erwin Ratz und Laurence Dreyfus vorgestellt und verglichen, wobei die unterschiedlichen analytischen Methoden und Zielsetzungen im Fokus stehen. Die Zusammenfassung benennt Stärken und Schwächen der bisherigen Forschungsansätze.
Wie wird die neunte Invention in f-Moll analysiert (Kapitel 3)?
Kapitel 3 analysiert die neunte Invention detailliert, indem es verschiedene Aspekte wie formale Struktur, Stimmführung, Harmonik und die Anwendung der analytischen Methoden von Fritz Jöde und anderen untersucht. Spezifische Passagen werden detailliert analysiert, um komplexe musikalische Beziehungen aufzuzeigen und ein tiefes Verständnis der Komposition zu erreichen.
Was beinhaltet der Ausblick (Kapitel 4)?
Der Ausblick betrachtet die Nachwirkung und den Einfluss der Inventionen Bachs auf spätere Komponisten und Kompositionstechniken. Die Bedeutung der Inventionen im Kontext der Musikgeschichte und ihr Einfluss auf die Entwicklung des "kleinen Klavierstücks" werden untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Johann Sebastian Bach, zweistimmige Inventionen, f-Moll Invention, Musiktheorie, Musikanalyse, Fritz Jöde, Erwin Ratz, Laurence Dreyfus, Kompositionstechnik, Form, Harmonik, Stimmführung, musikalische Rhetorik, historisch-musikalischer Kontext, phänomenologische Betrachtung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene analytische Ansätze zu erproben und zu erweitern, um ein vertieftes Verständnis der 15 zweistimmigen Inventionen, insbesondere der neunten Invention in f-Moll, zu erreichen. Sie beleuchtet den musikgeschichtlichen Kontext und die Rezeption in der musiktheoretischen Literatur.
- Quote paper
- Unai Ruiz de Gordejuela (Author), 2021, Die f-Moll Invention J. S. Bachs und seine zweistimmigen Inventionen. Eine analytische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1036739