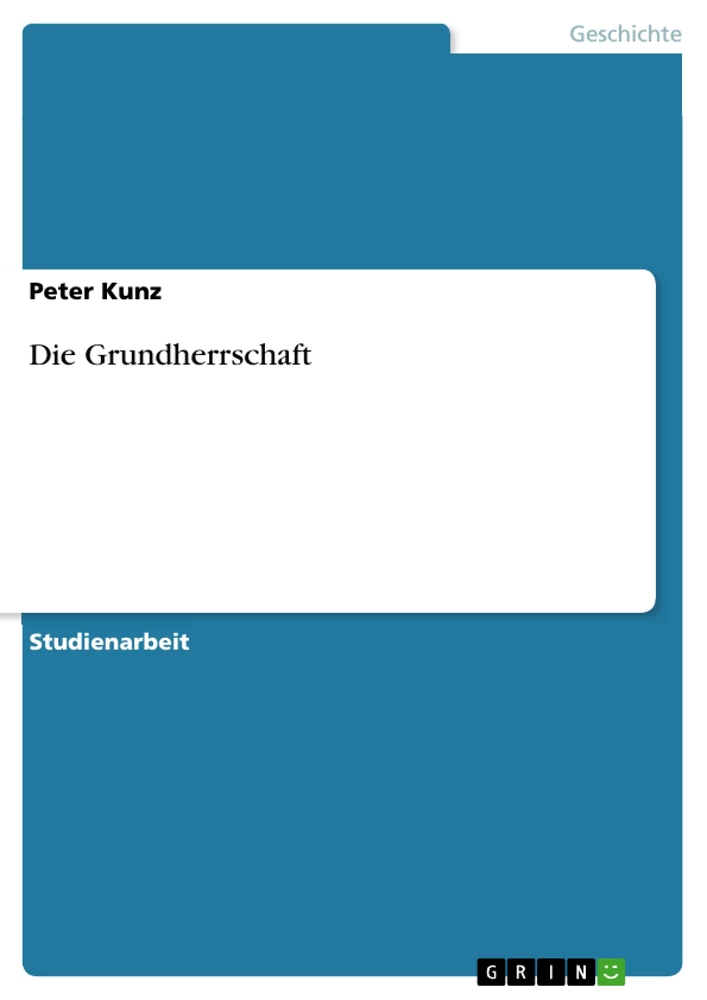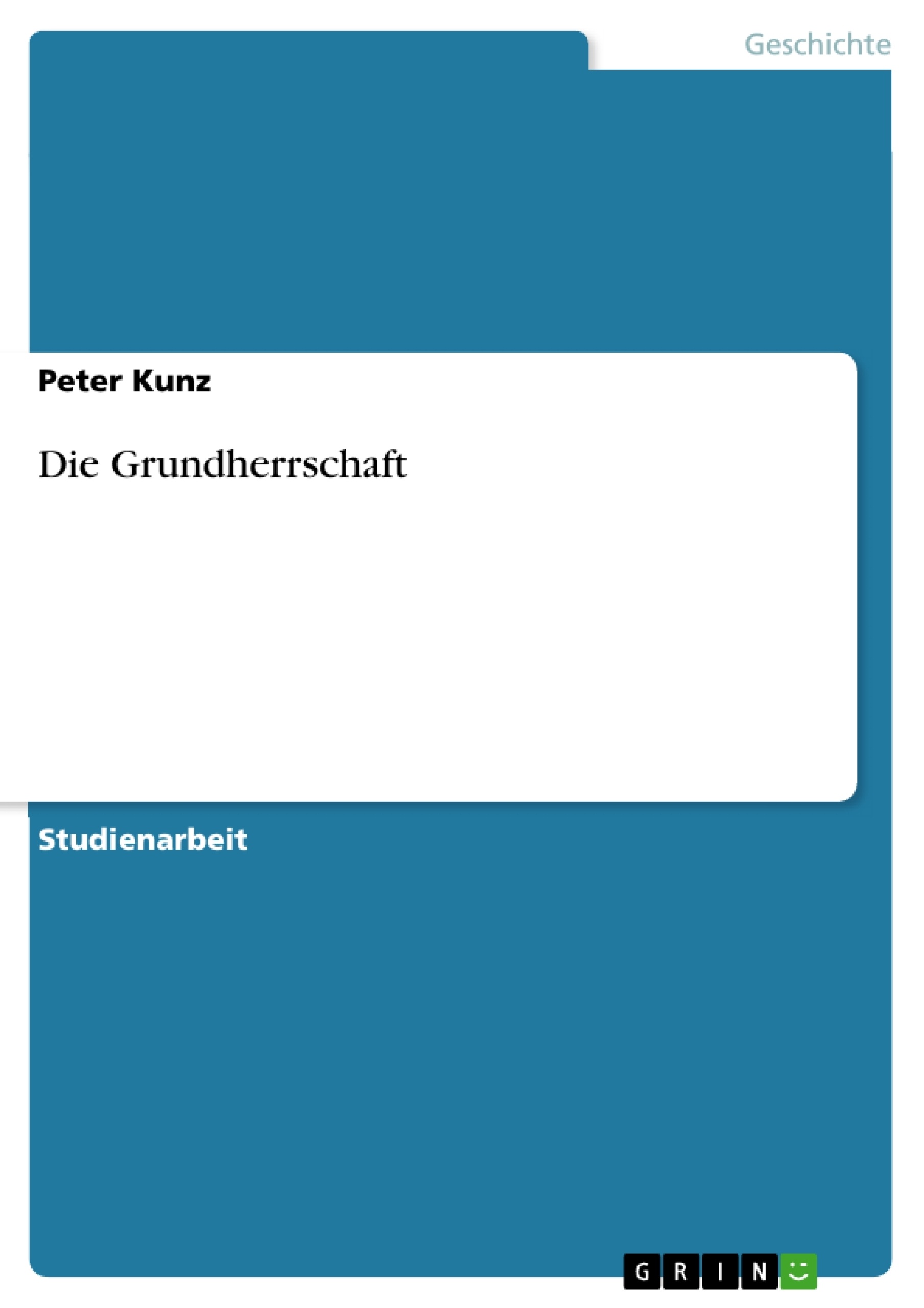Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des mittelalterlichen Europas, wo das Schicksal von Bauern und Herren untrennbar miteinander verbunden war. Diese aufschlussreiche Analyse der Grundherrschaft enthüllt die komplexen sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Strukturen, die das Leben im ländlichen Raum prägten. Entdecken Sie die vielschichtigen Ausprägungen der Grundherrschaft, von der Villikationsverfassung mit ihren Fronhöfen bis zur Zinsgrundherrschaft, die das Verhältnis zwischen Landbesitzern und Pächtern neu definierte. Erforschen Sie die tiefgreifenden Auswirkungen dieser Herrschaftsformen auf die Landwirtschaft, die Abgabenlast und die Lebensgrundlage der Bauern. Wer waren die Akteure in diesem Machtspiel? Könige, Adelige oder die Kirche selbst? Anhand von Fallstudien, wie den fränkischen Beispielen Ebrach und Kunreuth, wird ein detaillierter Vergleich zwischen der Grundherrschaft weltlicher und geistlicher Herren gezogen. Untersuchen Sie die Unterschiede in Besitzgrößen, Abgabenordnungen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Dieses Buch bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über die Entstehung, Entwicklung und den Zerfall der Grundherrschaft, sondern beleuchtet auch die Rolle der Kirche, des Adels und des Königsguts in diesem System. Es werden die Lebensbedingungen der unfreien und freien Bauern, ihre Pflichten und Rechte sowie die Bedeutung der "familia" als soziale und wirtschaftliche Einheit analysiert. Durchdringen Sie die mittelalterliche Gesellschaftsordnung, die auf dem Idealbild der "oratores, pugnatores et laboratores" basierte und erfahren Sie, wie diese Ordnung das Leben der Menschen im Mittelalter bestimmte. Diese Arbeit bietet eine wertvolle Ressource für alle, die sich für mittelalterliche Geschichte, Agrargeschichte und die sozialen Strukturen des Feudalismus interessieren. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für Studenten, Wissenschaftler und alle, die ein tieferes Verständnis für die Wurzeln unserer modernen Gesellschaft suchen. Erleben Sie eine Zeit, in der Land nicht nur Lebensgrundlage, sondern auch Macht bedeutete, und entdecken Sie die verborgenen Mechanismen, die das mittelalterliche Europa formten.
INHALTSVERZEICHNIS
I. Einleitung
II. Der Begriff Grundherrschaft
III. Ausprägungen der Grundherrschaft
1. Elemente der Villikationsverfassung
2. Elemente der Zinsgrundherrschaft
3. Elemente der Gutsherrschaft
IV. Die Grundlagen der Grundherrschaft
1. Oratores, pugnatores et laboratores
2. Freie und Unfreie
3. Die familia
V. Die Entstehung der Grundherrschaft
1. Die Entstehung der frühmittelalterlichen Grundherrschaft
2. Strukturwandel im Hoch- und Spätmittelalter
3. Der Zerfall des Fronhofsystems
VI. Die Lebensgrundlage der Bauern und Grundherren
1. Art und Rentabilität der mittelalterlichen Landwirtschaft
2. Arten und Umfang der Abgaben
VII. Die Inhaber der Grundherrschaft
1. Königsgüter
2. Adelige Grundherrschaft
3. Kirchliche Grundherrschaft
IIX. Vergleich der Grundherrschaft weltlicher und geistlicher Herren in Franken am Beispiel von Ebrach und Kunreuth
1. Die Grundherrschaft des Klosters Ebrach
a) Die Zisterzienser
b) Das Kloster
c) Die Besitzgrößen
d) Die Besitzverhältnisse
e) Die Dauer der Leihe
f) Die Erbsitten
g) Die rechtliche Situation zu Beginn des 14. Jahrhunderts
h) Die Abgaben und Dienste
2. Die Grundherrschaft der Burg Kunreuth
a) Die Ausdehnung der Herrschaft
b) Die Besitzgrößen
c) Die Abgaben und Dienste
3. Vergleich
IX. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Im Verlauf des Pro- und Hauptseminars » Wider willkürlich trünken und völlerey - Agrargesellschaft und obrigkeitliche Reglementierung in Franken im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit« unter der Leitung von Prof. Dr. Wüst und Dr. Weber konnten viele Aspekte der Wein- und Bierkultur in Franken und dem übrigen süddeutschen Raum erhellt werden.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Rahmenbedingungen der mittelalterlichen Landwirtschaft in Form der Grundherrschaft und ihren verschiedenen Aspekten darzustellen. Gezeigt werden soll, wie die Grundherrschaft das ländliche Wirtschaften beeinflusste und bedingte.
Soweit das im Rahmen einer Hausarbeit möglich ist, soll auch anhand zweier Beispiele untersucht werden, ob es augenscheinliche Unterschiede in der Grundherrschaft geistlicher und adeliger Herren gab.
Die Quellenlage zur mittelalterlichen Grundherrschaft ist alles andere als optimal. Urbare, die Hauptquellen, sind für Früh- und Hochmittelalter nur in geringer Zahl vorhanden. Die Besitzverzeichnisse werden in späterer Zeit zwar häufiger, ihr Aussagewert beschränkt sich aber naturgemäß darauf, wozu sie niedergeschrieben wurden: welche Besitztümer ein Grundherr wo innehatte und welcher Hintersasse wieviele und welche Abgaben und Dienste zu leisten hatte. Es lässt sich also nachverfolgen, wie die Entwicklung der Besitzverhältnisse verlaufen ist und welche Rechtsverhältnisse bestanden, woraus Aussagen über rechtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Verhältnisse von Grundherren und Hintersassen abgeleitet werden können.
Angaben über die Alltagswirklichkeit, das Selbstverständnis der Menschen auf dem Land oder die Beweggründe für historische Entwicklungen sind dadurch oft nur bruchstückhaft oder gar nicht zu erschließen.
II. Der Begriff Grundherrschaft
»Unter "Grundherrschaft" wird […] die Herrschaft über Personen verstanden, die von einem Grundbesitzer Land zur Bearbeitung und wirtschaftlichen Nutzung in eigener Regie erhalten haben.«1
»Herrschaft über Grund und Boden und über die Bauern, d.h. über die Menschen, die auf Grund und Boden sitzen und diesen Boden bebauen.«2
Das Wort selbst taucht in den Quellen erst im 16. Jahrhundert auf. Seit dem 19. Jahrhundert ist »Grundherrschaft« ein historischer und juristischer Ausdruck. Der neuzeitliche Ordnungsbegriff steht für dominium, ius et dominium, potestas und dominatio3
III. Ausprägungen der Grundherrschaft
Drei Haupttypen der mittelalterlichen Grundherrschaft lassen sich unterscheiden:
die Villikationsverfassung, auch Fronhofsystem genannt, die Zins- oder Rentengrundherrschaft und die für Franken weniger bedeutsame Guts- oder Patrimonialherrschaft.
1. Elemente der Villikationsverfassung
Im Mittelpunkt der auch als »klassische« Grundherrschaft bezeichneten Villikation stand der eigenbebaute Fron- oder Herrenhof (villa), dessen Salland (terra salica) vom unfreien Hofgesinde und den abhängigen Hufenbauern bewirtschaftet wurde. Die Hufen (mansi), sind Bauernhöfe, die von abhängigen und abgabenpflichtigen Bauern selbstständig bewirtschaftet werden. Sie stellten schon früh den größere Teil des herrschaftlichen Grundbesitzes dar. Der nicht zum Salland gehörende Boden überwog also. Hufen und Salland bildeten zusammen den Fronhofverband, der unter der Aufsicht des Grundherren, oder seines Stellvertreters (villicus, Meier, Vogt, Schultheiß) stand und eine relativ autarke Wirtschaftseinheit bildete. Dazu trugen auch am Herrenhof ansässige Handwerker bei.
Der Grundherr besaß verschiedene Bannrechte (dominatii): Monopolbetriebe wie Mühlen, Schenken, Weinpressen und Backöfen, sowie den Gerichtsbann.
Zu den Aufgaben des villicus gehörten die wirtschaftliche Leitung des Fronhofverbands, das Eintreiben der Abgaben und die niedere Gerichtsbarkeit.
2. Elemente der Zinsgrundherrschaft
Die Rentengrundherrschaft steht im Gegensatz zur grundherrliche Eigenwirtschaft. Das Ackerland, Wiesen, Wälder, Hof und Wohngebäude, usw. wurden an zinspflichtige Bauern verliehen. Der Inhaber zahlte für seinen Hof und später hinzugekommene Einzelstücke jährlich Grundzins, dessen Höhe sich nach Größe und Wert der Güter bemaß.
Oft existierten Erleichterungen, gerade bei Höfen, deren freier Besitzer sich der Grundherrschaft eines (meist geistlichen) Herren unterstellt hatte (precaria)
Üblich waren die kurzfristige Leihe auf ein bis zwölf Jahre, die Leihe auf Lebenszeit (Vitallehen, Leibgeding) und das Erbzinsrecht, bei dem das Gut weiter vererbt werden konnte. Güter wurden im auch Teilbau verliehen, was bedeutet, dass ein Teil der Ernte, meist ein Drittel oder die Hälfte abgegeben wurde.
Die verschränkten Besitzrechte führten zum juristischen Begriff des geteilten Eigentums: der Grundherr besaß das Obereigentum (dominium directum), der Siedler das Nutzungseigentum (dominium utile). Der Inhaber hatte das Leihgut unentziehbar zu Erbrecht inne. Die Inhaber waren insofern schollengebunden, als der Abzug vom Hof nur nach ordnungsgemäßer Lösung des Rechtsverhältnisses möglich war. Mit herrschaftlicher Genehmigung war auch der Verkauf oder Teilverkauf möglich.
Die Abgaben waren in Form von Geldzahlungen (Zins), Naturalleistungen (Gült) und Diensten zu leisten. Die zu leistenden Dienste wurden nicht willkürlich festgelegt, sondern stellten Leistungen im Rahmen der Gesamtverpflichtungen dar. Der Grundherr leistete Schutz und Schirm. Der Inhaber durfte sich nicht einem anderem Grundherren unterwerfen und musste die Leihgüter in Stand halten. Geriet der Untertan unverschuldet in Not, konnte er in der Regel mit vorübergehendem Nachlass oder Minderung der Abgaben rechnen.
3. Elemente der Gutsherrschaft
Im Mittelpunkt steht der Gutshof mit marktorientierter Eigenwirtschaft. Das Land wird vom unfreien Hofgesinde und gutsuntertänigen Bauern und Kleinstellenbesitzern bewirtschaftet. Der Gutsbezirk ist meist räumlich und herrschaftlich geschlossen.4
IV. Die Grundlagen der Grundherrschaft
1. oratores, pugnatores et laboratores
Vom Früh- zum Hochmittelalter hat sich eine Gesellschaft entwickelt, deren Idealbild dreigeteilt ist: Von Gott so gewollt, besteht die symbiotische Gesellschaft aus Betern (oratores), Kriegern (pugnatores) und Bauern (laboratores). Gesonderte Gruppen bilden die Stadtbürger, Händler und Handwerker. Die Kirche kümmert sich um das Seelenheil der Menschen, die Krieger schützen sie und die Bauern erwerben allen den Lebensunterhalt. Diese Ordnung hat sich mehrere Jahrhunderte halten können; ihre Entstehung ist umstritten.
2. Freie und Unfreie
In frühmittelalterlichen Quellen ist nicht von Bauern, Leibeigenen und Adligen die Rede, sondern von Freien und Unfreien. » Quia non est amplius nisi liber et servus.«5 , soll Karl der Große gesagt haben.
Für die Freien gilt das Volksrecht (leges), sie nehmen an Versammlungen teil, leisten Heerfolge und bewirtschaften ihre Höfe als Eigenbesitz.
Die Unfreien besitzen kein Land, leisten Dienste und Abgaben und unterstehen der Gewalt ihrer Grund und Leibherren.
3. Die familia
Unter der familia versteht man die Hofgenossenschaft von Hufenbauern und dem Hofgesinde des Herrenhofs. Sie bildet eine Rechts-, Arbeits-, und Sozialgemeinschaft. Zu ihr gehören Halbfreie, Unfreie und auch Freie. Der Begriff Bauer im Sinne von Landwirt wird erst seit dem 11.
Jahrhundert benutzt. Vorher wurden als gebure die Mitbewohner des Hauses (bur) bezeichnet.6Die familia untersteht der Hofgerichtsbarkeit des Grundherren.7
[...]
1 Schulze, S. 96
2 Brunner, O.: Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter, 1965 (zitiert nach Rösener, Bauern im Mittelalter, S. 23)
3 Schulze, S. 95, Rösener, Grundherrschaft im Wandel, S.15
4 Schulze, S. 123-126
5 Fleckenstein, S. 19
6 Rösener, Bauern im Mittelalter, S.19
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument ist ein umfassender Überblick über das Thema Grundherrschaft im Mittelalter, insbesondere in Franken. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, Definitionen, Ausprägungen, Grundlagen, Entstehung und die Lebensgrundlage von Bauern und Grundherren. Außerdem werden die Inhaber der Grundherrschaft und ein Vergleich zwischen weltlicher und geistlicher Herrschaft anhand der Beispiele Ebrach und Kunreuth behandelt. Abschließend enthält es ein Literaturverzeichnis.
Was ist Grundherrschaft?
Grundherrschaft wird als die Herrschaft über Personen verstanden, die von einem Grundbesitzer Land zur Bearbeitung und wirtschaftlichen Nutzung in eigener Regie erhalten haben, oder als Herrschaft über Grund und Boden und über die Bauern, die diesen Boden bebauen.
Welche Ausprägungen der Grundherrschaft werden unterschieden?
Es werden drei Haupttypen unterschieden: die Villikationsverfassung (Fronhofsystem), die Zins- oder Rentengrundherrschaft und die Guts- oder Patrimonialherrschaft.
Was sind die Elemente der Villikationsverfassung (Fronhofsystem)?
Im Mittelpunkt steht der eigenbebaute Fron- oder Herrenhof (villa) mit seinem Salland (terra salica), bewirtschaftet von unfreien Hofgesinde und abhängigen Hufenbauern. Der Grundherr besaß verschiedene Bannrechte und der villicus hatte die wirtschaftliche Leitung und die niedere Gerichtsbarkeit.
Was sind die Elemente der Zinsgrundherrschaft?
Hier wird das Ackerland an zinspflichtige Bauern verliehen, die dafür jährlich Grundzins zahlen. Es gab verschiedene Leiheformen (kurzfristig, lebenslang, Erbzinsrecht). Der Grundherr besaß das Obereigentum (dominium directum), der Siedler das Nutzungseigentum (dominium utile).
Was sind die Elemente der Gutsherrschaft?
Im Mittelpunkt steht der Gutshof mit marktorientierter Eigenwirtschaft, bewirtschaftet von unfreiem Hofgesinde und gutsuntertänigen Bauern.
Was sind die Grundlagen der Grundherrschaft?
Die mittelalterliche Gesellschaft war idealerweise dreigeteilt in Betende (oratores), Krieger (pugnatores) und Bauern (laboratores). Es gab Freie, die Volksrechte hatten, und Unfreie, die Dienste und Abgaben leisteten. Die familia war die Hofgenossenschaft.
Wie entstand die Grundherrschaft?
Die Entstehung der frühmittelalterlichen Grundherrschaft, Strukturwandel im Hoch- und Spätmittelalter und der Zerfall des Fronhofsystems werden betrachtet.
Worauf basierte die Lebensgrundlage der Bauern und Grundherren?
Die Art und Rentabilität der mittelalterlichen Landwirtschaft sowie die Arten und der Umfang der Abgaben werden untersucht.
Wer waren die Inhaber der Grundherrschaft?
Königsgüter, adelige Grundherrschaft und kirchliche Grundherrschaft werden betrachtet.
Was wird am Beispiel von Ebrach und Kunreuth verglichen?
Die Grundherrschaft des Klosters Ebrach (Zisterzienser) und die Grundherrschaft der Burg Kunreuth werden verglichen, um Unterschiede zwischen geistlicher und weltlicher Herrschaft aufzuzeigen, insbesondere hinsichtlich Besitzgrößen, Besitzverhältnisse, Dauer der Leihe, Erbsitten, rechtliche Situation und Abgaben/Dienste.
- Quote paper
- Peter Kunz (Author), 2001, Die Grundherrschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103667