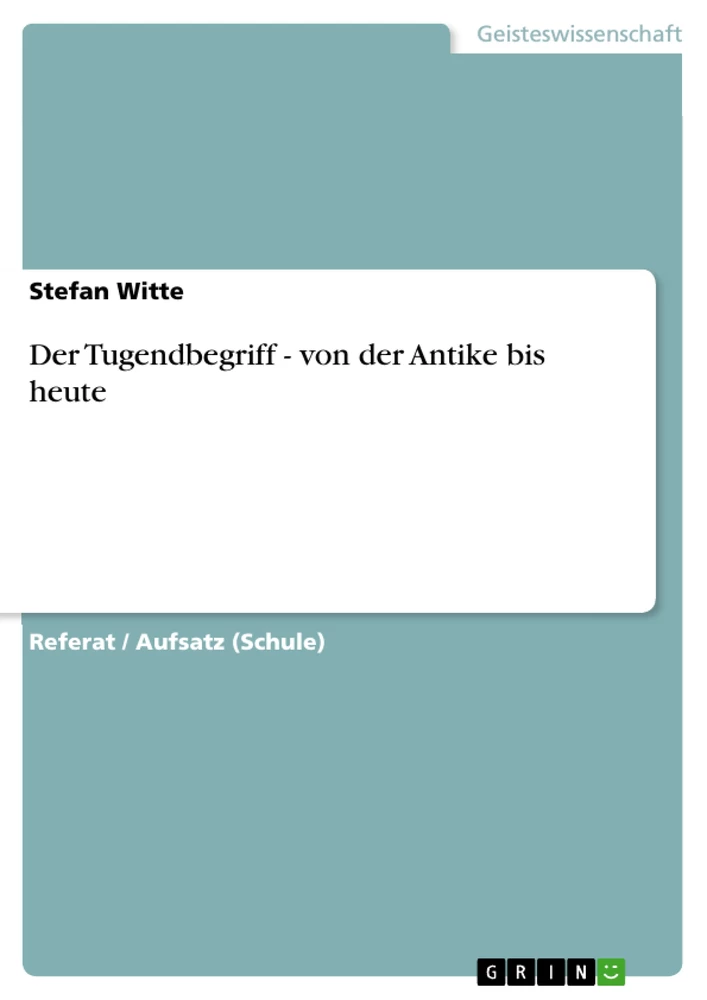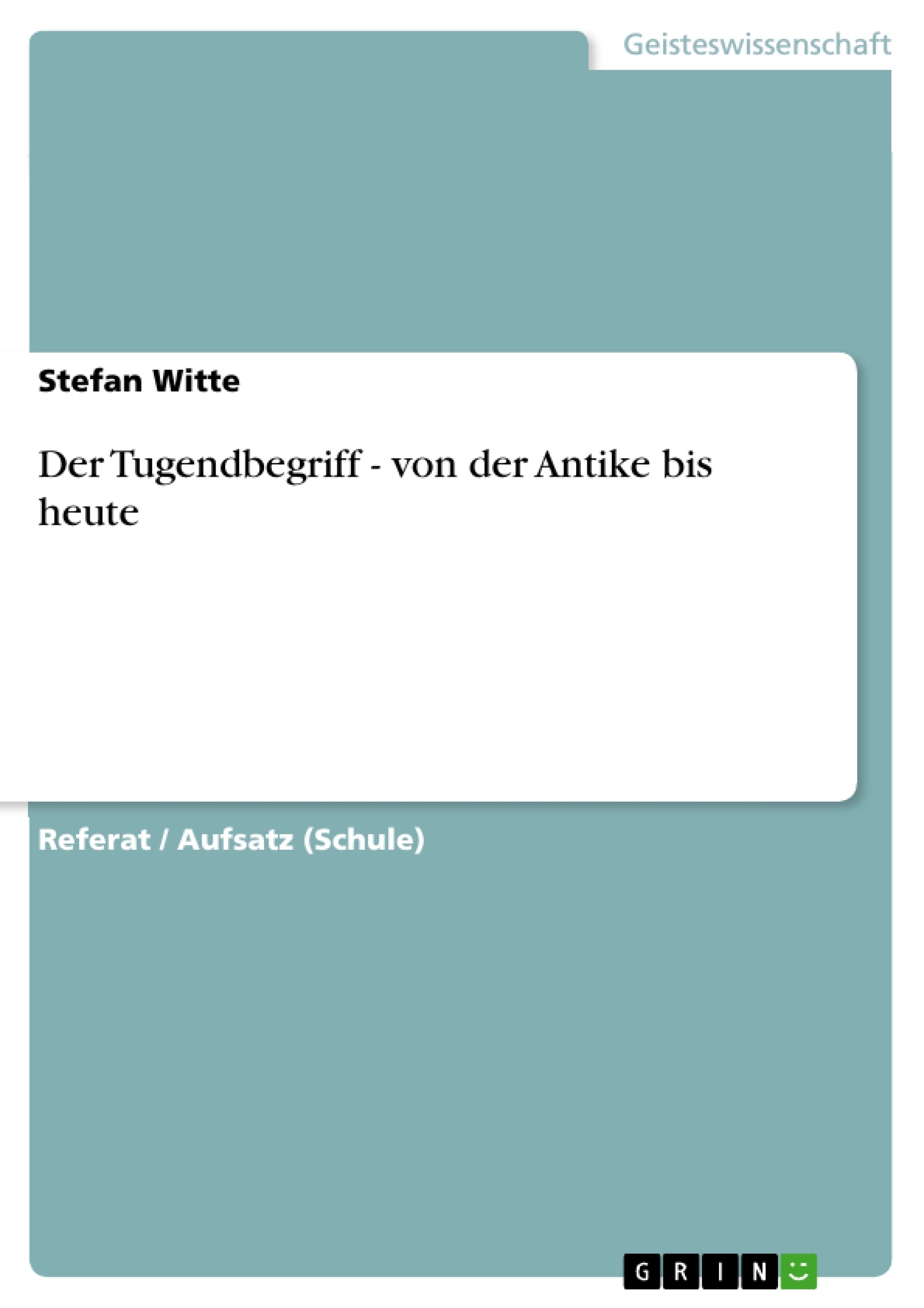Was bedeutet es wirklich, tugendhaft zu sein? Diese Frage, die Philosophen seit der Antike beschäftigt, wird in diesem Werk anhand von bewegenden Beispielen und tiefgründigen Analysen neu beleuchtet. Von dem französischen Fechter, der im Angesicht des olympischen Goldes die Wahrheit bekennt, bis zu dem deutschen Ehepaar, das im Zweiten Weltkrieg jüdische Mädchen vor den Nazis versteckt, erkunden wir außergewöhnliche Akte der Menschlichkeit. Mutter Teresa, die sich unermüdlich um die Ärmsten kümmert, dient als zeitgenössisches Beispiel für Tugendhaftigkeit. Doch was macht diese Handlungen so besonders? Tauchen Sie ein in die Welt der klassischen Philosophie, insbesondere die Lehren von Sokrates und Platon, um die Wurzeln des Tugendbegriffs zu verstehen. Entdecken Sie, wie Sokrates' Betonung von Wissen und Selbsterkenntnis als Grundlage für tugendhaftes Handeln dient und wie Platon die vier Kardinaltugenden – Mäßigkeit, Tapferkeit, Weisheit und Gerechtigkeit – als Eckpfeiler eines ethischen Lebens hervorhebt. Jenseits historischer Kontexte untersucht dieses Buch, wie sich der Begriff der Tugend im Laufe der Zeit gewandelt hat, von den bürgerlichen Tugenden des 18. Jahrhunderts bis zu modernen Werten wie Toleranz, Fairness und Solidarität. Es wird untersucht, wie Tugend nicht nur als individuelle Eigenschaft, sondern auch als gesellschaftliche Notwendigkeit für ein friedliches Zusammenleben betrachtet werden kann. Lassen Sie sich inspirieren, über Ihre eigenen Werte nachzudenken und die Bedeutung von Tugend in Ihrem Leben und in der Welt um Sie herum neu zu entdecken. Eine philosophische Reise, die zum Nachdenken anregt und dazu auffordert, die Essenz wahrer Menschlichkeit zu erkennen und zu leben, indem sie untersucht, was es bedeutet, ein tugendhaftes Leben in einer komplexen Welt zu führen, die oft von anderen Werten bestimmt wird. Es werden die ethischen Implikationen unseres Handelns, die Bedeutung von moralischer Integrität und die zeitlose Relevanz der Tugendlehre erörtert, um den Leser zu ermutigen, über seine eigenen Werte und Handlungen nachzudenken und zu einem Leben der Tugendhaftigkeit zu gelangen, wodurch die Leser dazu angeregt werden, die tiefgreifenden Fragen nach Moral, Ethik und dem Streben nach einem sinnvollen und erfüllten Leben zu stellen, um die Leser zu inspirieren, die Welt um sie herum positiv zu beeinflussen und einen Beitrag zu einer gerechteren und mitfühlenderen Gesellschaft zu leisten.
Stefan Witte
Ethik Referat - 12te Klasse
Tugend
Spricht man noch von Tugenden?
Der erste Text handelt von den olympischen Spielen 1928. In dem letzten Florettkampf um die Goldmedaille treten ein Italiener und ein Franzose gegeneinander an. Während des Kampfes kommt Unsicherheit auf, man weiß nicht ob der Franzose getroffen ist oder nicht. Nach einer kurzen Diskussion verkündet das Kampfgericht "Non touché". Der Franzose, zu dessen Gunsten entschieden wurde reißt seine Maske vom Gesicht und bekennt: "Je suis touché", obwohl das Kampfgericht für ihn entschieden hat und sein Eingeständnis den Verlust der Goldmedaille bedeutet.
Der zweite Text handelt von drei polnischen Jüdinnen, die während des Zweiten Weltkrieges vor den Nazis fliehen. Sie befinden sich auf einem Bauernhof der dem deutschen Ehepaar Harder gehört. Das Ehepaar versteckt die Mädchen - erst in einem Schuppen, dann im Stall - und versorgt sie später mit Kleidung und Essen, was zu dieser Zeit auch für sie Mangelware war, sie baden die Kinder und lassen sie schließlich in ihrem Ehebett schlafen. Die Geschichte stammt aus einem Band, das sich "wenige Zeugnisse der Menschlichkeit 1933-1945" nennt und jene Fälle aufzeigt in denen sich Deutsche selbstlos und unter Gefährdung des eigenen Lebens für Fremde einsetzen, damit also Menschlichkeit und Nächstenliebe, vor allem aber Mut und Selbstlosigkeit beweisen.
Text 3, Zitat:
"Ich würde das nicht für eine Million Dollar tun", meinte ein amerikanischer Journalist, als er zusah, wie Mutter Theresa die stinkende und ekelerregende Wunde eines Patienten versorgte. "Ich auch nicht" antwortete sie.
Dieses Verhalten Mutter Theresas lässt sich kurz und treffend als tugendhaft bezeichnen. Obwohl Tugenden Etwas vorbildliches, positives und für ein friedliches Zusammenleben notwendiges sind, wird der Begriff gar nicht - oder nur sarkastisch - verwendet.
"Tugend bedeutet die - vorwiegend durch Selbsterziehung gewonnene - sittliche Grundhaltung eines Menschen, die in seinem Denken und Handeln als echte Menschlichkeit zum Ausdruck kommt.
Die im 18.ten Jahrhundert als "bürgerliche Tugenden" bezeichneten Eigenschaften wie Ordnungsliebe, Fleiß und Sparsamkeit haben den Begriff Tugend in Verruf gebracht. Damals wurden Tugenden derart hoch gewertet, dass sie zur gesellschaftlichen Norm und dadurch zum Zwang wurden. Das führte zu Vorsicht, vor allem aber zu Heuchelei. Die Tugenden Großmut und Demut haben im Laufe der Zeit ihre Bedeutung verloren, an ihre Stelle treten jetzt Toleranz, Fairness und Solidarität. Zu den zeitlosen Tugenden gehören Nächstenliebe und Gerechtigkeit.
Der Tugendbegriff in der Antike und im Christentum
Der griechische Ausdruck für Tugend ist aret ‚ und bedeutet Tauglichkeit oder Tüchtigkeit, womit die Eignung gemeint ist.
Die aret ‚ eines Handwerkers zu Sokrates' Zeit war das Wissen über seine Arbeit und die Fähigkeit gute Arbeit zu leisten oder den Zweck seines Produktes direkt und plausibel erklären zu können. Sie hing von seinen Kenntnissen und vor allem von seinem Wissen darüber, was er produzierte, ab. Es war für Sokrates grundsätzlich sehr wichtig zu wissen, welches Ziel man verfolgt, bevor man sich über den Weg dorthin Gedanken machte. Das, was wir unter Tugend verstehen ist schließlich die Aufgabe, die sich jeden Menschen einzeln stellt, also nicht mehr die individuelle Ausübung des Berufes, sondern eine Aufgabe, die jeder Mensch gleichermaßen und für sich Selbst zu lösen hat. Die aret ‚ eines Menschen ist also nach Sokrates die Fähigkeit des Einzelnen, die Inhalte seiner Auffassung in die Tat umzusetzen.
Sokrates
Laut Sokrates wird das menschliche Handeln von der Vernunft bestimmt. Mit dem Wissen nichts zu wissen hält er sich für weiser als andere, hält jedoch Wissen an sich für erreichbar und Erkenntnis für wichtig. Für ihn gilt: Tugend ist die richtige Erkenntnis umgesetzt in Handeln. In einem Dialog mit Protagoras vertritt Sokrates anfangs die Meinung, dass Tugend nicht rein theoretisch zu vermitteln und daher auch nicht lehrbar ist. Er erkennt, dass Tugend Wissen und Erkenntnis umgesetzt in Taten und damit doch lehrbar und erlernbar ist. Die Erkenntnis und die Einsicht sind wichtig, um das eigene Handeln zu verstehen. Da Wissen und Erkenntnis lehrbar sind, muss auch Tugend - zumindest zu einem gewissen Teil - lehrbar sein. Damit spricht Sokrates der Erkenntnis einen hohen Stellenwert zu und man kann den Satz "Der Wissende ist weise, der Weise ist gut" als Fazit dieses Gespräches ansehen. Die Tatsache, dass sich sein Standpunkt vom Anfang des Gespräches im Lauf des Dialoges gewendet hat, liegt an seiner weitgefächerten Auffassung der Vernunft, des Logos. (griechisch: Wort, Satz, Erwägung, vernünftiger Grund, Denkvermögen, Vernunft, Weltgesetz.) Für Sokrates ist der Logos stark und verlässlich, er sagt: "Mein ganzes Leben halte ich es so, dass ich nichts anderem gehorche als dem Logos, der sich mir in der Untersuchung als der Beste erweist." Für Sokrates bilden Denken und Handeln eine Einheit, das heißt, wer das Gute erkennt, der tut es auch und wer das Schlechte tut, der erkennt es als Gutes, irrt sich also.
Damit ist nicht die Tat an sich ein Fehler, sondern es mangelt an Wissen, an Einsicht. Schließlicht handelt doch jeder nach dem, was er für gut hält, und damit kann nur derjenige tugendhaft sein, der weiß, was gut ist. Also sind Vernunft und Wissen vor allem aber Selbsterkenntnis die Voraussetzung für Tugend Wissen schließt das eigene Wollen ein, das ist die Quintessenz der sokratischen Lehre. Ein Erkennen von Tugend bedeutet ein tugendhaftes Leben führen wollen und danach handeln. Die Tugend beruht auf Wissen und Einsicht. Das Unwissen des schlecht Handelnden ist nicht bloßer Informationsmangel; es ist ein Zeichen der inneren Unfähigkeit, Tugend zu erkennen.
Tugend und Wissen sind das Fundament für das höchste Gut, die Glückseligkeit, diese wird durch einen vernünftigen und tugendvollen Lebensstil, nicht durch Reichtum und Luxus sondern durch Mäßigung und Selbstbeherrschung gewährleistet. Die Vernunft und Tugend macht den Menschen gottähnlich und unterscheidet ihn damit von den Tieren.
Sokrates: Tugend ist das Streben nach dem Guten
Menon behauptet, nicht alle Menschen wollen das Gute, sondern manche das Böse. Aus dem Dialog mit Sokrates geht hervor, dass diejenigen, die das Böse anstreben es entweder nicht als böse erkennen, oder fälschlicherweise als gut betrachten, indem sie denken, es sei ihnen nützlich. Damit kommt Menon zu dem Schluss, dass alle Menschen das begehren, was sie jeweils für gut halten, also streben alle Menschen grundsätzlich nach dem Guten.
Sokrates: Tugend ist das Vermögen, das Gute herbeizuschaffen
Hier erweitert Sokrates den Tugendbegriff, der zuvor noch so umschrieben wurde: Tugend ist, das Gute zu wollen und es zu vermögen. Da - wie aus dem letzten Dialog hervorgeht, jeder das Gute will, wird nun danach unterschieden, wer es am Besten erreichen kann, damit ist die Definition schließlich: Tugend ist das Vermögen, das Gute herbeizuschaffen.
Platon
Platon führt Sokrates' Überlegungen über das Wissen um die Tugend und deren Lehrbarkeit fort.
Sokrates befragte einen Jungen nach dem Ergebnis einer unbekannten Mathematikaufgabe. Der Junge kam auf das richtige Ergebnis, obwohl Sokrates nur maieutisch nachgeholfen hat, er hat gefragt aber nicht gelehrt, damit hat der Junge das Ergebnis alleine herausgefunden. Hier ist also Lernen sowie apriorisches Wissen - Vorwissen - beteiligt, d.h. es gilt nicht, zu fragen, ob das Wissen von vorne herein (a priori) vorhanden war oder erlernt wurde, sondern man muss einsehen, dass Wissen sowohl a priori da war als auch erlernt wurde. Platon bezeichnet Lernen daher als Besinnung auf ureigenes Wissen (Anamnesis). Der Begriff "angeboren" ist nur eine ungenaue Übersetzung dafür. Damit ist Tugend als sittliches Wissen auch ein Stück weit a priori vorhanden und somit lehrbar.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Stefan Wittes Ethik Referat über Tugend?
Das Referat untersucht den Begriff der Tugend, sowohl in der modernen Verwendung als auch im Kontext der antiken Philosophie, insbesondere bei Sokrates und Platon. Es analysiert, ob der Begriff Tugend noch relevant ist und wie er sich im Laufe der Zeit verändert hat.
Welche Beispiele für Tugend werden im Referat angeführt?
Das Referat nennt drei Beispiele: Einen französischen Fechter bei den Olympischen Spielen 1928, der zugibt, getroffen worden zu sein und somit auf die Goldmedaille verzichtet; ein deutsches Ehepaar, das während des Zweiten Weltkriegs drei polnische Jüdinnen versteckt und versorgt; und Mutter Teresa, die die Wunden eines Patienten pflegt, obwohl dies ekelerregend ist.
Wie wird der Begriff Tugend definiert?
Tugend wird definiert als die durch Selbsterziehung gewonnene sittliche Grundhaltung eines Menschen, die sich in seinem Denken und Handeln als echte Menschlichkeit äußert.
Wie hat sich der Tugendbegriff im Laufe der Zeit verändert?
Eigenschaften wie Ordnungsliebe, Fleiß und Sparsamkeit, die im 18. Jahrhundert als "bürgerliche Tugenden" galten, haben den Begriff Tugend in Verruf gebracht. Tugenden wie Großmut und Demut haben an Bedeutung verloren und wurden durch Toleranz, Fairness und Solidarität ersetzt. Nächstenliebe und Gerechtigkeit gelten als zeitlose Tugenden.
Wie wurde Tugend in der Antike verstanden?
In der Antike, insbesondere bei Sokrates, bedeutete Tugend (areté) Tauglichkeit oder Tüchtigkeit. Es war die Fähigkeit, gute Arbeit zu leisten und den Zweck des eigenen Handelns zu erklären. Für Sokrates war es wichtig, das Ziel des eigenen Handelns zu kennen, bevor man sich Gedanken über den Weg dorthin machte.
Was war Sokrates' Ansicht über Tugend und Wissen?
Sokrates glaubte, dass menschliches Handeln von der Vernunft bestimmt wird. Er hielt Wissen für erreichbar und Erkenntnis für wichtig. Für ihn ist Tugend die richtige Erkenntnis, umgesetzt in Handeln. Er war der Meinung, dass Tugend lehrbar ist, da sie auf Wissen und Erkenntnis basiert. Wer das Gute erkennt, tut es auch; wer das Schlechte tut, irrt sich und handelt aus Unwissenheit.
Was sagte Menon über das Streben nach dem Guten?
Menon argumentierte, dass nicht alle Menschen das Gute wollen, sondern manche das Böse. Sokrates entgegnete, dass diejenigen, die das Böse anstreben, es entweder nicht als böse erkennen oder es fälschlicherweise als gut betrachten, weil sie denken, es sei ihnen nützlich. Daraus schloss Menon, dass alle Menschen grundsätzlich nach dem Guten streben.
Wie hat Sokrates den Tugendbegriff erweitert?
Sokrates erweiterte den Tugendbegriff von "das Gute zu wollen" zu "das Gute zu vermögen". Da jeder Mensch das Gute will, wird danach unterschieden, wer es am besten erreichen kann. Tugend ist also das Vermögen, das Gute herbeizuschaffen.
Welche Rolle spielt Wissen bei Platon?
Platon führte Sokrates' Überlegungen über Wissen und Lehrbarkeit der Tugend fort. Er argumentierte, dass Lernen eine Besinnung auf ureigenes Wissen (Anamnesis) ist. Tugend ist als sittliches Wissen ein Stück weit a priori vorhanden und somit lehrbar.
Welche Kardinaltugenden definierte Platon?
Platon legte vier Kardinaltugenden fest: Mäßigkeit, Tapferkeit, Weisheit und die den anderen übergeordnete Gerechtigkeit.
- Quote paper
- Stefan Witte (Author), 1997, Der Tugendbegriff - von der Antike bis heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103662