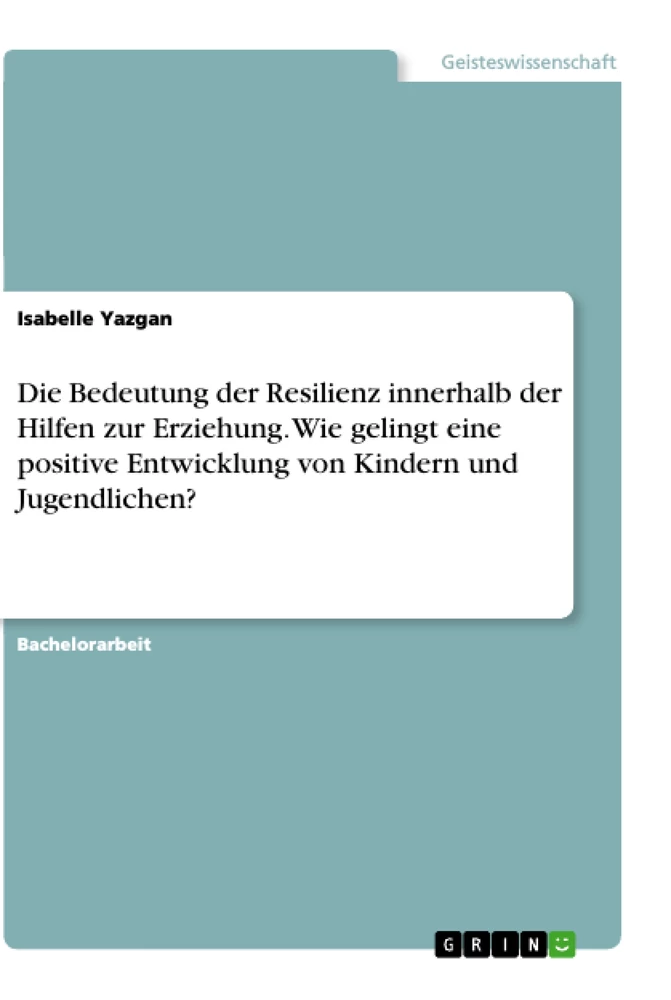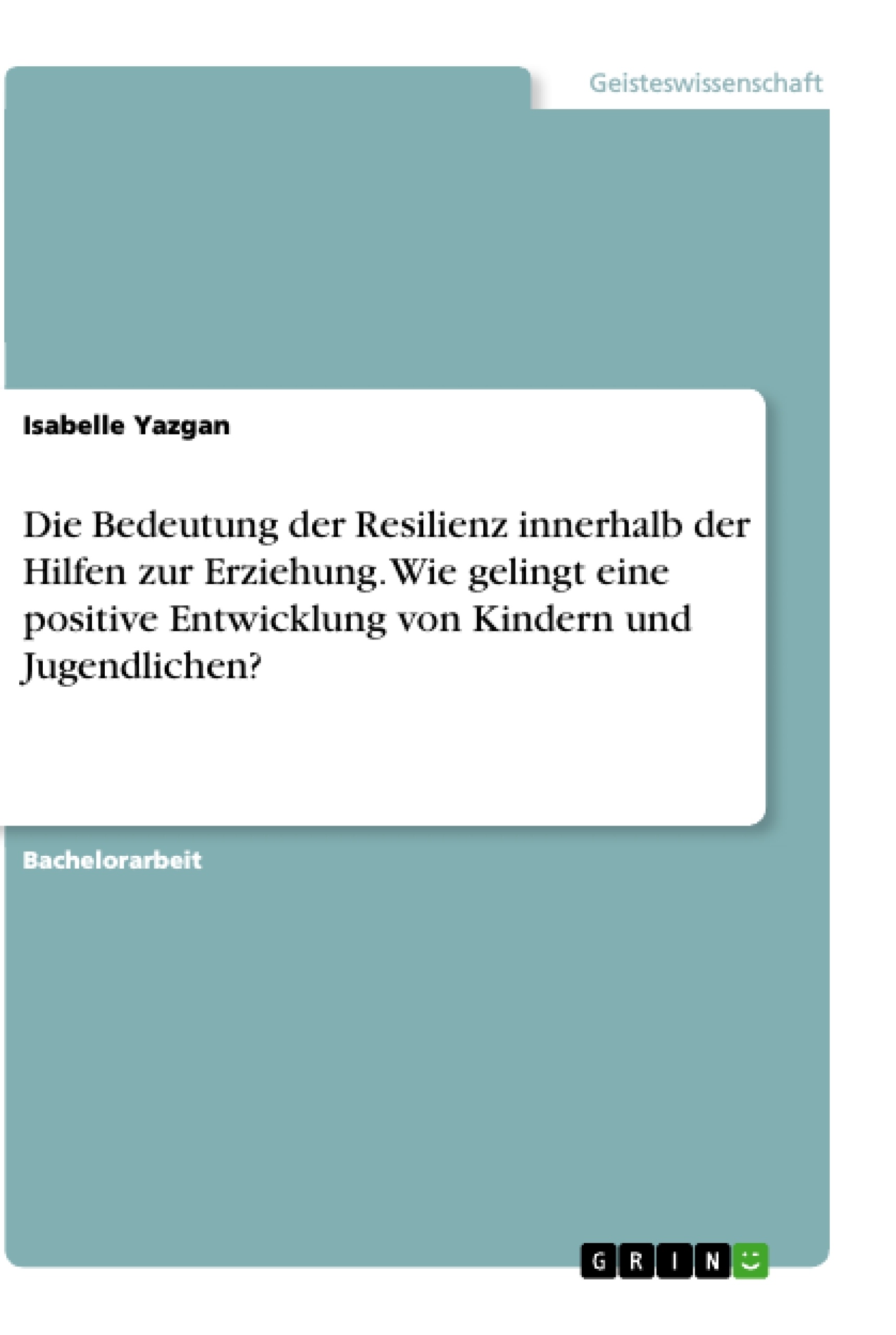Der vorliegenden Bachelorarbeit liegt die Forschungsfrage zugrunde, welche Bedeutung Resilienz in Bezug auf eine positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zufällt und wie Resilienzförderung als Konzept innerhalb der Arbeitsfelder der Hilfen zur Erziehung stattfinden kann.
Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde die vorliegende Bachelorarbeit als Literaturarbeit verfasst, welche die Ergebnisse deutscher und englischer Fachliteratur einbezieht, die innerhalb der letzten 20 Jahre publiziert wurde. Hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfrage wurden Schwerpunkte gesetzt, welche sich mit der Entstehung von Resilienz, der Resilienzforschung sowie dem Konzept der Resilienzförderung in der Praxis der Hilfen zur Erziehung benennen lassen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass sich Resilienz in einem dynamischen Prozess und aus der Interaktion eines Kindes mit seiner Umwelt ergibt. Dieser Prozess ist abhängig von dem Zusammenspiel der Risiko- und Schutzfaktoren im Leben eines Kindes. Daraus ergibt sich für Kinder und Jugendliche die Chance auf eine gelingende Entwicklung trotz belastender Lebensumstände. Für die Arbeitsfelder der Hilfen zur Erziehung ergibt sich daraus die Möglichkeit eine resiliente Entwicklung der Zielgruppe zu fördern, indem das Konzept im pädagogischen Alltag der Fachkräfte sowie durch gezielte Präventionsprogramme Anwendung finden kann. Die Ergebnisse zeigen auch, dass hinsichtlich einer Begriffsbestimmung, sowie dem Entstehungsprozess der Resilienz kein wissenschaftlicher Konsens besteht. Auf dieser Grundlage ist es empfehlenswert durch interdisziplinäre Zusammenarbeit einen theoretischen Rahmen zu schaffen, welcher auch eine angemessene Anwendung des Konzepts in der Praxis ermöglicht.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsangabe
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methodisches Vorgehen
- 3. Resilienz
- 3.1. Begriffsbestimmung
- 3.2. Wesentliches
- 4. Entstehung von Resilienz
- 4.1. Risikofaktoren
- 4.2. Schutzfaktoren
- 4.3. Resilienzmodelle
- 4.3.1. Rahmenmodell der Resilienz nach Kumpfer
- 4.4. Bezugsmodelle
- 4.4.1. Salutogenesemodell nach Antonovsky
- 4.4.2. Transaktionales Stresskonzept nach Lazarus
- 5. Resilienzforschung
- 5.1. Kauai-Studie
- 5.2. Mannheimer Risikokinderstudie
- 5.3. Bielefelder Invulnerabilitätsstudie
- 6. Resilienzförderung in den Hilfen zur Erziehung
- 6.1. Sozialpädagogische Familienhilfe als ambulante Hilfeform
- 6.2. Heimerziehung als stationäre Hilfeform
- 6.3. Grundprinzipien
- 6.4. Präventionsarbeit in den Hilfen zur Erziehung
- 6.4.1. FAST als Schnittstellenprogramm
- 6.4.2. Fit for Life
- 7. Diskussion
- 8. Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung von Resilienz für die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Kontext der Hilfen zur Erziehung. Sie analysiert, wie Resilienz als Konzept in der Praxis der Hilfen zur Erziehung angewandt werden kann und welche Rolle sie bei der Bewältigung von Belastungen und Herausforderungen spielt.
- Definition und Entstehung von Resilienz
- Risiko- und Schutzfaktoren, die die Resilienzentwicklung beeinflussen
- Empirische Forschungsergebnisse zur Resilienz und ihren Auswirkungen
- Resilienzförderung in verschiedenen Hilfeformen der Hilfen zur Erziehung
- Theoretische und praktische Implikationen des Konzepts der Resilienzförderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Resilienz ein und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor. Sie erläutert die Relevanz des Themas und die Ziele der Arbeit.
- Kapitel 2: Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Herangehensweise der Arbeit und erläutert die verwendeten Forschungsmethoden.
- Kapitel 3: Resilienz: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Begriffsbestimmung von Resilienz und beschreibt wichtige Aspekte dieses Konzepts.
- Kapitel 4: Entstehung von Resilienz: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung von Resilienz und beleuchtet die Rolle von Risiko- und Schutzfaktoren. Es stellt verschiedene Resilienzmodelle vor, insbesondere das Rahmenmodell der Resilienz nach Kumpfer.
- Kapitel 5: Resilienzforschung: Dieses Kapitel präsentiert wichtige empirische Studien zur Resilienz, wie zum Beispiel die Kauai-Studie, die Mannheimer Risikokinderstudie und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie.
- Kapitel 6: Resilienzförderung in den Hilfen zur Erziehung: Dieses Kapitel untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Resilienzförderung in verschiedenen Hilfeformen der Hilfen zur Erziehung, wie zum Beispiel der sozialpädagogischen Familienhilfe und der Heimerziehung. Es beleuchtet auch die Bedeutung von Präventionsarbeit in diesem Kontext.
- Kapitel 7: Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Arbeit und analysiert die Implikationen für die Praxis der Hilfen zur Erziehung.
Schlüsselwörter
Resilienz, Hilfen zur Erziehung, Kinder und Jugendliche, positive Entwicklung, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Resilienzmodelle, Resilienzforschung, Präventionsarbeit, pädagogische Praxis.
- Arbeit zitieren
- Isabelle Yazgan (Autor:in), 2021, Die Bedeutung der Resilienz innerhalb der Hilfen zur Erziehung. Wie gelingt eine positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1035943