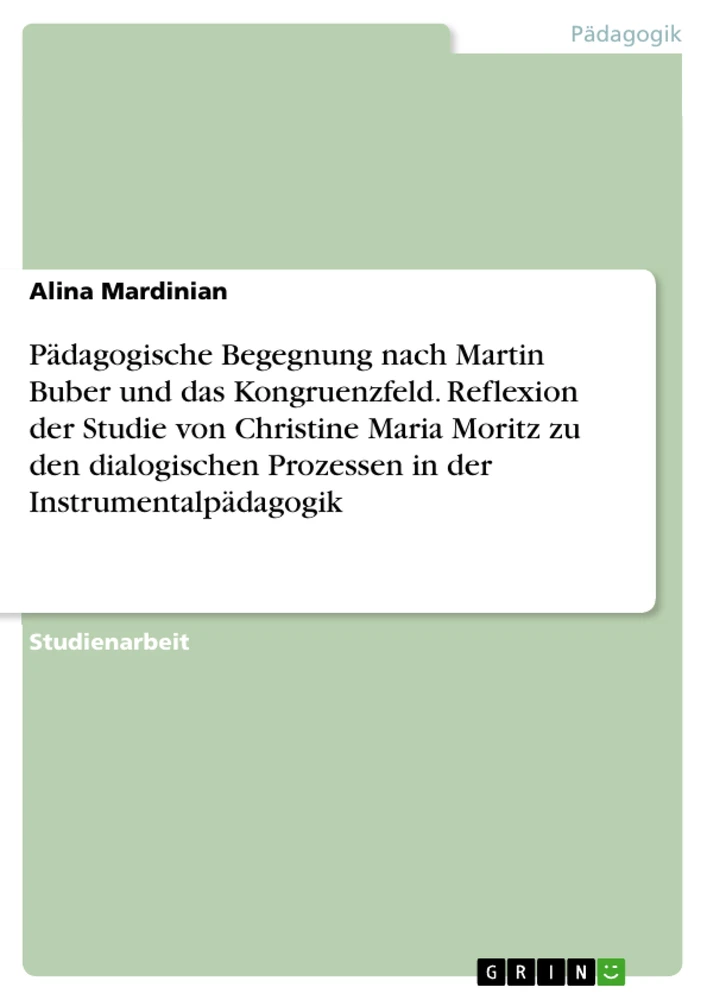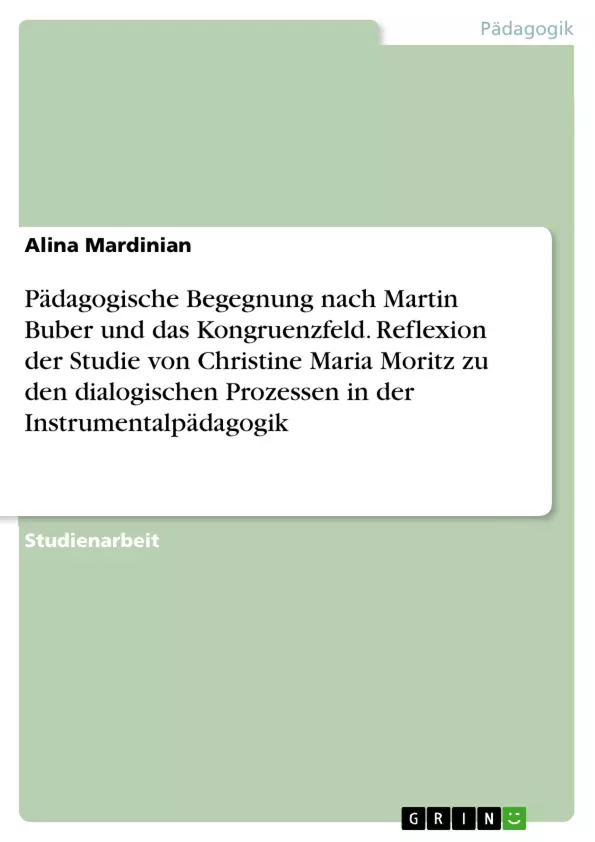Die vorliegende Ausarbeitung stellt die Ergebnisse einer Untersuchung dar, die sich mit der empirischen Annäherung an das Phänomen der Begegnung nach Martin Buber im Kontext des Klavierunterrichts befasst. Die Forscherin und Klavierpädagogin Christine Maria Moritz sucht in ihrer Dissertation die geeigneten Forschungswege für die Beobachtung und Beschreibung des Phänomens und grenzt dabei heuristische, didaktische und forschungsmethodische Interessenbereiche ein. In allen drei Bereichen gelingt der Wissenschaftlerin eine produktive Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial und führt sie in der ersten Forschungsphase zu der Entwicklung eines heuristischen Kategoriensystems des „Dialogischen Kubus“, welches gleichzeitig den Begriffsrahmen eines in der zweiten Phase der Forschung entstandenen didaktischen Modells des „Kongruenzfeldes“ dient.
Als ein innovatives Fo-schungsprodukt der letzten Forschungsphase gilt das, von Christine Moritz entwickelte Analyse- und Transkriptionssystem „Feldpartitur“, das für das Erfassen des pädagogischen Interaktionsgeschehens in den Videodaten geeignet ist. Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist eine reflexive Auseinandersetzung mit dem Versuch von Christine Maria Moritz, sich dem Phänomen der dialogischen Begegnung im pädagogischen Kontext empirisch anzunähern und dieses in Form eines didaktischen Konzeptes bzw. innerhalb der didaktischen Kategorie „Kongruenzfeld“ auszuformulieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Dialogphilosophie und des pädagogischen Bezugs nach Buber
- Bubers dialogisches Welt- und Menschverständnis
- Du-Bezug und Es-Bezug in der Dialogphilosophie
- Transzendenzaspekt des Beziehungsbegriffs
- Begegnung im Ich‐Du‐Verhältnis
- Begegnung im Kontext des Ich‐Es‐Verhältnisses
- Pädagogische Begegnung im dialogischen Kontext
- Das erzieherische Verhältnis im Lichte der Dialogik nach Buber
- Ich-Du -Aspekte des erzieherischen Verhältnisses nach Buber
- Die pädagogische Begegnung
- Empirische Erforschung der dialogischen Prozesse (Moritz 2010)
- Theoretische Aspekte der Dialogphilosophie in dem Forschungsvorhaben
- Dialogphilosophische Ideen als (a‐) theoretisches Hintergrundwissen
- Begegnung nach Buber als kommunikative Gesamthandlung
- Offenheit als ein Aspekt der qualitativen Forschung
- Forschungsinteresse
- Forschungsfrage, ‐methode und ‐design
- Ergebnisse der Studie im Überblick
- Dialogischer Kubus und Kongruenzfeldmodell
- Dialogischer Kubus als ein heuristisches Rahmenmodell der Studie
- Theorieelemente und Entstehungsbedingungen des Kongruenzfeldes
- Verfügbarkeit und Vereinseitigung
- Gemeinsames Lebensraum (GLR) und seine Konstruktion
- Das Eigene und das Andere im Kongruenzfeld
- Führungsstile/Steuerungsmodelle der Lehrkräfte
- Kongruenzfeld und Kongruenzfeldereignis
- Empirische Merkmale eines Kongruenzfeldes
- Kongruenzfeldereignis und seine Phasen
- Die pädagogische Begegnung und das Kongruenzfeld
- Reflexion der Studienergebnisse in dem dialogischen Paradigma
- Didaktische und forschungsmethodische Implikationen des Kongruenzfeldmodells
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der empirischen Untersuchung der dialogischen Begegnung im Klavierunterricht nach Martin Buber. Die Arbeit analysiert das Kongruenzfeldmodell, das von Christine Maria Moritz in ihrer Dissertation entwickelt wurde, und untersucht dessen Relevanz für die pädagogische Praxis und Forschung.
- Empirische Annäherung an das Phänomen der Begegnung nach Buber im Kontext des Klavierunterrichts
- Entwicklung eines didaktischen Konzeptes, das sich auf die Kategorie "Kongruenzfeld" fokussiert
- Reflexion der Forschungsergebnisse in Bezug auf die pädagogische Begegnung nach Buber
- Didaktische und forschungsmethodische Implikationen des Kongruenzfeldmodells
- Transfermöglichkeiten des Kongruenzfeldmodells in das Feld der Frühpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2 und 3: Diese Kapitel legen die Grundlagen der Dialogphilosophie und des pädagogischen Bezugs nach Martin Buber dar. Hier wird Bubers Welt- und Menschverständnis, der Du-Bezug und der Es-Bezug in seiner Dialogphilosophie erläutert. Weiterhin wird die Bedeutung der pädagogischen Begegnung im dialogischen Kontext beleuchtet.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit der empirischen Erforschung der dialogischen Prozesse in der Instrumentalpädagogik durch Christine Maria Moritz (2010). Es werden die theoretischen Aspekte der Dialogphilosophie im Forschungsprojekt von Moritz, deren Forschungsinteresse, -methode und -design sowie die Ergebnisse der Studie vorgestellt.
- Kapitel 5: Hier werden das heuristische Rahmenmodell der Studie, der Dialogische Kubus, und das didaktische Konzept des Kongruenzfeldes erläutert. Das Kapitel beschreibt die wichtigsten Theorieelemente des Kongruenzfeldmodells, die Entstehung des Gemeinsamen Lebensraums und die Rolle des Eigenen und des Anderen im Kongruenzfeld. Außerdem werden die Führungsstile/Steuerungsmodelle der Lehrkräfte im Kontext des Kongruenzfeldes beleuchtet.
- Kapitel 6: In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse des Kongruenzfeldmodells mit den theoretischen Grundlagen der pädagogischen Begegnung nach Buber in Verbindung gebracht. Es werden die Relevanz des Konzepts für die pädagogische Praxis und Forschung sowie seine Transfermöglichkeiten in die Frühpädagogik diskutiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind die Dialogphilosophie nach Martin Buber, pädagogische Begegnung, Kongruenzfeldmodell, Dialogischer Kubus, Instrumentalpädagogik, empirische Forschung, Frühpädagogik, Bildungsprozesse und Interaktion.
- Quote paper
- Alina Mardinian (Author), 2021, Pädagogische Begegnung nach Martin Buber und das Kongruenzfeld. Reflexion der Studie von Christine Maria Moritz zu den dialogischen Prozessen in der Instrumentalpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1035325