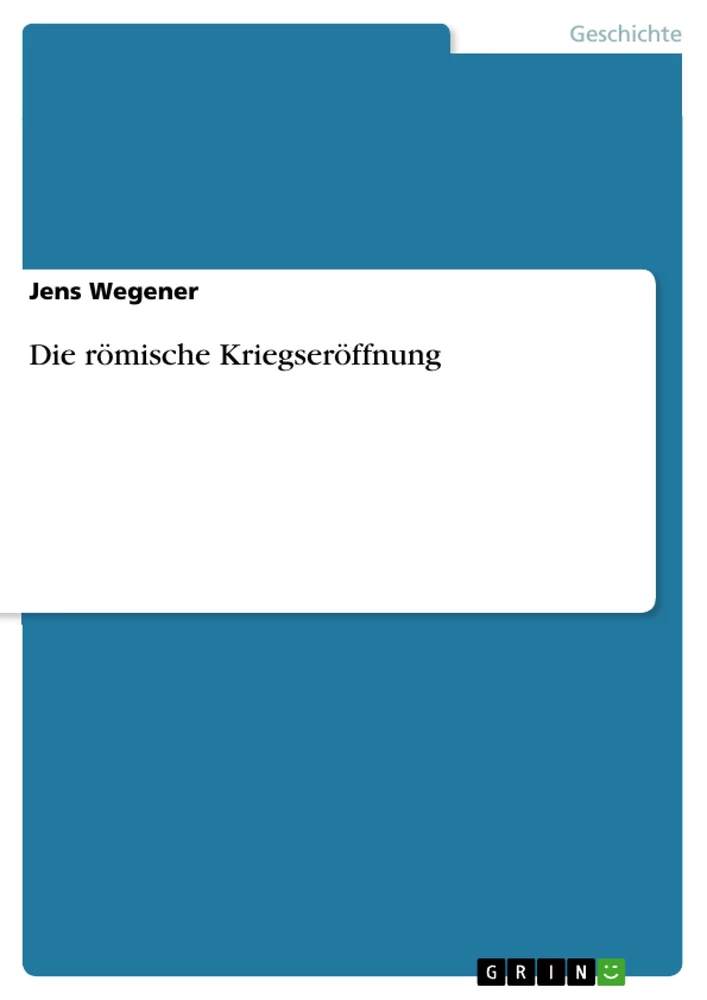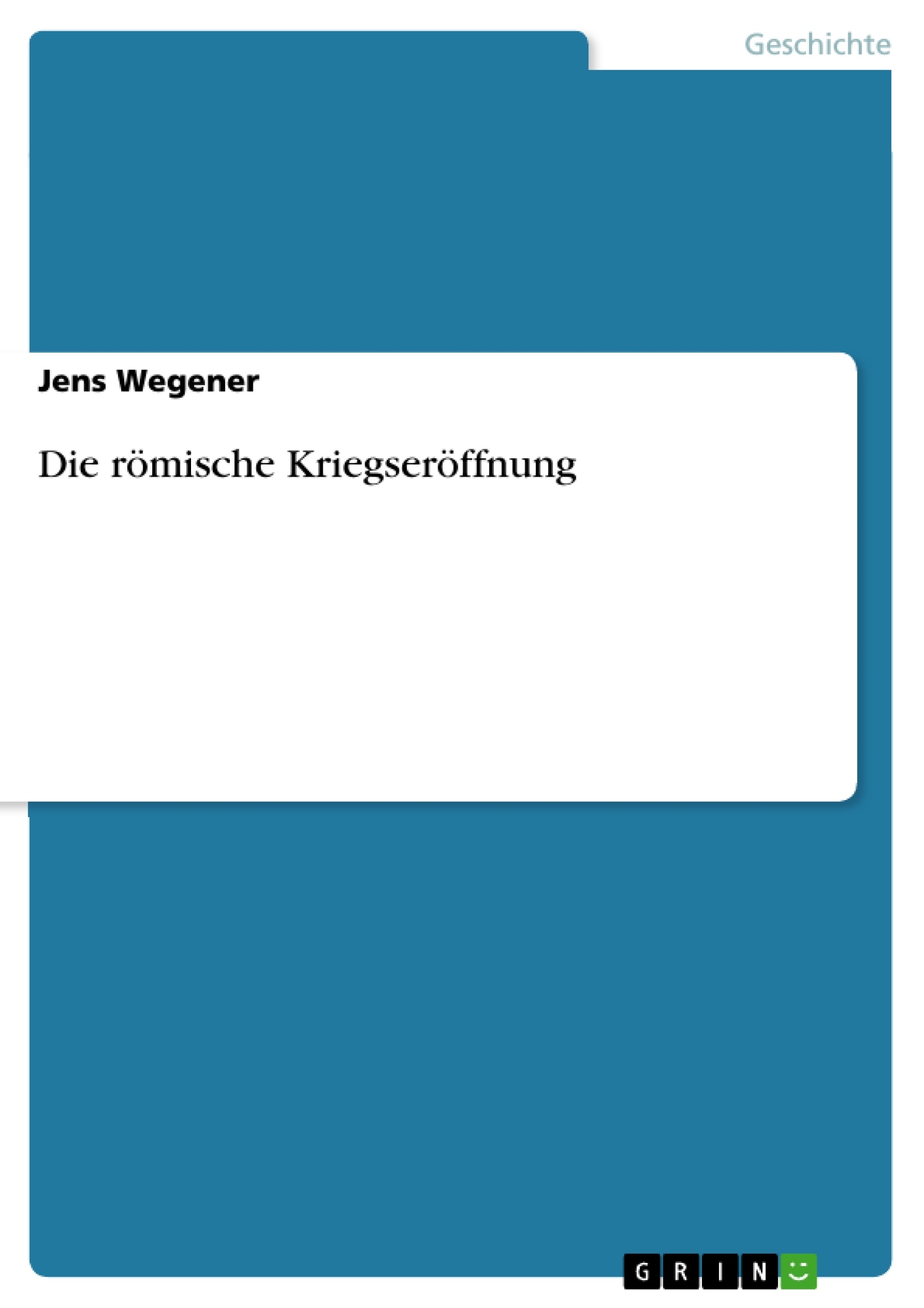In einer Welt, in der Recht und Religion untrennbar miteinander verwoben waren, offenbart sich das faszinierende Schauspiel der römischen Kriegseröffnung. Diese tiefgründige Analyse entführt den Leser in das Herz des antiken Rom, um die komplexen Rituale und rechtlichen Grundlagen zu ergründen, die einen römischen Krieg legitimierten. Im Zentrum steht das Fetialrecht, ein uraltes Regelwerk, das durch das gleichnamige Priesterkollegium gehütet wurde. Die Untersuchung beleuchtet detailliert den Ablauf der Kriegserklärung, von der sorgfältigen Prüfung der Kriegsbegründung (causa belli) über die feierliche Forderung nach Wiedergutmachung (rerum repetitio) bis hin zum symbolträchtigen Speerwurf (indictio belli), der den eigentlichen Kriegsbeginn markierte. Doch war jeder römische Krieg wirklich gerecht (bellum iustum)? Anhand historischer Beispiele, wie dem Jugurthinischen Krieg, dem Konflikt mit den Statellaten und dem Zweiten Punischen Krieg, wird die Diskrepanz zwischen idealer Theorie und politischer Realität schonungslos aufgedeckt. Die Arbeit verfolgt die Entwicklung des Fetialrechts von seiner religiös geprägten Frühzeit über seine Säkularisierung in der Republik bis hin zur propagandistischen Wiederbelebung im Kaiserreich unter Augustus und Mark Aurel. Dabei wird deutlich, wie sich die Intentionen hinter der Kriegseröffnung wandelten: von einem aufrichtigen Bemühen um göttliche Legitimation zu einem bloßen Instrument der Machtpolitik. Diese Studie bietet nicht nur ein tiefes Verständnis der römischen Kriegführung, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die Werte und Überzeugungen, die das antike Rom prägten. Sie ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für römische Geschichte, Rechtsgeschichte, Religionsgeschichte und die faszinierende Verbindung von Krieg, Recht und Religion interessieren. Erleben Sie, wie Rom seine Kriege begann – und was dies über seine Seele verrät. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Diplomatie und Rituale über das Schicksal von Nationen entschieden. Entdecken Sie die verborgenen Motive hinter den römischen Feldzügen und gewinnen Sie neue Einblicke in die Denkweise einer Weltmacht.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Die römische Kriegseröffnung
A) Das Fetialkollegium
B) Der Fetialritus in seiner Idealform
C) Die Säkularisierung des Fetialritus
D) Das Wiederaufleben des Fetialritus in der Kaiserzeit
III. Historische Beispiele
A) Ein Bellum Iustum: Der Jugurthinische Krieg
B) Ein Bellum Iniustum: Der Krieg gegen die Statellaten
C) Ein formal gerechter Krieg: Der 2. Punische Krieg
IV. Fazit
V. Literaturverzeichnis
VI. Übungsbibliographie
I. Einleitung:
Die vorliegende Arbeit hat die römische Kriegseröffnung zum Inhalt und konzentriert sich hierbei insbesondere auf das ursprüngliche rechtlich-religiöse Fundament dieser Kriegseröffnungen: Das römische Fetialrecht. Vor allem wird hierbei zu klären sein, warum die Römer solch eine komplizierte und zeitraubende, in späterer Zeit auch reichlich veraltete Prozedur befolgten, um einen Krieg zu beginnen. Diese religiöse Form der Kriegseröffnung ist uns vor allem durch die Werke des Livius und des
Dionysios Halikarnassos überliefert worden. Vor allem Livius liefert eine sehr detaillierte Beschreibung dieser Prozedur. Die Ursprünge des Fetialrechts liegen weitestgehend im Dunkeln: Weder über die Herleitung des Wortes fetiales noch über den Ursprung des ius fetiale besteht Klarheit.1
II. Die römische Kriegseröffnung
A) Das Fetialkollegium:
Die Fetialen zählten mit zu den ältesten Priesterkollegien Roms und standen im Range den großen Kollegien der augures und pontifices nahe. Das Kollegium bestand aus 20 Mitgliedern, die sich, wie in allen Priesterkollegien üblich, durch Kooptation ergänzten.2 Über das äußere Erscheinungsbild der Fetialen ist nichts bekannt, außer, daß es ihnen verboten war, Kleidung aus Leinen zu tragen. Dies läßt sich dadurch erklären, daß die Römer Leinen als eine archaische Rüstung ansahen. Daraus folgert, daß die Fetialen in den Augen der Römer eher eine kriegsverhindernde Funktion hatten.3
Die ursprüngliche Funktion der Fetialen bestand wohl darin, durch die Etablierung eines rechtlich verbindlichen völkerrechtlichen Rahmens, die private Kriegführung einzelner gentes einzuschränken und unter Kontrolle zu halten. Dies sollte den römischen Staat vor einer Verwicklung in eine unüberschaubare Zahl von Privatkonflikten schützen. Hauptaufgabe der Fetialen war es daher, völkerrechtliche Gutachten im Auftrage der Magistraten oder des Senats zu erstellen. Sie waren außerdem verantwortlich für Auslieferungen römischer Bürger, schlossen
Bündnisverträge und vollzogen Kriegserklärungen. Wenn die Fetialen nicht, wie beim Auftreten als Gutachter, als geschlossenes Kollegium in Erscheinung traten, so traten sie vermutlich immer in Zweier- oder Vierergruppen auf. Bei der ursprünglichen Form der Kriegseröffnung ist wohl der Auftritt einer Vierergruppe wahrscheinlich. Die Voraussetzung für die Aktivierung des Fetialkollegiums in einer Kriegsangelegenheit war es, daß der Gegner ein organisiertes Gemeinwesen von einer beträchtlichen Größe war. Weiterhin ist es wichtig, festzustellen, daß die Kriegserklärung durch die Fetialen eine Prozedur zur Einleitung eines Angriffskrieges war, da im Falle der Verteidigung gegen einen Angriff das Recht auf Verteidigung einsetzte, und die Fetialen nicht mehr eingeschaltet zu werden brauchten.
B) Der Fetialritus in seiner Idealform
a) Beauftragung
Bei einer anstehenden Kriegseröffnung konnten Fetialen erst tätig werden, wenn eine Beauftragung durch den König oder den Senat vorausgegangen war. Lag diese Beauftragung vor, holte ein Fetiale ein Kräuterbüschel, das sagmen, vom Kapitol und kehrte damit zum Kollegium zurück. Wie dieser nun als verbenarius auftretende Fetiale bestimmt wurde, ist unklar. Der verbenarius berührte nun einen anderen Fetialen mit dem sagmen am Kopf und am Haar und ernannte ihn dadurch zum pater patratus, der fortan als Sprecher der Fetialen in dieser Angelegenheit auftrat. Dieses Ritual kann damit erklärt werden, daß durch die Berührung des pater patratus mit der dem sagmen anhängenden Erde eine starke Identifikation des pater patratus mit der Stadt Rom erzielt werden sollte. Dies würde eine Analogie zur Weihe von Altären durch Auflegen von Erdschollen darstellen.4
b) rerum repetitio (auch clarigatio)
Nach vollzogener Beauftragung der Fetialen zog dann eine Gruppe von vermutlich vier Fetialen, bestehend aus dem pater patratus und drei Zeugen, zur Grenze des Gegners. Diese überschritten sie dann, während sie ihre Forderungen (rerum repetitio) unter Anrufung Jupiters als Zeugen vorbrachten. Die Forderungen wurden noch dreimal wiederholt, wenn sie den ersten Bürger der feindlichen Stadt trafen, wenn sie das Stadttor der Stadt durchschritten und wenn sie das Forum der Stadt erreichten.
Danach gewährten sie den Gegnern eine dreißigtägige Frist, während der sie die Forderungen dreimal wiederholten, um die Forderungen zu beantworten. Zwar berichtet Livius von einer Frist von 33 Tagen, steht mit dieser Angabe aber alleine da. Generell legt das häufige Auftreten der Zahl drei den Schluß nahe, daß es sich bei diesen präzisen Angaben eher um eine spätere Systematisierung der antiken Gelehrten handelt, als um gängige Praxis.5
c) denuntiatio (testatio)
Nachdem die Frist verstrichen war, stellte der pater patratus öffentlich fest, daß den gerechten Forderungen des römischen Volkes nicht genüge getan worden sei und daß der römische Senat nun eine Entscheidung fällen werde. Nach Erfüllung dieser Aufgabe kehrten die Fetialen nach Rom zurück.6
d) Votum des Senats
Nach ihrer Rückkehr nach Rom erstatteten die Fetialen, wieder vertreten durch den pater patratus, dem Senat Bericht ohne dabei einen konkreten Rat abzugeben. Auf diesen Bericht hin gaben die Senatoren ihr Votum über den Kriegsbeginn ab.7
e) Zustimmung des Volkes
Auf das Votum des Senats folgte dann die Abstimmung des Volkes durch die comitia centuriata. Ein Fall, in dem das Volk seine Zustimmung verweigerte, ist nicht bekannt.8
f) Indictio Belli
Die eigentliche Kriegseröffnung erfolgte dann, indem der pater patratus an die Grenze des Gegners zurückkehrte und dort eine blutrote Lanze in das feindliche Territorium schleuderte. Die blutrote Färbung der Lanze, die wohl durch die Verwendung von Kornelkirschenholz erzielt worden sein soll, läßt sich als Beschwörung des Untergangs des Kriegsgegners noch vor Beginn der Kampfhandlungen verstehen. Bemerkenswert ist auch, daß dieser Speerwurf keine offizielle Kriegserklärung, sondern lediglich eine Kriegseröffnung darstellte. Es war nicht nötig, daß bei diesem Ritual Repräsentanten des Feindes anwesend waren.
Die Authentizität dieses ganzen Speerwurfrituals darf jedoch für die Zeit der Republik generell angezweifelt werden, da es nicht zu den sonst eher kriegsverhindernden Aufgaben der Fetialen und insbesondere nicht zu dem Leinenverbot paßt. Des weiteren sind solche Speerwürfe bei anderen Völkern immer von den Feldherrn durchgeführt worden, nicht aber von Priestern. Schließlich ist Livius auch der einzige, der von einem solchen Speerwurf berichtet, was die Vermutung nahelegt, daß dieses Ritual eine Erfindung seiner Zeit ist.9
Der Grund für die penible Einhaltung dieser Prozedur während der frühen und mittleren Republik ist wohl in der starken Religiosität der Römer zu finden. Sie sahen den Krieg als eine Art der göttlichen Rechtsfindung. Daher waren sie bemüht, den Fall (causa belli) formal korrekt (ius fetiale) darzulegen, um dann im Krieg selber ein für sie günstiges Urteil der Götter zu erreichen. Folglich bedeutete ein gewonnener Krieg für die Römer, daß der Kriegsgrund gerecht gewesen war. Es handelte sich daher um einen bellum iustum et pium.10
C) Die Säkularisierung des Fetialritus
Als die Römer damit begannen, sich über die Grenzen Italien hinaus auszubreiten, wurde der Fetialritus zunehmend unpraktisch. Dies lag einerseits daran, daß es außerhalb Italiens keine Fetialkollegien gab, mit denen man hätte verhandeln können, und andererseits wurden die Reisen zu den feindlichen Städten zu zeitaufwendig. Daher ging man um 280 v. Chr. dazu über, die Kriegsverhandlungen an senatorische Abgesandte, legati, zu delegieren. Damit einher ging eine Veränderung des Ablaufes der Prozedur. Von nun an wurde die Entscheidung über den Krieg schon vor der Überbringung des rerum repetitio getroffen. Die legati waren also befugt, nach der Ablehnung des rerum repetitio sofort den Krieg zu erklären.
Das Resultat dieser Veränderungen war eine erhebliche Vereinfachung des Rituals, sowie seine Säkularisierung. Die Fetialen waren an den Kriegseröffnungen nun gar nicht mehr beteiligt.
D) Das Wiederaufleben des Fetialritus im Kaiserreich
Während der Zeit des Prinzipats erlebte das inzwischen antiquierte und ausgestorbene Fetialrecht eine Neubelebung. Als Octavian im Jahre 32. v. Chr. nach einem Weg suchte, gegen seinen Widersacher Antonius vorgehen zu können ohne offiziell einen Bürgerkrieg führen zu müssen, bediente er sich des Fetialritus. Er ließ den Senat Antonius für amtsunfähig erklären, da Kleopatra ihn mit Liebestränken abhängig gemacht habe, und erklärte dann mit Hilfe des Fetialritus einen bellum iustum gegen Kleopatra. Dabei trat Octavian selbst als Fetiale in Erscheinung und schleuderte am Tempel der Bellona den blutroten Speer.11 Der Speerwurfritus selbst wird wohl in dieser Zeit in Octavians Umfeld erfunden worden. In diesem Zusammenhang ist auch Livius‘ Interesse am Fetialritus zu sehen. Auch wenn Livius‘ Verhältnis zum Prinzipat nicht eindeutig geklärt ist, so ist doch sicher, daß er das Wiederaufleben der Staatsreligiosität unter Octavian begrüßte, und daß er von alten römischen Gebräuchen fasziniert war.12 Bei seiner Beschreibung des Fetialritus handelt es sich daher offenbar um einen fiktiven historischen Unterbau für die Anwendung des Ritus im Jahre 32. Durch eine Rückdatierung des Ritus, insbesondere des Speerwurfs, bis in die frühe Republik, sollte Octavians Handeln legitimiert werden.
Ein weiteres Beispiel für die Anwendung des Fetialrechts im Kaiserreich stammt aus dem Jahr 178 n. Chr., als Kaiser Mark Aurel mitten im Krieg gegen die Markomannen offenbar Teile des Fetialritus anwendete, um seine Truppen neu zu motivieren. Gerade diese Anwendung des Fetialritus durch den überzeugten Stoiker Mark Aurel zeigt, daß der Ritus zu dieser Zeit nur noch ein reines Propagandainstrument war.13
III. Historische Beispiele
Die folgenden Beispiele sollen aufzeigen, daß die Kriege der Römer keineswegs immer dem Fetialrecht folgten. Oftmals gab es auch belli inusti oder Kriege, die unter dem Deckmantel des korrekten Verfahrens den gerechten Grund vermissen ließen.
A) Ein Bellum Iustum: Der Jugurthinische Krieg
Als 112 v. Chr. Jugurtha und Adherbal um das Erbe Micipsas stritten, wurde unter Vermittlung Roms Numidien unter den beiden aufgeteilt. Doch Jugurtha fing bald an, Adherbal anzugreifen, um auch an dessen Teil zu kommen, und fing an, ihn in seiner Hauptstadt Cirta zu belagern. Die Hilferufe Adherbals beantwortete Rom mit einer Gesandtschaft, die ein Ende der Kampfhandlungen erreichen sollte. Als diese legati nicht erfolgreich war, schickte man eine neue Gesandtschaft mit einem unmittelbaren rerum repetitum zu Jugurtha. Als Jugurtha trotzdem Cirta eroberte und dabei auch noch einige italische Kaufleute umbringen ließ, faßten Senat und Volk den
Kriegsbeschluß, der dann von Konsul Scipio Nascia persönlich überbracht wurde. Bei diesem Krieg handelte es sich eindeutig um einen bellum iustum, da sowohl die Formalia erfüllt worden waren, als auch ein gerechter Grund gegeben war: Adherbal war ein socius et amicus des römischen Volkes.14
B) Ein Bellum Iniustum: Der Krieg gegen die Statellaten
Im Jahre 173 v. Chr. erhoben sich die Ligurer gegen die Römer. Obwohl die Statellaten als einziger ligurischer Volksstamm sich nicht an dem Aufstand beteiligt hatten, wurde nach dem entscheidenden Sieg der Römer bei ihrer Stadt Caristum jene Stadt zerstört und 10.000 Statellaten in die Sklaverei verkauft. Als dies in Rom bekannt wurde, gab der Senat dem Urheber der Aktion, Prokonsul M. Popilius, die Anweisung, die Statellaten wieder freizulassen und zu entschädigen. Statt dessen kam Popilius nach Rom und forderte die Aufhebung des Senatsbeschlusses sowie ein Dankfest für seine Verdienste. Nachdem er beides nicht erreicht hatte, ging er nach Ligurien zurück und ließ in einem weiteren Feldzug erneut 6.000 Statellaten abmetzeln, was zu einem neuen Aufstand der übrigen Ligurer führte. Eine Untersuchung des Senats verlief im Sande als 172 Popilius‘ Bruder Konsul wurde.15 Beim Vorgehen des M. Popilius handelte es sich eindeutig um einen bellum iniustum, da weder die Formalia eingehalten worden waren, noch ein gerechter Grund vorlag. Dies zeigte sich den Römern vor allem dadurch, daß sein Vorgehen einen erneuten Aufstand der Ligurer nach sich zog, die Götter also sofort strafend eingriffen.
C) Ein formell gerechter Krieg: Der 2. Punische Krieg
Bei diesem Krieg ist es nicht eindeutig klar, inwieweit ein bellum iustum gegeben ist: Zwar hielten die Römer sich an alle Formalitäten, die nach der Säkularisierung des Fetialrechts für einen gerechten Krieg erforderlich waren, aber der Kriegsgrund ist eher zweifelhaft, da sie Karthago gegenüber geltend machten, Hannibal habe Sagunt nicht angreifen dürfen, da Rom in einem fides Verhältnis zu Sagunt stehe. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich jedoch, daß gerade dieses fides Verhältnis einen Bruch des Ebrovertrages, sowie des Friedensvertrages von 241 darstellte, da beide Verträge die Machtbereiche der beiden Städte voneinander abgrenzte. Folglich hätte sich Rom gar nicht in die Angelegenheiten einer Stadt, die südlich des Ebro lag, einmischen dürfen. Ein gerechter Kriegsgrund fehlte also.16
IV. Fazit:
Die Antwort auf die Frage nach dem Grund für die Befolgung des Fetialrechts muß zeitlich differenziert werden. Es lassen sich drei größere Anwendungsperioden einteilen:
- Das Fetialrecht in seiner ursprünglichen Form zu Beginn der Republik: Zu dieser Zeit standen religiöse Motive im Vordergrund. Man glaubte nur durch die Einhaltung bestimmter Rituale, die Gunst der Götter für den bevorstehenden Krieg erreichen zu können.
- Die säkularisierte Form des Fe tialrechts in der mittleren und späten Republik:
In der mittleren und späten Republik waren die religiösen Aspekte der Kriegseröffnung stark zurückgegangen. Insbesondere durch die Berührung mit hellenistischen Kriegskonzeptionen machte man das Kriegsrecht praktikabler und führte offizielle Kriegserklärungen ein.
- Das Wiederaufleben des Fetialrechts im Kaiserreich:
In dieser letzten Gebrauchsperiode diente der Fetialritus ausschließlich nur noch Propagandazwecken. Auch wenn der Wunsch das Volk zu mobilisieren auch während der anderen Perioden sicherlich eine Rolle gespielt hatte, so hatte dies aber nie so im Vordergrund gestanden wie zur Kaiserzeit.
V. Literaturverzeichnis
Albert, Sigrid: Bellum Iustum, Frankfurt 1980. (zitiert als: Bellum 1)
Fitzler, Kurt; Seeck, Otto: Iulius Nr.132, in: Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaften, Bd.10,1, 1918, Sp. 275 - 381. (zitiert als: RE) Fuhrmann, Manfred: Livius Nr. 2, in: Der Kleine Pauly Bd. 3, Stuttgart 1969,
Sp. 695 - 698. (zitiert als: KlP)
Harris, William: War and Imperialism in Republican Rome 327 - 70 B.C., Oxford
1979. (zitiert als: War and Imperialism)
Mantovani, Mauro: Bellum Iustum, Bern 1990. (zitiert als: Bellum 2)
Rüpke, Jörg: Domi Militiae. Die Religiöse Konstruktion des Krieges, Stuttgart 1990.
(zitiert als: Domi Militiae)
Samter, Ernst: Fetiales, in: Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaften,
Bd. 6,2, 1909, Sp. 2259 - 2265. (zitiert als: RE)
Ziegler, Konrat: Popilius Nr. 24, in: Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaften, Bd. 22,1, 1953, Sp. 61 - 62. (zitiert als: RE)
VI. Übungsbibliographie
Albert, Sigrid: De vetere Romano. De lege duodecim atque de iure fetiali, in: VoxLat
132, 1998, S. 214-227. (APh: 69 - 12715)
Barceló, Pedro A.: Rom und Hispanien vor Ausbruch des 2. Punischen Krieges, in:
Hermes 124 (1), 1996, S. 45 - 57. (APh: 67 - 09364)
Brescia, Graziana: La “scalata” del ligure. saggio di commento a Sallustio, Bellum
Iugurthinum 92-94, Bari 1997. (APh: 68 - 04162)
Capelletti, Loredana: Il ruolo dei fetiales e il concetto di Liv. IX 45, 5-9, in: Tyche 12,
1997, S. 7 - 13. (APh: 68 - 02693)
Dobesch, Gerhard: Aus der Vor- und Nachgeschichte der Markomannenkriege, in:
AAWW 131, 1994, S.67 - 125. (APh: 67 - 09431)
Lenihan, David Anthony: The influence of Augustine's just war. the early Middle
Ages, in: AugStud 27(1), 1996, S. 55 - 94. (APh: 67 - 00824)
Lott, John Bertrand: An Augustan sculpture of August, in: ZPE 113, 1996, S.263 -
270. (APh: 67 - 09534)
Pownall, Frances Skoczylas: What makes a war a Sacred War?, in: EMC 17 (1), 1998,
S. 35 -55. (APh: 69 - 09679)
Riesco Álvarez, Hipólito-Benjamín: „Sagmina“, „verbenae“ y „herbae purae“, in:
Helmantica 45, 1994 , S. 153 - 163. (APh: 69 - 11442)
Schrapel, Thomas: Das Reich der Kleopatra. Quellenkritische Untersuchungen zu den
„Landschenkungen“ Mark Antons, Trier 1996. (APh: 67 - 09617)
[...]
1 Samter, Ernst: Fetiales, in RE Bd. 6,2, Sp. 2263.
2 Samter, Ernst: Fetiales, in RE Bd. 6,2, Sp. 2263.
3 Rüpke, Jörg: Domi Militiae, S. 103.
4 Rüpke, Jörg: Domi Militiae, S. 101 - 102.
5 Rüpke, Jörg: Domi Militiae, S. 103 - 104.
6 Rüpke, Jörg: Domi Militiae, S. 104.
7 Rüpke, Jörg: Domi Militiae, S. 104.
8 Rüpke, Jörg: Domi Militiae, S. 123.
9 Rüpke, Jörg: Domi Militiae, S. 105 - 108.
10 Harris, William: War and Imperialism, S. 170.
11 Fitzler, Kurt; Seeck, Otto: Iulius Nr.132, in: RE, Bd. 10,1, Sp. 326.
12 Fuhrmann, Manfred: Livius Nr. 2, in: KlP, Bd.3, Sp. 397.
13 Mantovani, Mauro: Bellum 2, S. 66 - 67.
14 Albert, Sigrid: Bellum 1, S. 46 - 50.
15 Ziegler, Konrat: Popilius Nr. 24, in: RE, Bd. 22,1, Sp. 61 - 62.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über die römische Kriegseröffnung?
Die Arbeit konzentriert sich auf das römische Fetialrecht, das die rechtlich-religiösen Grundlagen für Kriegseröffnungen bildete. Es wird untersucht, warum die Römer solch komplizierte Rituale befolgten, um einen Krieg zu beginnen.
Was war das Fetialkollegium?
Das Fetialkollegium war eines der ältesten Priesterkollegien Roms, bestehend aus 20 Mitgliedern. Ihre Aufgabe war es, völkerrechtliche Gutachten zu erstellen, Auslieferungen römischer Bürger durchzuführen, Bündnisverträge zu schließen und Kriegserklärungen zu vollziehen. Sie sollten die private Kriegführung einschränken und den Staat vor unüberschaubaren Konflikten schützen.
Wie lief der Fetialritus in seiner Idealform ab?
Der Ritus umfasste mehrere Schritte: Beauftragung der Fetialen, rerum repetitio (Forderungsstellung an den Gegner), denuntiatio (öffentliche Feststellung der Nichterfüllung der Forderungen), Votum des Senats, Zustimmung des Volkes und schließlich die indictio belli (Kriegseröffnung) durch Speerwurf in feindliches Gebiet.
Warum wurde der Fetialritus säkularisiert?
Mit der Expansion Roms über Italien hinaus wurde der Ritus unpraktisch, da es außerhalb Italiens keine Fetialkollegien gab und Reisen zu zeitaufwendig wurden. Daher wurden senatorische Abgesandte (legati) mit den Kriegsverhandlungen beauftragt, was zu einer Vereinfachung und Säkularisierung des Rituals führte.
Erlebte der Fetialritus eine Wiederbelebung im Kaiserreich?
Ja, während des Prinzipats erlebte das Fetialrecht eine Neubelebung, insbesondere zu Propagandazwecken. Octavian nutzte den Ritus, um einen Krieg gegen Kleopatra zu rechtfertigen, und Mark Aurel verwendete ihn, um seine Truppen zu motivieren.
Was sind Beispiele für bellum iustum und bellum iniustum?
Der Jugurthinische Krieg wird als Beispiel für einen bellum iustum genannt, da sowohl die Formalitäten erfüllt waren als auch ein gerechter Grund vorlag (Schutz eines socius et amicus). Der Krieg gegen die Statellaten wird als bellum iniustum dargestellt, da die Formalitäten nicht eingehalten wurden und kein gerechter Grund vorlag. Der Zweite Punische Krieg wird als formell gerechter Krieg beschrieben, aber der Kriegsgrund wird als zweifelhaft angesehen.
Welche Schlüsse zieht die Arbeit über die Motive für die Befolgung des Fetialrechts?
Die Motive wandelten sich im Laufe der Zeit. Zu Beginn der Republik standen religiöse Motive im Vordergrund, um die Gunst der Götter zu erlangen. In der mittleren und späten Republik wurden die religiösen Aspekte reduziert und das Kriegsrecht praktikabler. Im Kaiserreich diente der Fetialritus hauptsächlich Propagandazwecken.
- Quote paper
- Jens Wegener (Author), 2000, Die römische Kriegseröffnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103518