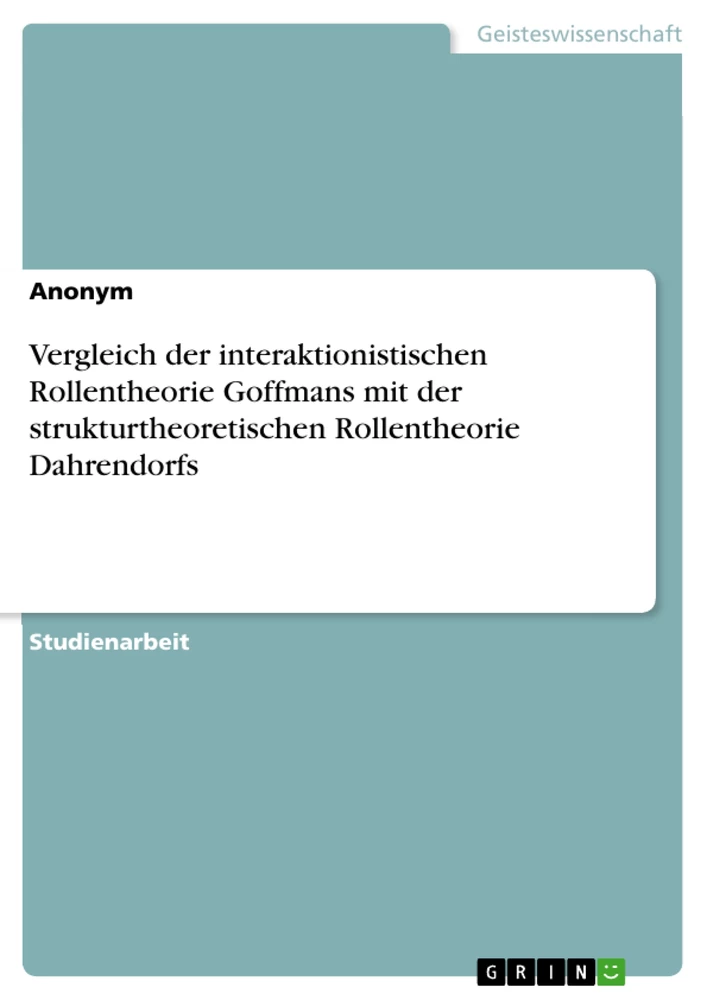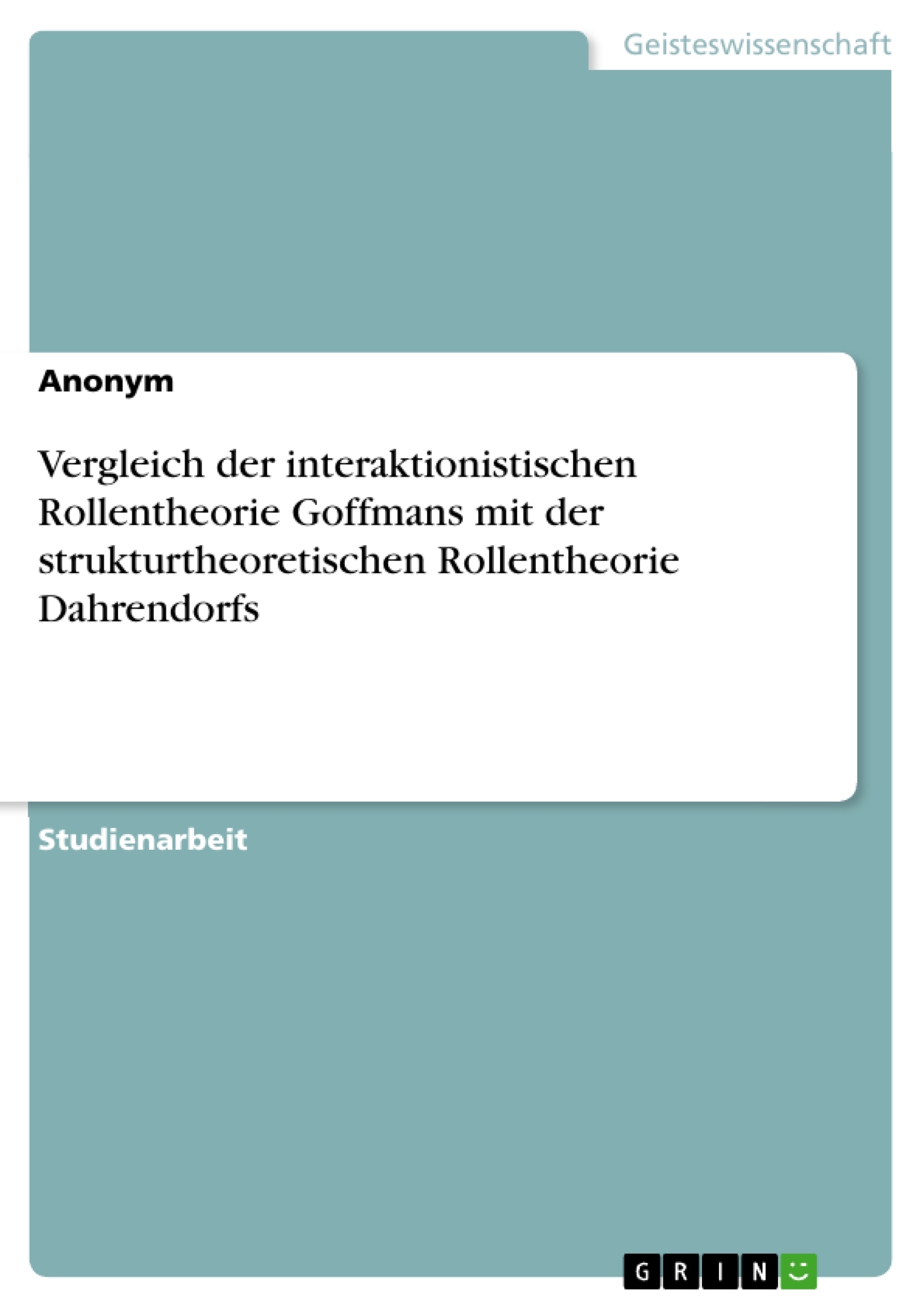Der Soziologe Erving Goffman ist bekannt für seine Beobachterperspektive und analytische Betrachtungsweis. Er zählt zu den soziologischen Klassikern, obwohl er keine Theorie entwickelte. Zwar wird im Folgenden die Rede von Goffmans Rollentheorie sein, jedoch kann diese nicht im herkömmlichen Sinne als Theorie aufgefasst werden, da sie sich zu einem großen Teil auf empirische Beobachtungen stützt. Da er auf die manipulativen Seiten von Interaktionen aufmerksam machte, schuf er einen theoretischen Gegenpol zu den vorherrschenden Theorien seiner Zeit. Goffmans Werke lösten ein großes Interesse aus, was sich daran zeigte, dass seine Werke immer wieder neu aufgelegt wurden, sogar in vielen verschiedenen Sprachen.
„The Presentation of Self in Everyday Life" ist das einflussreichste Buch der modernen Soziologie und das meist gelesene Werk Goffmans. Deshalb werde ich mich in dem Kapitel über Goffmans Rollentheorie hauptsächlich mit dem Inhalt dieses Werkes befassen, wobei ich die deutsche Übersetzung dieses Buches zugrunde lege. Daneben wird auch ein Kapitel aus Goffmans Werk „Interaktionsrituale“ behandelt.
Die Theorie des homo sociologicus ist das einflussreichste rollentheoretische Werk in Deutschland. Deshalb werde ich dieses mit Goffmans Rollentheorie vergleichen. Zunächst werden beide Theorien ausführlich dargestellt und mit anschaulichen Beispielen erläutert, um im Anschluss zentrale Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen.
Dahrendorfs strukturtheoretische Rollentheorie entfachte eine umfangreiche soziologische Diskussion über das Menschenbild des homo sociologicus, die die Rollentheorie allerdings nicht weiterbrachte, da es nicht Dahrendorfs Absicht war, mit dem Modell des homo sociologicus empirische Annahmen aufzustellen. Aus diesem Grund werde ich mich nicht mit diesen Debatten befassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Allgemeine Informationen und Relevanz der ausgewählten Rollentheorien
- 2. Interaktionistische Rollentheorie nach Goffman
- 2.1 Darstellungen
- 2.2 Eindrucksmanipulation
- 2.3 Interaktionsrituale
- 3. Strukturtheoretische Rollentheorie nach Dahrendorf
- 3.1 Homo Sociologicus
- 3.2 Soziale Rolle
- 3.3 Position und Positionsfeld
- 3.4 Erwartungsarten
- 3.5 Bezugsgruppen
- 4. Gemeinsamkeiten der Rollentheorien nach Goffman und Dahrendorf
- 4.1 Begriff der Rolle
- 4.2 Die Bedeutung von Erwartungen
- 4.3 Vorhandensein von Handlungsspielräumen
- 4.4 Anwendung des Theater-Modells
- 5. Unterschiede der Rollentheorien nach Goffman und Dahrendorf
- 5.1 Deskriptives und erklärendes Modell
- 6. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die interaktionistische Rollentheorie Goffmans mit der strukturtheoretischen Rollentheorie Dahrendorfs zu vergleichen. Es wird untersucht, wie die beiden Theorien die soziale Rolle und Interaktionen in der Gesellschaft verstehen und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen.
- Darstellung und Eindrucksmanipulation in Goffmans Theorie
- Die Bedeutung von Erwartungen und Handlungsspielräumen in beiden Theorien
- Die Anwendung des Theater-Modells in der Rollentheorie
- Deskriptive und erklärende Ansätze in der Rollentheorie
- Das Konzept des Homo Sociologicus in Dahrendorfs Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 beleuchtet die Relevanz der ausgewählten Rollentheorien, insbesondere die Besonderheiten von Goffmans Ansatz und die Bedeutung des Homo Sociologicus in Dahrendorfs Werk.
- Kapitel 2 stellt Goffmans interaktionistische Rollentheorie vor und erläutert die zentralen Konzepte der Darstellung, Eindrucksmanipulation und Interaktionsrituale.
- Kapitel 3 präsentiert die strukturtheoretische Rollentheorie Dahrendorfs mit den Kernbegriffen des Homo Sociologicus, der sozialen Rolle, Position und Positionsfeld, Erwartungsarten und Bezugsgruppen.
- Kapitel 4 untersucht Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Theorien, beispielsweise den Begriff der Rolle, die Bedeutung von Erwartungen, die Existenz von Handlungsspielräumen und die Anwendung des Theater-Modells.
- Kapitel 5 beleuchtet die Unterschiede zwischen Goffmans und Dahrendorfs Theorien, insbesondere in Bezug auf deskriptive und erklärende Modelle.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Soziologie, darunter die Rollentheorie, Interaktion, Darstellung, Eindrucksmanipulation, Homo Sociologicus, Erwartungen, Handlungsspielräume, Struktur und Interaktionismus.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Vergleich der interaktionistischen Rollentheorie Goffmans mit der strukturtheoretischen Rollentheorie Dahrendorfs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1034434