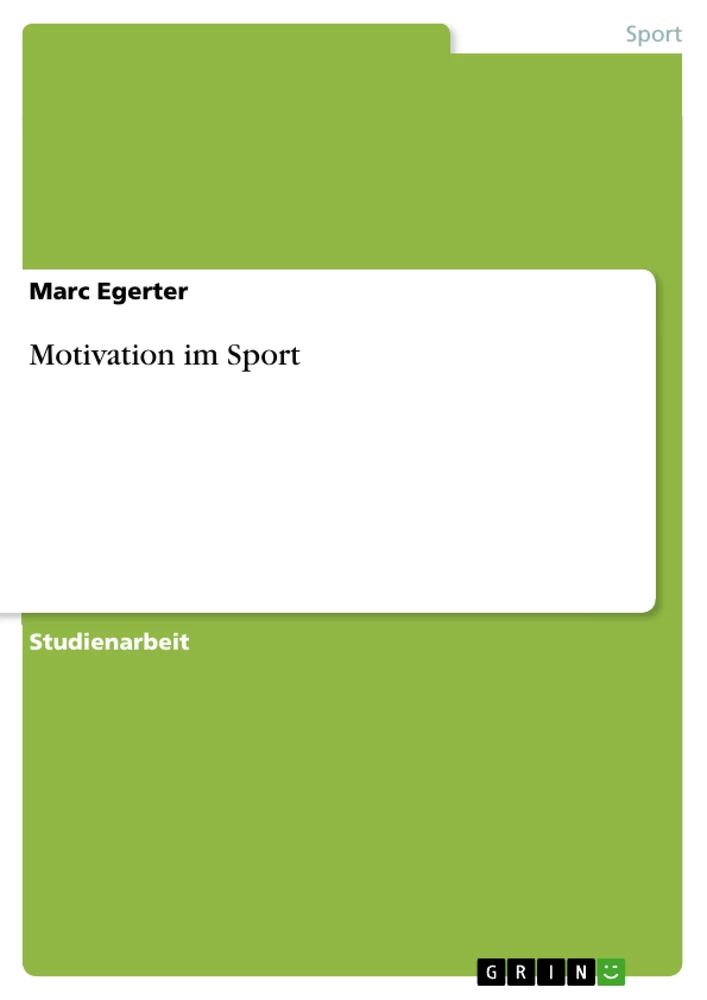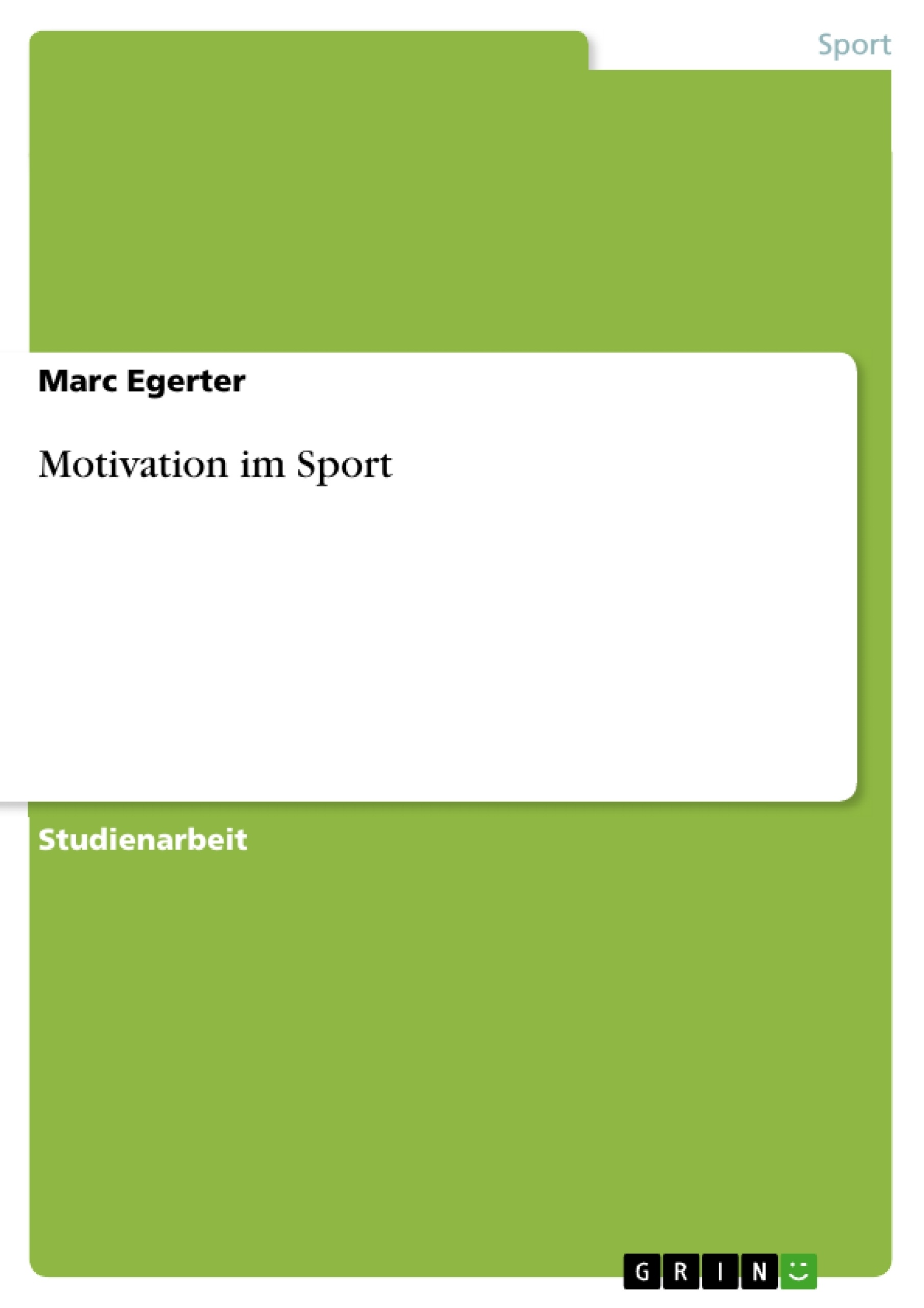Warum lieben manche den Sport, während andere ihn verabscheuen? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Motivation im Sportunterricht und Vereinssport, eine Welt, in der Leidenschaft auf Pflicht trifft und persönliche Ziele mit den Erwartungen anderer kollidieren. Dieses Buch enthüllt die komplexen psychologischen und pädagogischen Faktoren, die das Sporttreiben beeinflussen, und beleuchtet die entscheidende Rolle, die Trainer und Lehrer bei der Entfachung der Begeisterung und dem Aufbau eines positiven sportlichen Umfelds spielen. Entdecken Sie, wie Sportlehrer versuchen, die körperliche Fitness zu fördern, das Interesse zu wecken und soziales Verhalten zu schulen, während Vereinstrainer auf Leistung und Wettbewerb fokussieren. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede in der Motivationsarbeit im Schul- und Vereinssport, die Bedeutung pädagogischer Ziele und die Herausforderungen, denen sich Sportlehrer stellen müssen, um ein heterogenes Publikum zu erreichen. Untersucht werden die Gründe für die Beliebtheit bestimmter Sportarten und die Einführung von Neigungsgruppen zur Steigerung der Motivation. Die Notengebung im Sportunterricht, ein kontrovers diskutiertes Thema, wird ebenso beleuchtet wie die Bedeutung des sozialen Verhaltens und der Fairness. Dieses Buch bietet wertvolle Einblicke für alle, die im Sport tätig sind – von Lehrern und Trainern bis hin zu Schülern, Eltern und Sportbegeisterten –, um die Freude am Sport zu fördern und die individuellen Motive jedes Einzelnen zu verstehen und zu respektieren. Es zeigt, wie der Schulsport als Sprungbrett für Vereine dienen kann und wie wichtig es ist, die Schüler nicht durch zu hohe Leistungserwartungen zu demotivieren. Analysiert werden Beliebtheitskurven verschiedener Sportarten im Laufe der Schulzeit und die Notwendigkeit, altersgerechte und interessenspezifische Angebote zu schaffen, um die Motivation hochzuhalten. Ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die Sport nicht nur als körperliche Betätigung, sondern als eine Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung und sozialen Integration verstehen wollen. Erkunden Sie die subtilen Unterschiede zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation und lernen Sie, wie man ein Umfeld schafft, in dem jeder sein volles Potenzial entfalten kann, unabhängig von seinen individuellen Stärken und Schwächen. Dieses Buch ist eine Einladung, Sport neu zu denken und die Kraft der Motivation zu nutzen, um positive Veränderungen zu bewirken.
1. Was ist Motivation ?
Motivation: Gestimmtsein, innere Bereitschaft für ein Motiv
Motiv: 1. Leitgedanke; 2. Beweggrund, Antrieb (für eine Handlung); ein (kein) Motiv für ein Vergehen, Verhalten haben; das Motiv der Tat ist nicht bekannt; 3. Kennzeichnender inhaltlicher Bestandteil einer Dichtung (Märchen~); das M. der feindlichen Brüder; 4. kleinste charakteristische Tonfigur einer Melodie oder eines musikalischen
Themas; 5. (bildende Kunst und Mal.) Gegenstand der Darstellung (Ranken~) [< frz. motif in ders. Bedingung, < mlat. motivum „Ursache, Antrieb, Beweggrund“, als Adj. „Bewegung verursachend“, < lat. motio „Bewegung“, zu movere „bewegen“]
Motivieren: 1. etwas mit etwas aus seinen Motiven heraus begründen; eine Handlung, ein
Verhalten m.; er kann seine Handlungsweise selbst nicht m.; er hat sein Vorgehen damit motiviert, daß er unerträglich gereizt worden sei; 2. jmdm. m.- jmdm. ein Motiv geben etwas zu tun, jmdm zu etwas anregen; jmdn zu einer Beschäftigung motivieren- Motivierung1
1.1 Motivation eines Sportlers
Es gibt keine eindeutigen Antriebe die für einen jeden Sportler gelten.
Jeder einzelne hat seine eigene Motive für den Spaß am Sport und die Lust am Sporttreiben. Viele der genannte Motive sind z.B. die Freude an der Bewegung, den gesundheitlichen Aspekt, Wettkampffreude, Freude an Risiko, Freude an der Gesellschaft, Teamgeist innerhalb eines Vereins oder einer Mannschaft, Streß-, oder Aggressivitätsabbau um nur einige wenige Beispiele zu geben.
Sowohl im Vereinssport als auch im Schulsport gibt es Personen deren Aufgabe es ist die Gruppe zu Leistungen anzuregen, zu motivieren.
1.2 die „Motivationsmacher“
Die Personen die die Sportgruppen betreuen sind die Trainer (oder im Schulbereich Sportlehrer), die fachlich kompetent sein müssen, aber auch die Interessen der einzelnen verstehen und berücksichtigen müssen.
Allerdings gibt es Unterschiede in der Arbeit eines Sportlehrers, denn das zu betreuende Publikum ist ein anderes.
2. Aufgaben der Trainer/ des Lehrers
In diesem Abschnitt werde ich versuchen die unterschiedliche Ziele dieser zwei Sparten zu erläutern.
Der Sportlehrer und seine Aufgaben:
Er möchte die körperliche Fitneß der einzelnen schulen, dies ist vor allem für jene Schüler besonders wichtig, die außerhalb der Schule keine oder nur wenig körperliche Bewegung haben; er versucht das Interesse der Schüler am Sport zu wecken; die Schüler sollen ihren eigenen Körper kennenlernen und Bewegungserfahrung sammeln; der Sportunterricht ist an deutschen Schulen ja bekanntlich verpflichtend, und deshalb muß hier besonders versucht werden das Interesse aller Beteiligten zu wecken, damit der Sportunterricht möglichst zur Freude aller Beteiligten (besonders den Leistungsschwachen) stattfinden kann; der Sportunterricht soll auch das soziale verhalten der Schüler im Klassenverband fördern; in keinem anderen Fach bieten sich solch gute Möglichkeiten sich auszutauschen, sich gegenseitig zu ermutigen und Begriffe wie Freundschaft und Fairneß zu erklären und zu erlernen.
⇒ in der Schule muß das Mitmenschliche oftmals mehr in den Mittelpunkt gestellt werden wie die eigentlichen Leistungen.
Der Trainer einer Leistungsgruppe und seine Aufgaben:
Er möchte ebenfalls die körperliche Fitneß der einzelnen schulen; die Leistungsstärkeren werden oftmals zu den Leistungsträgern gemacht, auf die es in der Gruppe (im Spiel) besonders ankommt oder auf deren Spiel sogar die Taktik eventuell ausgelegt wird; er muß versuchen das optimale Mannschaftsgefüge zusammenzustellen und die Aufstellung und Taktik suchen, die die Mannschaft am stärksten macht.
⇒ Bei dem Vereinssport steht oftmals das leistungsorientierte Denken im Vordergrund, da man schließlich mit anderen Mannschaften im Wetteifer steht.
3. Unterschiede im Schul-, bzw. Vereinssport
- Die Mitgliedschaft in einem Vereins ist freiwillig, die Personen die dem Verein beitreten, tun dies aus eigenem Interesse und weil sie sich einer ganz bestimmten Sportart widmen wollen.
Der Schulsport hingegen ist verpflichtend: hier müssen die Schüler teilnehmen und teilweise gezwungen werden, sich körperlich zu betätigen.
Schon aus diesem Grund ist die Motivationsarbeit, die ein Sportlehrer leisten muß, oftmals viel schwieriger.
- Beim Schulsport sind die pädagogischen Ziele klar definiert und werden in der Regel intensiver verfolgt, wobei im Vereinssport zumeist die Leistung einer individuellen Person oder der Mannschaft im Vordergrund stehen.
In diesem Punkt ist noch zu erwähnen, daß die Sportlehrer eine intensivere pädagogische Ausbildung genießen, was aufgrund des (oftmals schwierigerem) Publikums auch notwendig ist.
„Es ist durchaus denkbar, daß sich zwischen ehrenamtlichen, pädagogisch oft ungeschultem Übungsleiter und dem Berufspädagogen Lehrer ein Konnkurrenzverhältnis herausbildet, das einer guten Zusammenarbeit sicher abträglich ist. Dies ist umso mehr zu befürchten, wenn diese verschiedenen Bereiche versuchen, sich gegenseitig in die Pflicht zu nehmen, anstatt sich in der Andersartigkeit ihrer pädagogischen Zielvorstellungen zu akzeptieren, gegenseitig zu ergänzen und eventuell in positiver weise zu beeinflussen.“2
-Ein Schüler, der einem Verein angehört, hat im Sportunterricht eine andere Rolle und eine andere Stellung als bei derselben Sportart in seinem Verein.
Während er im Verein vielleicht ein starker Leistungsträger sein mag, muß er sich im Schulsport sicherlich in eine andere Rolle versetzen, da hier die Leistung nicht so stark im Vordergrund steht. Hier kann es durchaus vorkommen, daß er sich der Regie eines schwächeren Schülers unterordnen muß, oder daß sein Spiel so stark variiert wird, um die anderen Schüler sinnvoll einzufügen, daß er nun nicht mehr der Star ist. -Ein Beispiel: Im Fußballspiel gibt der Lehrer zuvor an, daß nur die Tore eines bestimmten (leistungsschwächeren) Schülers zählen, was natürlich zur folge hat, daß das Spiel nun ganz anders gespielt werden muß und eine ganz neue Taktik erfolgen muß, um das Match als Sieger zu beenden.
Solche Varianten haben oftmals zur Folge, daß der Frustwert eines solchen Schülers sehr hoch ausfällt und er infolgedessen mit dem Sportunterricht unzufrieden ist.
-Oftmals haben Vereinssportler auch Schwierigkeiten, in anderen Sportarten zurechtzukommen. Ein Fußballspieler hat unter Umständen beim Handball große Schwierigkeiten, was zur Folge haben könnte, daß dieser Schüler das Interesse am Sportunterricht jetzt völlig verlieren könnte, da er ja nicht mehr der Star der Klasse ist und diese neue ungewohnte Rolle ihn völlig frustriert.
- Der Sportunterricht hat auch das wichtige Ziel, das soziale Verhalten und Denken der Schüler zu fördern. Eine Schulklasse besteht oftmals aus ca. 30 Schülern, die wild zusammengewürfelt sind. Aus diesem „Haufen“ gilt es nun eine Einheit zu schmieden. Es soll erreicht werden, daß die Klasse möglichst gut miteinander agieren kann, um die gemeinsame Ziele zu erreichen. In keinem anderen Schulfach können die Schüler soviel miteinander in Kontakt treten und sind die Möglichkeiten so gut, um etwa vorhandene Vorurteile zu beseitigen oder Freundschaften zu knüpfen.
-Wie der Sportunterricht für die Vereine arbeitet:
Oftmals ist der Schulsport der erste Kontakt der Kinder mit Sport/ Spiel etc., und der Sportunterricht kann als Sprungbrett hin zu einem Verein dienen.
Es geschieht häufig, daß einige Sportlehrer bestimmte Schüler für einen Verein anwerben, indem sie bei talentierten Schülern vorsichtig Nachfragen, ob denn Interesse bestünde, den jeweiligen Sport auf Vereinsebene zu verfolgen.
Aber auch hier muß der Lehrer mit Vorsicht agieren. Der Schüler soll schließlich von dem unterschiedlichen Leistungsniveau vom Schulsport hin zum Vereinssport nicht frustriert werden.
4. Stellenwert des Schulsports bei den Schülern
Aus Befragungen in Grundschulklassen des 3. und 4. Schuljahres ging der Sport eindeutig als das beliebteste Fach hervor. Gabler hat in Tübingen 10 - 12jährige Jungen und Mädchen in Realschulklassen über die Einstellung zum Schulsport befragt und kam ebenfalls zu dem Ergebnis, daß der Sport beliebtestes Fach in dieser Altersstufe ist. Auch Petersens Erhebungen 1969/70 zeigen, daß die führende Position des Sports als Lieblingsfach, die er bei den von ihr befragten 10jährigen einnimmt, bis zum 12. Lebensjahr sogar noch ausgebaut wird (68%).
Bei den 13 bis 14jährigen sinkt der Anteil der Lieblingsfachnennungen bereits auf 54% ab. Das absinken der Beliebthheitskurve in diesem Altersabschnitt wird von Bremer Erhebungen an Schülern der 8. bis 11. Klasse bestätigt. Bei den 17jährigen fallen dem Sport hier nur noch rund 1/8 der Nennungen zu.
Dieses Ergebnis findet sich ähnlich in den bereits erwähnten Hamburger Untersuchungen (1969), in denen bei den dort Untersuchten 868 Abiturienten 31% der Nennungen auf Sport als Lieblingsfach fallen. Sport bleibt damit an der Spitze als mit Abstand bevorzugtes Fach. Verfolgen wir den sich aus diesen Daten ergebenen Gesamtverlauf der „Beliebthheitskurve“, so zeigt sich ein hoher Anfangswert in den Grundschulklassen, der bis zum 6. Schuljahr sogar noch ansteigt. Hier liegt der Kulminationspunkt, danach sinkt die Kurve auffällig ab.
Ein weiteres Ergebnis ist, daß sich der Sport während der gesamten Schulzeit gegenüber anderen Fächern großer Beliebtheit erfreut. Er steht an erster Stelle. Doch etwa mit dem 8./9. Schuljahr holen andere Fächer in der Sympathiezuwendung auf, und schließlich entscheiden sich nur noch etwa 1/3 der älteren Schüler für ihn als beliebtestes Fach. Mit dem 14./15 Lebensjahr (mit einsetzen der Pubertät) scheinen sich die Interessen zu verlagern, und damit ändert sich auch die Motivation gegenüber Schulsportlicher Betätigung. Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen hinsichtlich der Motivationslage sind nicht festzustellen.3
Weitere Untersuchungen hinsichtlich der Beliebtheit einzelner Sportarten ergaben, daß sich Schwimmen und Spiele auf den ersten Rängen positionierten, andere Sportarten wie etwa Leichtathletik und Turnen auf den letzten Rängen rangierten.
Aufgrund dieser Untersuchungen probierte man an vielen Schulen, gerade bei den älteren Schülern, eine Einführung von Neigungsgruppen im Schulsport aus.
Die Schüler konnten hier ihre Interessen und individuelle Wünsche angeben, somit hoffte man Motivationsschwierigkeiten zu beseitigen und den Schulsport wieder beliebter zu machen.
Ebenfalls aus Schülerbefragungen weiß man was ein guter Lehrer an Motivationsarbeit für die Schüler leisten kann. Aus solchen Befragungen ist deutlich geworden, daß vornehmlich der Leistungsfähige, junge Sportlehrer gewünscht wird, der mit den Schülern mithalten und viele Bewegungsabläufe gut vormachen kann. Nun sind gerade dieser Motivierungsmöglichkeit durch das zunehmende Alter und das damit verbundene Nachlassen der körperlichen Leistungsfähigkeit Grenzen gesetzt.
Hierin besteht ein echtes Berufshandicap des Sportlehrers. Mit zunehmenden Alter ist letztlich der gute Kontakt und ein gesundes Vertrauensverhältnis zum Lehrer für die Motivationsarbeit essentiell.
5. Ergebnis
Was aus den vorigen Zeilen und aufgezeigten Unterschieden meiner Ansicht nach deutlich wird, ist vor allem der Unterschied an Motivationsarbeit die der Sportlehrer im Gegensatz zum Sporttrainer/Übungsleiter leisten muß.
Es gibt viele verschiedene Gründe, weshalb die Menschen Sport treiben und wie sie sich
motivieren: sei es aus Risikofreude, Abbau von Streß/ Aggressivität, um Anschluß zu anderen Menschen zu finden und Freundschaften zu knüpfen, ob sie einfach an der Bewegung und am Kennenlernen ihres Körpers Freude haben, um sich fit und gesund zu halten, sei es wegen der Freude am Wettkampf, Freude an der Schulung seines Könnens... etc. Diese werden als Hauptgründe angegeben, wenn es darum geht anzugeben, weshalb man einem Verein beitritt oder Spaß an der Bewegung hat.
Oftmals ist es schwierig die oben genannte Motive auf den Schulsport zu übertragen.
Zum ersten ist der Inhalt des Sportunterrichts größtenteils vom Lehrplan festgelegt, was heißt, daß nicht nur die von den Schülern beliebten Sportarten durchgenommen werden können (z.B: Fußball), sondern auch die weitaus weniger beliebten (wie etwa das Gerätturnen).
Zum anderen sind auch andere der angegebenen Motivationsgründe oftmals unerwünscht im Sportunterricht (wie etwa der Aggressionsabbau oder die Risikobereitschaft), oder werden vom Sportlehrer etwas in den Hintergrund gerückt (wie etwa das Leistungsorientierte Wettkampfdenken), da andere Motive den Sportunterricht in gleichem Maße prägen sollen (wie etwa Fairneß, Kameradschaftlichkeit, etc.)
Was den Schulsport weiterhin noch unterscheidet ist, daß die Schüler für ihre Leistungen benotet werden und dies auch in ihrem Zeugnisdurchschnitt miteinfließt.
Die Notengebung im Sportunterricht ist seit einigen Jahren sehr umstritten.
Die Kritiker behaupten, daß viele Schüler angesichts der hohen Leistungserwartung die an sie herangetragen wird, scheitern und ihre Fähigkeiten unter solchen Bedingungen gar nicht zeigen können.
Einige Befürworter von diesem Notensystem sehen einen positiven Effekt, der durch diesen Druck geschaffen wird und behaupten, daß eben dieser Druck die Schüler zu einer besonderen Leistung anspornen kann.
Es gibt sicherlich Beispiele die beide Fälle belegen können und somit kann man keinen allgemeingültigen Satz zur Notengebung im Sportunterricht finden.
Der Sportlehrer hat jedoch einige Freiheiten in seiner Notengebung die unter den Aspekt der pädagogischen Note fallen. Somit kann er für eine gewisse Fairneß, in seiner Notengebung sorgen, besonders in bezug auf die Leistungsschwächeren Schüler: „Zu welchem Anteil gewichte ich sein soziales Verhalten, oder seine Hilfsbereitschaft?“
[...]
1 Knaur; Das deutsche Wörterbuch; 1985 Lexikalisches Institut München
2 Ekkehard Dierkes; Sportsoziologische Untersuchungen zum Verein; 1987
Häufig gestellte Fragen
Was ist Motivation im Kontext des Sports?
Motivation ist die innere Bereitschaft für ein Motiv, während ein Motiv der Beweggrund oder Antrieb für eine Handlung ist. Im Sport bezieht sich Motivation auf die Gründe, warum Sportler aktiv sind und Freude an ihrer Tätigkeit haben, wie z.B. Freude an Bewegung, gesundheitliche Aspekte, Wettkampffreude, Teamgeist oder Stressabbau.
Wer sind die "Motivationsmacher" im Sport?
Die "Motivationsmacher" sind Trainer im Vereinssport und Sportlehrer im Schulsport. Sie müssen fachlich kompetent sein, aber auch die Interessen der einzelnen Sportler bzw. Schüler verstehen und berücksichtigen.
Welche Aufgaben haben Trainer und Sportlehrer?
Sportlehrer zielen darauf ab, die körperliche Fitness der Schüler zu schulen, ihr Interesse am Sport zu wecken, Bewegungserfahrung zu sammeln und das soziale Verhalten im Klassenverband zu fördern. Trainer im Leistungssport konzentrieren sich darauf, die körperliche Fitness der Sportler zu verbessern, Leistungsträger zu fördern und das optimale Mannschaftsgefüge zusammenzustellen.
Welche Unterschiede gibt es zwischen Schul- und Vereinssport bezüglich der Motivation?
Der Vereinssport ist freiwillig, während der Schulsport verpflichtend ist. Daher ist die Motivationsarbeit im Schulsport oft schwieriger. Im Schulsport werden pädagogische Ziele intensiver verfolgt, während im Vereinssport die Leistung im Vordergrund steht.
Wie nehmen Schüler den Schulsport wahr?
In den Grundschulklassen ist Sport oft das beliebteste Fach. Mit zunehmendem Alter (Pubertät) nimmt die Beliebtheit jedoch ab, da sich die Interessen verlagern. Die Einführung von Neigungsgruppen im Schulsport soll Motivationsschwierigkeiten beseitigen.
Welchen Stellenwert hat der Sportunterricht für Vereine?
Der Schulsport kann als Sprungbrett für Kinder dienen, um einem Verein beizutreten. Sportlehrer können talentierte Schüler für Vereine anwerben, sollten jedoch darauf achten, dass die Schüler durch das unterschiedliche Leistungsniveau nicht frustriert werden.
Welche Rolle spielt die Notengebung im Sportunterricht?
Die Notengebung im Sportunterricht ist umstritten. Kritiker bemängeln, dass hohe Leistungserwartungen Schüler demotivieren können, während Befürworter argumentieren, dass Druck zu besonderen Leistungen anspornen kann. Sportlehrer haben jedoch pädagogische Freiheiten bei der Notengebung.
Was sind die wichtigsten Unterschiede in der Motivationsarbeit zwischen Sportlehrern und Sporttrainern?
Sportlehrer müssen eine breitere Palette von Motivationsaspekten berücksichtigen, da der Schulsport verpflichtend ist und unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten der Schüler berücksichtigt werden müssen. Sie müssen auch Aspekte wie Fairness, Kameradschaft und soziales Verhalten fördern. Sporttrainer können sich stärker auf leistungsbezogene Ziele konzentrieren, da die Sportler im Verein freiwillig teilnehmen und in der Regel ein höheres Maß an intrinsischer Motivation aufweisen.
- Quote paper
- Marc Egerter (Author), 2001, Motivation im Sport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103411