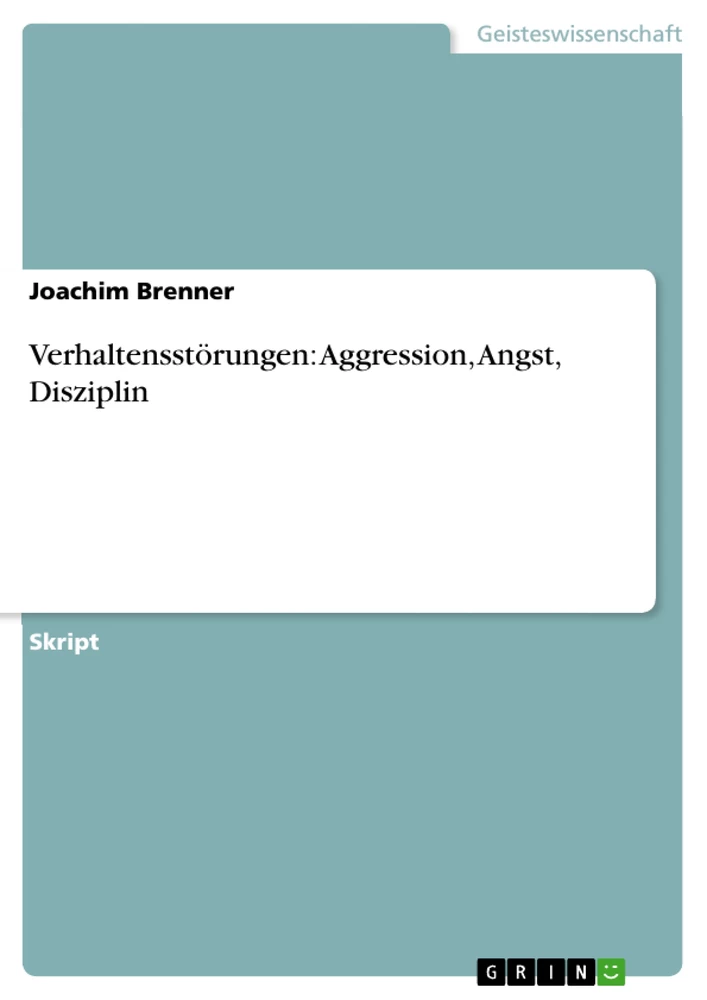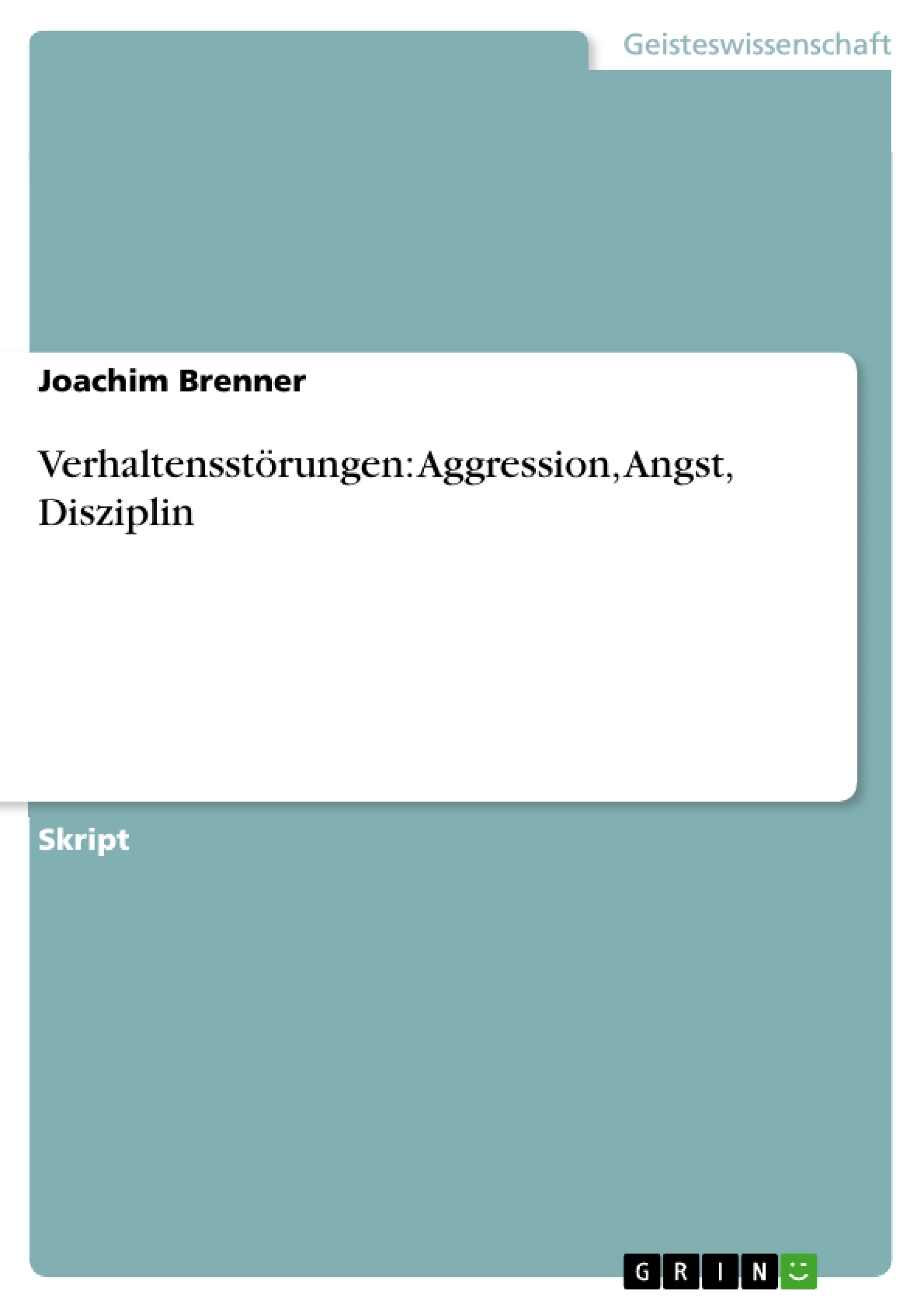Stell dir vor, du stehst vor einer Klasse, und plötzlich bricht das Chaos aus. Angst lähmt, Disziplin zerbricht, und Aggressionen eskalieren. Dieses Buch ist dein Kompass in diesem stürmischen Meer der Emotionen. Es beleuchtet das vielschichtige Phänomen der Angst – von der lähmenden Prüfungsangst bis zur diffusen Schulangst – und zeigt, wie sie sich auf Leistung und Verhalten auswirkt. Du erhältst einen tiefen Einblick in die psychologischen Theorien, die hinter Angst stecken, von Freuds psychoanalytischen Ansätzen bis zu den modernen kognitiven Lerntheorien. Aber es bleibt nicht bei der Theorie: Praktische Präventions- und Interventionsstrategien für Elternhaus und Schule werden vorgestellt, um ein angstfreies Lernumfeld zu schaffen. Weiter geht es mit dem Thema Disziplin, einemBalanceakt zwischen Laissez-faire und Autoritarismus. Entdecke die Funktionen von Disziplin in der Sozialerziehung und Persönlichkeitsentwicklung, sowie die Ursachen für Disziplinstörungen und wirksame Handlungsmöglichkeiten, von Erziehungsmaßnahmen bis hin zu präventiven Strategien für einen besseren Unterricht. Schließlich widmet sich das Buch der Aggression, einem komplexen Zusammenspiel aus biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren. Erfahre mehr über die verschiedenen Erscheinungsformen der Aggression, von offener Gewalt bis zu subtilen Formen der Verleumdung, und die psychologischen Erklärungsansätze, von Triebtheorien bis zu lerntheoretischen Modellen. Konkrete Präventions- und Interventionsstrategien werden vorgestellt, um ein positives Lernumfeld zu gestalten und konstruktive Konfliktbewältigung zu fördern. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Ratgeber für Lehrer, Eltern und alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, um ein Klima der Sicherheit, des Vertrauens und der konstruktiven Zusammenarbeit zu schaffen. Es bietet einen fundierten Überblick über die Ursachen und Auswirkungen von Angst, Disziplinproblemen und Aggression und zeigt Wege auf, wie man diesen Herausforderungen erfolgreich begegnen kann. Lerne, die Zeichen zu deuten, die Ursachen zu verstehen und die richtigen Werkzeuge einzusetzen, um jungen Menschen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Entdecke die Macht einer positiven Lernumgebung, in der Angst abgebaut, Disziplin gefördert und Aggressionen in konstruktive Bahnen gelenkt werden können. Ein Schlüssel zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung junger Menschen, für eine Zukunft voller Erfolg und Harmonie.
Kernwissen Angst
- 1. Definition
= Krone: emotional hochgradig unangenehmer Zustand
= Hansen: bei Angst erlebt man eine allg. Unruhe und eine unheilvolle Ahnung.
- Arten:
a) Eigenschaftsangst = Ausdruck eines überdauernden Persönlichkeitsmerkmal
b) Situationsangst = kurzfristige Reaktion auf eine momentane Gefahr
- Schulangst
a) aktuell-situationsbezogene z.B. Prüfung
b) personenbezogene z.B. vor einem bestimmten Lehrer
c) dispositionelle z.B. Angst vor allem, was zur Schule gehört
- 2. Symptome
- kognitiv
- körperlich: Puls, Herz, Zittern, Schweiß, Schwindel, Brechreiz, Appetit, Magenbeschwerden
- verhaltensmäßig: Vermeidungsverhalten, Pessimismus, Weinerlichkeit, Sprachablaufstörungen, Wahrnehmungsstörungen, Denkablaufstörungen, Motivationsstörungen, Aggression, Depression, Selbsmord
- ABER: Solche Symptome können den Angstzustand nicht sicher anzeigen, denn sie treten bekanntlich auch einzeln oder in Kombination bei anderen psychischen Zuständen auf.
- 3. Angstheorien
a) Psychoanalyse
Hier wurde Angst als die umgewandelte Form unterdrückter Triebenergien angesehen. Später bezeichnete Freud die Angst als einen Zustand der Unlust, der dann eintritt,
- wenn das Ich von aussen bedroht wird (Realangst)
- wenn das Ich von innen durch das Es bedroht wird (Triebangst)
- wenn das Ich von innen durch das Über-Ich bedroht wird (Gewissensangst)
b) Klassische Lerntheorie
Hier ist ein Großteil der Angst erlernt, und zwar durch Konditionierungsvorgänge
c) Kognitive Lerntheorie
Für den Prozess der Angstentstehung spielen Wahrnehmungen, Bewertungen und Erwartungen eine große Rolle. Durch Verzerrungen, Fehlbewertungen und Fehlerwartungen können massive Ängste entstehen. Häufig ist es so, dass die angstmachenden Kognitionen nicht autonom entstehen, sondern durch Modelllernen oder Indoktrination von der schulischen oder familiären Umwelt übernommen werden
- 4. Entstehung / Ursachen
a) Systmatische Gliederung nach Orntner:
Versagensangst, Stigmatisierungsangst, Trennungsangst, Strafangst, Personenangst, Institutionsangst, neurotische Ängste
b) allgemein
- Kinder mit schlechter psychischer Verfassung
- unverarbeitete Konflikte, Nichtakzeptiertwerden durch andere, Geborgenheitsverlust
- Schulalltag, der geprägt ist von Zensuren und neg. Klassenklima und Schulzwang
- 5. Diagnostik
Es empfehlen sich sorgfältige Beobachtungen, Gespräche und Befragungen. Verschiedene Untersuchungsverfahren sind möglich: Zeichnen angsterregender Situationen, Verhaltenseinschätzung durch Lehrer Eltern und Mitschüler, Selbstreferenzen des Kindes, Kinder-Angst-Test (KAT) von Turner, Angstfragebogen für Schüler (AFS) von Wieczerkowski.
- 6. Zusammenhang zwischen Angst und Leistung
a) allgemein
- gering dosiert wirkt Angst im Leistungsbereich aktivierend
- wenn die Intensität stark zunimmt wirkt sie leistungsmindernd
⇒ Es wäre also ein einseitiges Bild wenn man der Angst nur neg. Wirkungen zuschreiben würde.
Angst hat nämlich stets einen aktivierenden Effekt. Das Angsterleben darf allerdings nicht zu stark werden, denn wenn die Intensität des Erlebens ein optimales Maß überschreitet, ist mit einer Beeinträchtigung des Leistungsverhaltens zu rechnen.
b) Erklärung der Leistungsbeeinträchtigung im Zustand gesteigerter Angst
- Enge der Aufmerksamkeit:
ängstliche Gedanken binden Verarbeitungskapazität. Sie setzt der menschlichen Informationsverarbeitung Grenzen. Denn ein Mensch hat Schwierigkeiten zwei Dinge gleichzeitig zu tun, soweit sie diese nicht automatisiert sind. Wenn ein ängstlicher Mensch in einer Sit. Leistung erbringen soll, wird er dann Opfer seines eingeschränkten Informationsverarbeitungsprozesses. Wine (1971) wies darauf hin, dass ängstliche Prüflinge ihre Aufmerksamkeit oft nicht voll auf die Bearbeitung der vorliegenden Aufgabe verwenden können
- Angst wirkt schon vor der Prüfungssituation beeintrÄchtigend:
Denn bereits in der Lernphase wird oft zuviel Aufmerksamkeit auf die neg. Vorstellung eines möglichen Versagens abgezweigt. Aufgrund dieser Besorgnisse entgehen ängstlichen Schülern wesentliche Informationen, die sie eigentlich intensiv aufarbeiten müssten.
⇒ Angst ist deshalb Ursache als auch Folge unzulänglicher Vorbereitung
- 7. Präventionsmöglichkeiten der Schule
- das Angstmachen nicht als Erziehungsmittel verwenden
- eine schülerzentrierte, einfühlsame Kommunikation
- freundlich gestaltete Schulumwelt
- Schüler stofflich nicht überfordern
- Strategien der Prüfungsvorbereitung vermitteln
- Entspannungsverfahren einüben
- Kooperative Lernfomen in denen kein direkter Wettbewerb besteht
- das in 5b beschriebene Dilemma ist nur so zu lösen, dass der ängstliche Schüler sein Selbstbild korrektieren muss.
- Prüfungsangst ist nicht nur ein Merkmal des Schülers sondern auch der Situation. Die Bedingungen für die Situation kann der Lehrer gestalten. Wenn Schüler ein auffallend hohes Maß an Ängstlichkeit entwickeln, dass signalisieren sie indirekt, dass ihre Lernumgebung einer Überprüfung bedarf, dass die Lernbedingungen für sie möglicherweise unangemessen sind. Ständige Bewertungen nach der sozialen Bezugsnorm begünstigen dabei ein schlechtes Lernklima.
- 8. Interventionsmöglichkeiten: Hilfen bei Schulangst
a) Elternhaus:
Erwartungen anpassen, entspannte Atmosphäre zuhause, Hausaufgabenbetreuung, richtige Ernäherung, angstfreie Erziehung, intensiver Kontakt zwischen Schule und Elternhaus
b) Schulbezogene Hilfen :
Pos. verbale Bekräftigung, Vermeidung von Strafe Leistungsdruck und Drohung mit schlechten Zensuren, Klassenarbeiten durch kleinere Leistungsnachweise ersetzen, Einsatz kooperativer Arbeitsformen, Kooperation Grundschule - Kindergarten, Geprächsbereitschaft
d) Therapeutsiche Maßnahmen
a) verhaltenstherapeutische
b) klientenzentrierte
c) Beispiele: Spieltherapie, Gesprächstherapie, Familientherapie, Medikamente, Entspannungstherapie
Kernwissen Disziplin
- 1. Definition
= die Regeln und Kontrollen, de dem individuellen Betragen von aussen auferlegt werden
- zwei Extremformen
a) Laissez-fair = Mensch ist sich selber überlassen
b) Autoritarismus = übertriebene Form
⇒Zwischen diesen beiden Formen gibt es viele verschiedene Arten und Grade der Disziplin
- 2. Funktion
- für die Sozialerziehung, für das Erlernen von Verhaltensformen
- für das normale Reifen der Persönlichkeit wichtig als Reaktion auf ständige soziale Forderungen
- notwendig, damit die jungen Menschen sich die moralischen Verhaltensstandards zu eigen machen
- notwendig wegen der emotionalen Sicherheit der Kinder, denn ohne Lenkung wären diese verwirrt. Sie haben nur eine begrenzte Selbstkontrolle.
- 3. Klassifikation
- kann nach Schwere und Häufigkeit des Auftretens klassifiziert werden
- Schutz (1965): a) Physische Aggression
b) enge Kameradenfreundschaft z.B. Flüstern
c) Aufmerksamkeitssuchende z.B. Briefchen
d) Herausforderung der Autorität
e) Kritische Meinungsverschiedenheit
- Epidemiologie: nach Tausch 1991 werden Leher alle 2,6 Minuten mit einer Situation konfrontiert, die Anlaß für eine disziplinarische Intervention sein könnte. Die Angst vor Disziplinstörungen steht bei Lehrern nach Meyer (1980) an erster Stelle.
- 4. Ursachen
a) beim Schüler
- Störungen der Schülerpersönlichkeit
- hirnorganische Schädigung
- Fehlerziehung
b) beim Lehrer
- mangelndes Durchsetzungsvermögen
- inkonsequentes Sanktionsverhalten
- fehlende Verstärkung erwünschten Verhaltens
- destruktiver Kommunikationsstil
- schlechte UR-Vorbereitung
- zuwenig Formwechsel
- unfreundliches Beziehungsklima
- mangelnder päd. Grundkonsens zwischen den Lehrern
- 5. Handlungsmöglichkeiten
a) Erziehungsmaßnahmen
Ermahnung, Warnung, Tadel, Wiedergutmachung, Strafarbeit, Elterngespräch
⇒Diese wird i.d.R. bei kleineren Normverstößen angewandt
b) Ordnungsmaßnahmen
Klassenbucheintrag, schriftlicher Verweis durch den Klassenlehrer, verschärfter Verweis durch den Direktor, Versetzung in eine Parallelklasse, Zuweisung an eine andere Schule, Auschluss für wenige Tage, Ausschluss bis zu vier Wochen ⇒ Sie dienen zur Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrages, dem Schutz von Personen und Sachen, sowie der Aufrechterhaltung der Hausordnung
c) Jugendrechtliche Maßnahmen
Familienerziehung, Erziehungsbeistand, freiwillige Erziehunghilfe ⇒ wenn a + b keine Wirkung zeigt
⇒ a-c = Obwohl die Schüle bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages auf solche Maßnahmen nicht verzichten kann, sollte die dieses konventionelle Repertoire durch verhaltens- und kommunikationspsychologische Strategien erweitern. Hierzu gehört das Ignorieren leichter Normverstöße, der Einsatz körpersprachlicher Lenkungsmittel, aktives Zuhören, kooperative Verhaltensmodifikation
d) Prävention
- Verbesserung des UR
- strukturierte UR-Durchführung
- interessante Stoffdarbietung
- wirksame Klassenführung
- wenig Wirkung zeigt eine antiautoritäre Erziehung. Denn diese verkennen, dass den Heranwachsenden die Einsicht in die Notwendigkeit von Regeln des menschlichen Zusammenlebens noch schwerer gelingt als uns Erwachsenen
- 6. Geschichtliche Entwicklung der Auffassungen
Haben sich von der Gewaltanwendung zu Überzeugungsversuchen bis hin zu Theorien der Selbstdisziplin verschoben. In früheren Zeiten wurde Ordnung durch Zwangsmittel geschaffen z.B. Arrest, körperliche Bestrafung etc. Die neueren Auffassungen über Disziplin als Selbstkontrolle implizieren das Lernen eines Verantwortungsgefühls gegenüber sich selbst, seinen Klassenkameraden und der Schule
Kernwissen Aggression
- 1. Definition
- Aggression = körperliches oder verbales Handeln, das mit der Absicht ausgeführt wird, zu verletzen, zu schädigen oder gar zu zerstören
- Aggressivität = überdauernde Bereitschaft zu aggressiven Verhaltensweisen
- Historisch:
Aggression schon früh ein Thema wissenschaftlicher Überlegungen. Früher als Altruismus. Das Böse im Menschen hat Wissenschaftler stärker fasziniert als das Gute
- 2. Erscheinungsformen
- Arten der Aggression
a) offen: köperlich oder verbal ODER versteckt
b) pos.: von der Kultur gebilligt ODER negativ (mißbilligt)
- Unterscheidungen
a) hinsichtlich des Operationsmodus: direkter Angriff (offen z.B. Beleidigung) oder indirekt z.B. Verleumdung
b) hinsichtlich des Objektes: sachen, Lebendiges (Pflanzen, Tiere), Menschen
c) hinsichtlich der Begehensform: tätlich oder verbal
- Unterscheidung
a) Instrumentelle Aggression
b) Feindselige Aggression
= absichtsvolle Schädigung zur Erreichung eines anderen Ziels. Basiert auf rationaler Abwägung von Kosten und Nutzen
= absichtsvolle Schädigung zur Erreichung des Ziels der Verletzung oder Tötung des Opfers Basiert auf irrationalen Impulsen und Emotionen
- 3. Psychologische Erklärungsansätze / Ursachen
⇒ zahlreiche Theorien: Biologische Theorie, Ethnologischer Ansatz, Psychoanalytische Sichtweise, Frustrations-Aggressions- Hypothese, Lerntheoretischer Ansatz (klassisches und operantes Konditionieren, Modelllernen.)
1. Triebtheoretische Ansätze ⇒ Aggression als angeborenes Verhalten (unvermeidlich!!)
a) McDougall (1908) = A. als einer von 18 Instinkten
b) Freud (1920): Psychoanalyse
- Lebens- und Todestrieb ⇒ Eros und Thamatos
- A. = Hauptvertreter des Todestriebes
- Möglichkeiten zum Umgang mit diesem Trieb:
1. A.hemmung: Je stärker die Hemmung nach aussen umso stärer die
Autoaggression. Lösung ⇒ A. so ablenken dass sie nicht
Menschheitszerstörung bewirkt.
2. A.verschiebung: Motiv dessen Ziel blockiert ist sucht sich Ersatzziel
3. Sublimierung: Umleitung destruktiver Energie auf ein soziales
4. Katharsis: Befreiung von emotionaler Spannung durch Abreagieren
⇒ Möglichkeit der Intervention: Katharsis = Dampf ablassen ⇒ funktioniert leider nicht.
c) Lorenz (1963): Verhaltensforschung
- A. = Trieb der direkt + indirekt entladen werden muss
- je stärker der Druck, desto stärker können die Auslösereize sein.
- Zivilisation = bietet nicht ausreichende Mögl. zur A.entladung
- A. = ein auf Artgenossen gerichteter Kampftrieb gegen Mensch und Tier
- Mögl. der A.entladung = Umlenken, Sport, Sublimierung
Kritik a - c = Instinkttheorien zirkulär. Außerdem: unscharfe Konzepte
2. Die Frustrations - Aggressions - Hypothese von Dollard (1939) ⇒ A. als situativ ausgelöstes Verhalten
- A. = Folge einer Frustration (Frustration = wenn zielo. Hdl. unterbrochen wird)
⇒ je größer die F. umso größer die A.
- Wie sich die A. ausprägt ist von vier Faktoren abhängig:
a) Faktoren, welche die Stärke der A.neigung beeinflussen
b) Faktoren, welche zur Hemmung der A. beitragen
c) Faktoren, welche die Richung + Form beeinflussen
d) Faktoren, welche zur Reduktion der A.neigung führen
- Modifizierung dieser Theorie
a) Miller: Einschränkung ⇒ Frustration produziert verschiedene Reaktionen, eine davon ist A.
b) Neuere Version der FAH = Frustriertendes Ereignis ⇒ Ärger ⇒ Aggression⇒Reduktion von Ärger und Aggression
- Kritik = Zusammenhänge treten zwar auf, aber nicht in der behaupteten Zwangsläufigkeit
3. Lerntheoretische Ansätze (A. als erlerntes Verhalten)
a) Berkowitz: Lernen am Erfolg = kog.neoassoziationsistische Ansatz
- R-R-Schema ⇒ Wiederholgung bei erfolgreicher A.
- Mögl. des A.erfolgs: pos. Bewertung, Interessendurchsetzung, Aufmerksamkeit, Selbstschutz
- Ob sich Verhlaten manifestiert hängt von Kog. Prozessen höherer Ordnung ab
- Folge: Abbau der Aggression durch kog. Intervention
= Modelllernen (Erwachsene missbilligen Gewalt)
= Integration von Antiaggresionsüberzeugungen in das Selbstkonzept
= Trainin sozialer Fertigkeiten (Verhandeln, Kompromisse schließen, kooperative Problemlösung)
b) Bandura: Lernen am Modell = A. als gelerntes Sozialverhalten
- Aggressives Verhalten einer Modellperson wird nachgeahmt
- Folge: aggressive Bestrafung [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] richtig
- Aggressives Verhalten ist nicht angeboren, sondern durch Erfahrung erworben.
- Drei Faktoren = Lerngeschichte, gegenwärtige Belohnungssituation, situative Bedingungen
- Emprirische Untersuchungen des Einflusses von Medien 1978 ⇒Bestätigten Theorie
4. Entstehungsbedingungen in den Entwicklungsphasen
1. Oralphase (1.Lj) : mangelnde Zuwendung, körperliche + seelische Anregungsbedürftigkeit des Kindes wird missachtet
2. Analphase (2-3 Lj) : autoritäre Unterwerfungspraktiken oder Ehrgeizhaltungen ⇒ stören die kindlichen Entwicklungsdynamik ⇒Selbstvertrauen wird zerstört
Folge: Autoaggression
3. Geltungsstreben : Beziehungsdefizit durch elterliches Ambivalenzverhalten oder offene Ablehnung
(4-5 Lj) Folge: Geltungsdrang ⇒ Machtorientiertes Verhalten
4. Schulalter : familiäre Ambivalenzen, unsichere Basis, Beziehungsverlus (bis Pubertät) Folge: Verunsicherung ⇒ agg. Personen als Identitätsfaktoren bringen Sicherheit
- 4. Prävention
- pos. Gestaltung des Lernumfeldes ( Rituale, Regeln, Schüler mit einbeziehen)
- S-L-Beziehung (prozesso. Leistungsbewertung, Ich-Botschaften, Zuversicht)
- ethische Erziehung (Bildung des Gewissens, der Vernunft, des Willens und des Gemüts)
- Korrektur des Männlichkeitsbildes
- Einrichtung demokratischer Instanzen (Klassenordnung, Klassengericht)
- Integration von Spielen in den UR
- Gesprächskultur einüben (z.B. nach Gordon ⇒ konstruktive Konfliktbewältigung)
- did. Prinzipien beachten (Individualisierung, Differenzierung, Ganzheitlichkeit etc.)
- 5. Intervention
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Trainingsprogramme von Autoren
Petermann, Gratzer, Olweus, Gordon, Lindquist, Neubauer, Konstanzer Selbsthilfeprogramm
⇒ Olweus: Programm zur Gewaltintervention an Schulen
⇒ Lindquist: Lösungsstrateige „Umdeuten der Situation
Häufig gestellte Fragen
Was ist Angst laut diesem Text?
Angst wird als ein emotional hochgradig unangenehmer Zustand definiert. Hansen beschreibt Angst als eine allgemeine Unruhe und eine unheilvolle Ahnung.
Welche Arten von Angst werden unterschieden?
Es werden Eigenschaftsangst (Ausdruck eines überdauernden Persönlichkeitsmerkmals) und Situationsangst (kurzfristige Reaktion auf eine momentane Gefahr) unterschieden. Bezüglich Schulangst werden aktuell-situationsbezogene, personenbezogene und dispositionelle Ängste differenziert.
Welche Symptome können bei Angst auftreten?
Die Symptome können kognitiv, körperlich (Puls, Herzrasen, Zittern, Schweißausbruch, Schwindel, Brechreiz, Appetitlosigkeit, Magenbeschwerden) und verhaltensmäßig (Vermeidungsverhalten, Pessimismus, Weinerlichkeit, Sprachablaufstörungen, Wahrnehmungsstörungen, Denkablaufstörungen, Motivationsstörungen, Aggression, Depression, Selbstmord) sein. Es wird jedoch betont, dass diese Symptome nicht immer eindeutig Angst anzeigen, da sie auch bei anderen psychischen Zuständen auftreten können.
Welche Angsttheorien werden vorgestellt?
Die Psychoanalyse (Angst als umgewandelte Form unterdrückter Triebenergien), die klassische Lerntheorie (Angst als erlernt durch Konditionierung) und die kognitive Lerntheorie (Bedeutung von Wahrnehmungen, Bewertungen und Erwartungen bei der Angstentstehung) werden erläutert.
Welche Ursachen für Angst werden genannt?
Orntner gliedert in Versagensangst, Stigmatisierungsangst, Trennungsangst, Strafangst, Personenangst, Institutionsangst und neurotische Ängste. Allgemein werden genannt: schlechte psychische Verfassung des Kindes, unverarbeitete Konflikte, Nichtakzeptiertwerden, Geborgenheitsverlust, negatives Schulklima, Schulzwang.
Wie kann Angst diagnostiziert werden?
Es werden sorgfältige Beobachtungen, Gespräche und Befragungen empfohlen, sowie verschiedene Untersuchungsverfahren wie Zeichnen angsterregender Situationen, Verhaltenseinschätzung, Selbstreferenzen und spezifische Angsttests (KAT, AFS).
Wie hängt Angst mit Leistung zusammen?
Gering dosierte Angst kann im Leistungsbereich aktivierend wirken, während stark zunehmende Intensität leistungsmindernd ist. Es wird betont, dass Angst stets einen aktivierenden Effekt hat, aber bei zu hoher Intensität die Leistung beeinträchtigt.
Wie beeinflusst Angst die Leistungsfähigkeit?
Angst kann die Aufmerksamkeit verengen und Verarbeitungskapazität binden. Ängstliche Gedanken lenken von der Aufgabenbearbeitung ab und beeinträchtigen die Informationsverarbeitung. Auch in der Lernphase kann Angst durch negative Vorstellungen eines möglichen Versagens die Aufmerksamkeit abzweigen und somit eine unzulängliche Vorbereitung verursachen.
Welche Präventionsmöglichkeiten gibt es in der Schule?
Das Angstmachen soll nicht als Erziehungsmittel verwendet werden. Wichtig sind eine schülerzentrierte Kommunikation, eine freundlich gestaltete Schulumwelt, Vermeidung von Überforderung, Vermittlung von Strategien der Prüfungsvorbereitung, Einüben von Entspannungsverfahren und kooperative Lernformen.
Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es bei Schulangst?
Elternhaus: Erwartungen anpassen, entspannte Atmosphäre, Hausaufgabenbetreuung, richtige Ernährung, angstfreie Erziehung, intensiver Kontakt zur Schule. Schulbezogene Hilfen: positive verbale Bekräftigung, Vermeidung von Strafe/Leistungsdruck/Drohung, kleinere Leistungsnachweise statt Klassenarbeiten, kooperative Arbeitsformen, Kooperation Grundschule-Kindergarten, Gesprächsbereitschaft. Therapeutische Maßnahmen: Verhaltenstherapie, klientenzentrierte Therapie, Spieltherapie, Gesprächstherapie, Familientherapie, Medikamente, Entspannungstherapie.
Was ist Disziplin laut diesem Text?
Disziplin wird als die Regeln und Kontrollen definiert, die dem individuellen Betragen von außen auferlegt werden. Es werden zwei Extremformen genannt: Laissez-faire und Autoritarismus.
Welche Funktionen hat Disziplin?
Disziplin dient der Sozialerziehung, dem Erlernen von Verhaltensformen, dem normalen Reifen der Persönlichkeit und der Vermittlung moralischer Verhaltensstandards. Sie ist notwendig für die emotionale Sicherheit der Kinder.
Wie werden Disziplinstörungen klassifiziert?
Disziplinstörungen können nach Schwere und Häufigkeit klassifiziert werden. Schutz (1965) nennt: Physische Aggression, enge Kameradenfreundschaft, Aufmerksamkeitssuchende, Herausforderung der Autorität, kritische Meinungsverschiedenheit.
Welche Ursachen für Disziplinstörungen werden genannt?
Beim Schüler: Störungen der Schülerpersönlichkeit, hirnorganische Schädigung, Fehlerziehung. Beim Lehrer: mangelndes Durchsetzungsvermögen, inkonsequentes Sanktionsverhalten, fehlende Verstärkung erwünschten Verhaltens, destruktiver Kommunikationsstil, schlechte Unterrichtsvorbereitung, unfreundliches Beziehungsklima, mangelnder pädagogischer Grundkonsens.
Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es bei Disziplinstörungen?
Erziehungsmaßnahmen: Ermahnung, Warnung, Tadel, Wiedergutmachung, Strafarbeit, Elterngespräch. Ordnungsmaßnahmen: Klassenbucheintrag, Verweis, Versetzung in Parallelklasse, Zuweisung an andere Schule, Ausschluss. Jugendrechtliche Maßnahmen: Familienerziehung, Erziehungsbeistand, freiwillige Erziehungshilfe.
Wie hat sich die Auffassung von Disziplin geschichtlich entwickelt?
Die Auffassungen haben sich von Gewaltanwendung zu Überzeugungsversuchen und Theorien der Selbstdisziplin verschoben. Früher wurde Ordnung durch Zwangsmittel geschaffen, während neuere Auffassungen Selbstkontrolle und Verantwortungsgefühl implizieren.
Was ist Aggression laut diesem Text?
Aggression wird als körperliches oder verbales Handeln definiert, das mit der Absicht ausgeführt wird, zu verletzen, zu schädigen oder gar zu zerstören. Aggressivität ist die überdauernde Bereitschaft zu aggressivem Verhalten.
Welche Erscheinungsformen von Aggression werden unterschieden?
Es werden offene (körperliche oder verbale) und versteckte, positive (von der Kultur gebilligte) und negative (missbilligte) Aggression unterschieden. Weiterhin werden Unterschiede hinsichtlich des Operationsmodus (direkt oder indirekt), des Objektes (Sachen, Lebendiges, Menschen) und der Begehensform (tätlich oder verbal) gemacht. Es gibt instrumentelle und feindselige Aggression.
Welche psychologischen Erklärungsansätze für Aggression gibt es?
Es werden triebtheoretische Ansätze (Aggression als angeborenes Verhalten), die Frustrations-Aggressions-Hypothese (Aggression als Folge von Frustration) und lerntheoretische Ansätze (Aggression als erlerntes Verhalten) vorgestellt.
Welche Theorien gibt es im Bezug zur Entstehung von Aggression in den Entwicklungsphasen?
In der Oralphase kann mangelnde Zuwendung zu Aggression führen. In der Analphase können autoritäre Unterwerfungspraktiken das Selbstvertrauen zerstören. Im Alter des Geltungsstrebens kann ein Beziehungsdefizit zu machtorientiertem Verhalten führen. Im Schulalter können familiäre Ambivalenzen zu Verunsicherung führen, wobei aggressive Personen als Identitätsfaktoren Sicherheit bringen können.
Welche Präventionsmaßnahmen gegen Aggression werden genannt?
Positive Gestaltung des Lernumfeldes, positive Schüler-Lehrer-Beziehung, ethische Erziehung, Korrektur des Männlichkeitsbildes, Einrichtung demokratischer Instanzen, Integration von Spielen in den Unterricht, Gesprächskultur und Beachtung didaktischer Prinzipien.
Welche Interventionsmaßnahmen gibt es gegen Aggression?
Es werden Trainingsprogramme von verschiedenen Autoren (Petermann, Gratzer, Olweus, Gordon, Lindquist, Neubauer) genannt. Olweus' Programm zur Gewaltintervention an Schulen, Lindquist's Lösungsstrategie "Umdeuten der Situation" und Gratzer's sozialintegratives Lehrerverhalten werden besonders hervorgehoben.
- Quote paper
- Joachim Brenner (Author), 2001, Verhaltensstörungen: Aggression, Angst, Disziplin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103393