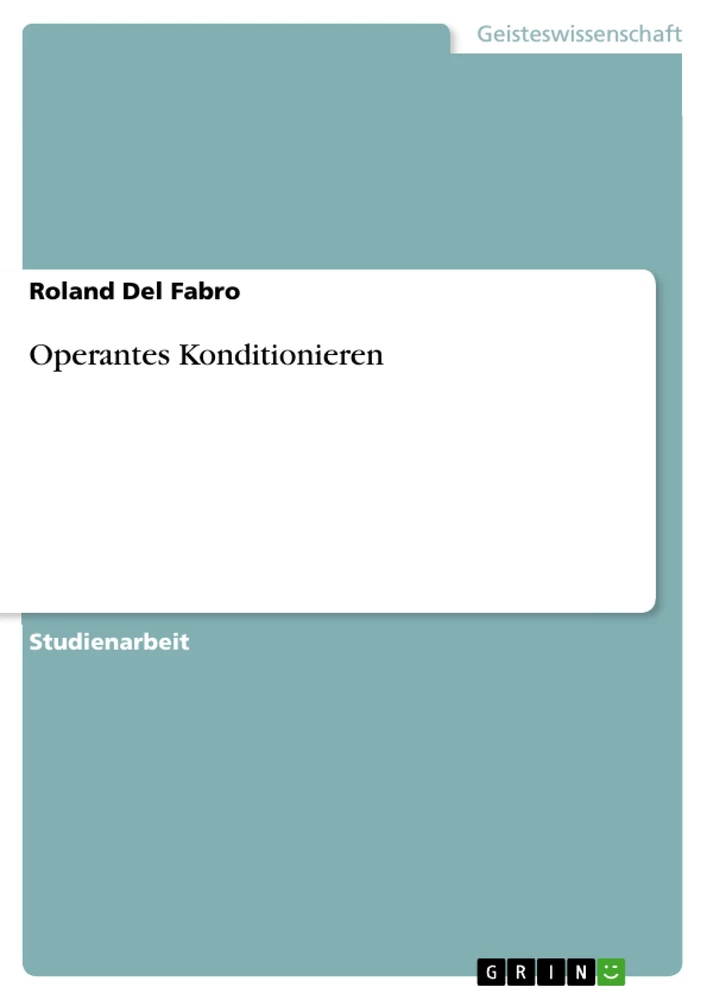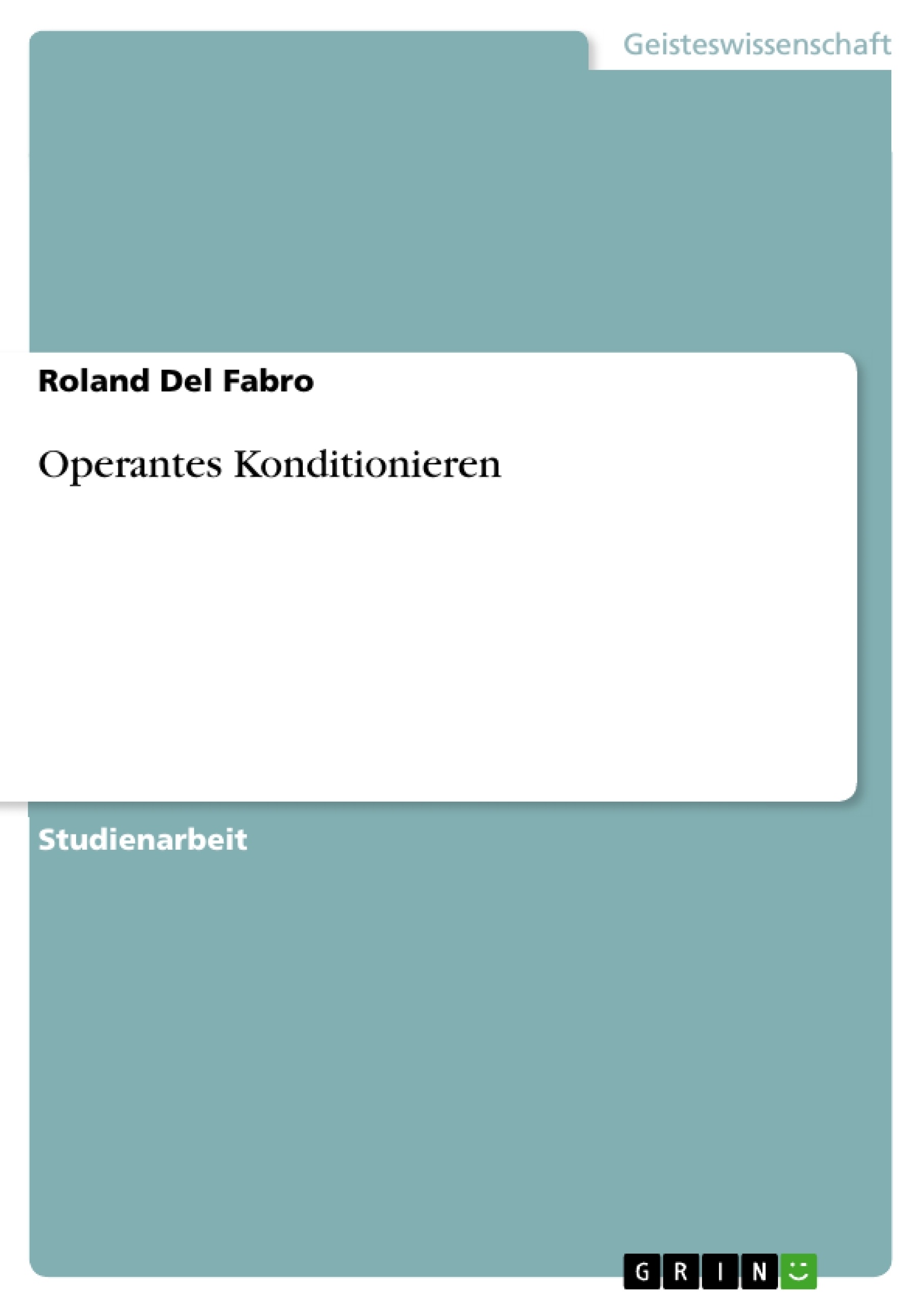Stell dir vor, du könntest das Verhalten deiner Mitmenschen verstehen und sogar positiv beeinflussen. Dieses Buch enthüllt die faszinierende Welt der operanten Konditionierung, ein mächtiges Werkzeug zur Verhaltensänderung, das auf den Prinzipien von Belohnung und Bestrafung basiert. Anhand von fundierten theoretischen Grundlagen, beginnend mit den bahnbrechenden Arbeiten von Pawlow, Thorndike, Watson und insbesondere B.F. Skinner, wird der Leser in die Lage versetzt, die komplexen Mechanismen der Verhaltenssteuerung zu durchdringen. Entdecke die Schlüsselkonzepte wie Verhaltenskontingenz, Verstärkerarten (primäre, sekundäre und generalisierte), sowie bewährte Methoden wie Shaping, Chaining, Prompting und Fading, die in vielfältigen Kontexten Anwendung finden. Das Buch beleuchtet detailliert die verschiedenen Verstärkungsarten – von Belohnung und Bestrafung bis hin zur Löschung – und zeigt, wie diese gezielt eingesetzt werden können, um gewünschte Verhaltensweisen zu fördern und unerwünschte zu reduzieren. Ein aufschlussreiches Fallbeispiel veranschaulicht die praktische Anwendung der Theorie im Kontext der offenen Jugendarbeit, wobei die Herausforderungen und Erfolge bei der Motivation von Jugendlichen zu aktivem Verhalten aufgezeigt werden. Der Theorie-Praxis-Transfer wird durch eine klare Zieldefinition und die sorgfältige Auswahl der Verstärkermethoden greifbar gemacht, sodass der Leser in die Lage versetzt wird, eigene Projekte zur Verhaltensänderung erfolgreich umzusetzen. Kritische Auseinandersetzungen mit der Theorie und persönliche Überlegungen des Autors runden das Werk ab und regen zur Reflexion über die ethischen Aspekte der Verhaltensbeeinflussung an. Ob in der Erziehung, im Management oder in der Therapie – dieses Buch bietet wertvolle Einblicke und praktische Anleitungen für alle, die das Verhalten ihrer Mitmenschen besser verstehen und positiv gestalten möchten. Tauche ein in die Welt der Lernpsychologie und entdecke das Potenzial der operanten Konditionierung für eine effektive und verantwortungsbewusste Verhaltensänderung.Dieses Buch ist ein Muss für Pädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen und alle, die an den Grundlagen menschlichen Verhaltens interessiert sind und nach praxistauglichen Werkzeugen suchen, um positive Veränderungen zu bewirken.
INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
1.1. ERKLÄRUNG ZUR THEMENWAHL
1.2. FRAGESTELLUNG
1.3. HYPOTHESE
2. PROLOG IN DIE THEORIE
2.1. KLASSISCHE KONDITIONIERUNG
2.2. OPERANTE KONTITIONIERUNG
3. GRÜNDER DER OPERANTEN/INSTRUMENTELLEN KONDITIONIERUNG
3.1. GESETZ DER WIRKUNG (E.L. THORNDIKE)
3.2. BEHAVIORISMUS (WATSON)
3.3. DAS PARADIGMA DER OPERANTEN/INSTRUMENTELLEN KONDITIONIERUNG (B.F. SKINNER)
3.3.1. DIE VERHALTENSKONTINGENZ
3.3.2. DIE SKINNER - BOX
3.3.3. VERSTÄRKUNGSARTEN
3.3.3.1. Belohnung
3.3.3.2. Bestrafung
3.3.3.3. Löschung (auch etwa: Löschungen im weiteren Sinn)
3.3.4. VERSTÄRKERARTEN
3.3.4.1. Primäre Verstärker:
3.3.4.2. Sekundäre Verstärker:
3.3.4.3. Generalisierende Verstärker:
3.3.5. METHODEN ZUR VERHALTENSBEEINFLUSSUNG
3.3.5.1. Shaping (Verhaltensformung)
3.3.5.2. Chaining (Verhaltensverkettung)
3.3.5.3. Prompting (Hilfestellungen)
3.3.5.4. Fading (Ausblenden der Hilfestimuli)
3.3.6. DER DISKRIMINATIVE REIZ
4. FALLBEISPIEL
4.1. PERSÖNLICHKEIT
4.2 SOZIALE PROBLEMATIK
4.3. INSTITUTION
5. THEORIE – PRAXIS – TRANSFER
5.1. ZIELDEFINIERUNG
5.2. WAHL DER VERSTÄRKERMETHODEN/ -ARTEN UND DEREN WIRKUNG
5.3. FAZIT ZUM THEORIE- PRAXISTRANSFER
6. RESÜMEE
6.1. KRITIK AN DER THEORIE
6.2. PERSÖNLICHE ÜBERLEGUNGEN
7. LITERATURVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
1.1. ERKLÄRUNG ZUR THEMENWAHL
Ein Aspekt des pädagogischen Auftrags in der offenen Jugendarbeit besteht darin, die Be- nützer und Benützerinnen für diejenigen Tätigkeiten, die im Jugendtreff anfallen, zu sensibi- lisieren. Dadurch sollen Jugendliche u.a. lernen, Selbstverantwortung zu tragen und sich mit dem Jugendtreff zu identifizieren. In diesem Zusammenhang wird auch versucht, der ausge- prägten Konsumhaltung von Jugendlichen entgegenzuwirken, indem sie zum Beispiel in den kreativen Prozess einer Neugestaltung der Räumlichkeiten miteinbezogen werden.
Durch zahlreiche Gespräche mit Berufskollegen und -kolleginnen an regionalen Arbeitssitzun- gen, aus eigenen beruflichen Erfahrungen sowie durch einschlägige Literatur stellte sich je- doch heraus, dass es einem grossen Teil von Jugendarbeitern und Jugendarbeiterinnen schwer fällt, Jugendliche für ein aktives Mitgestalten des Jugendtreffalltags zu gewinnen.
Denn die Motive vieler Jugendlichen den Jugendtreff zu besuchen, entsprechen nicht immer den Ansprüchen der Jugendtreffbetreiber. Diese Diskrepanz zeigt sich vor allem im Zusam- menhang mit dem Problem, ob Einsätze von Jugendlichen (wie z.B. den Jugendtreff neu ges- talten, putzen usf.) mit einem Entgeld vergütet werden sollen. Somit kann man vermuten, dass unentgeltliche Tätigkeiten, die der Allgemeinheit zu gute kommen bei Jugendlichen nicht gefragt sind.
Die Wahl der Lerntheorien bereitete mir über längere Zeit Mühe. Alle Theorien schienen mir sehr spannend und auch dazu geeignet, in die Praxis umgesetzt zu werden. Der Umstand, dass wir den neuen Jugendtreff mit viel Eigenleistung einrichten müssen, kam mir aber sehr entgegen. Mit der Anwendung der operanten/instrumentellen Konditionierung sah ich näm- lich die Möglichkeit, die Jugendlichen zu einem aktiven und engagierten Verhalten zu führen. Dies gelang mir bei meinem Fallbeispiel Senad im vorgeschriebenen Zeitraum nicht, jedoch werde ich mit Senad weiter am gewünschten Verhalten arbeiten.
1.2. FRAGESTELLUNG
Ist es auf der Basis der Theorie der positiven Verstärkung und der Anwendung von Verstär- kungsmethoden wie dem Shaping– Verfahren möglich, einen trägen Jugendlichen so zu kon- ditionieren, dass er anstelle von passivem aktives Verhalten entwickelt?
1.3. HYPOTHESE
Ich behaupte, dass durch die Anwendung der operanten/instrumentellen Konditionierung von B.F. Skinner die Möglichkeit besteht, sich träge und passiv verhaltende Jugendlichen zu aktivem Verhalten motivieren zu können.
2. PROLOG IN DIE THEORIE
Konditionierung steht für das Erlernen eines bestimmten Reiz-Reaktions-Verhaltens, d.h. auf einen bestimmten Reiz (Stimulus) erfolgt eine entsprechende Reaktion (Response). Es wird zwischen folgenden zwei Formen der Konditionierung unterschieden:
2.1. KLASSISCHE KONDITIONIERUNG:
Darunter verstehen wir das Pawlow’sche Prinzip der Steuerung von ursprünglich unkonditio- nierten Reaktionen (ungelernte, unwillkürliche und automatische Reaktionen=UCR wie es- sen, schlafen, fortpflanzen etc.) durch ursprünglich neutrale Außenreize(neutrale Reize=NR). Verknüpft man einen neutralen Reiz mit einem unkonditionierten Reiz, erfolgt nach einer gewissen Zeit die bedingte Reaktion (gelernte Reaktion=CR).
Beispiel: Ein neutraler Reiz (z.B. ein Ton) wird kurz vor einem unkonditionierten Reiz (z.B. Futter) einem Hund dargeboten. Der unkonditionierte Reiz löst eine un- konditionierte Reaktion (z.B. Speichelfluss) aus. Nach wiederholter Paarung (Ton und Futter) löst der neutrale Reiz (Ton) auch ohne den unkonditionierten Reiz (Futter) eine konditionierte Reaktion (Speichelfluss) aus.
2.2. OPERANTE KONDITIONIERUNG:
Nach B.F. Skinner kann die Motivation für ein auf die Umwelt einwirkendes Verhalten je nach Reaktion der Umwelt verstärkt oder abgeschwächt werden.
Beispiel: Versuchstiere, die zufällig den Öffnungsmechanismus ihres Problemkäfigs (siehe Punkt 3.3.2., S.6) entdecken und dafür mit Futter belohnt werden, fin- den den Mechanismus in der Folge immer schneller.
Bei der operanten Konditionierung muss das Versuchsobjekt die zu verstär- kende (belohnende) Handlung immer selbst finden.
(vgl. www.sign-lang.uni-hamburg.de (29. April 2001)
3. GRÜNDER DER OPERANTEN/INSTRUMENTELLEN KONDITIO- NIERUNG
Die drei amerikanischen Psychologen – Edward L. Thorndike, John B. Watson und B.F. Skin- ner – gelten als Pioniere in der Entwicklung des Verfahrens des instrumentellen bzw. operan- ten Konditionierens.
3.1. GESETZ DER WIRKUNG (E.L. THORNDIKE)
Gemäss Thorndike’s Paradigma (bzw. Model) ist Lernen ein Vorgang zwischen einem Reiz (S) und einer Reaktion (R) des Organismus – eine Reiz–Reaktion (S-R) Verbindung. Er ging da- von aus, dass Reaktionen, auf die eine Belohnung erfolgt, „Befriedigung“ bringen. Deshalb werden diese verstärkt und „eingeprägt“. Das „nicht-Belohnen“ von Reaktionen hat demnach zur Folge, dass diese geschwächt oder sogar „gelöscht“ werden.
(vgl. Zimbardo, 1992, S.240 u. S.241)
3.2. BEHAVIORISMUS (WATSON)
Watson’s Ansicht nach sollte sich die psychologische Forschung nur beobachtbares Verhalten beschränken. Die Methode des Behaviorismus ist eine Psychologie, die ausschließlich auf Verhaltensweisen basiert, die durch einen außenstehenden Beobachter feststellbar sind.
Im Prinzip versucht der Behaviorist den Organismus (sowohl den menschlichen als auch den tierischen) nach dem Vorbild einer Maschine zu verstehen. Einer Maschine allerdings, in die er nicht hineinsehen kann
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: www. Stangel-taller.at, 29. April 2001
(Black-Box), sondern deren Funktionsweise nur aus dem Input (Reiz) und dem Output (Re- aktion) zu erschließen ist. Psychische Vorgänge wie z.B. Gefühle, Ängste und Wahrnehmun- gen werden dabei also in Reiz-Reaktions-Verbindungen aufgelöst (daher auch die Bezeich- nung Reiz- Reaktions-, bzw. Stimulus – Response – Psychologie).
(vgl. www.stangl-taller.at, 29. April 2001)
3.3. DAS PARADIGMA DER OPERANTEN/INSTRUMENTELLEN KONDITIO- NIERUNG (B.F. SKINNER)
B.F. Skinner war wohl einer der prominentesten Vertreter des operanten Konditionierens. Die Theorie der operanten Konditionierung orientiert sich an vier zentralen Aspekten:
- Verhaltenskontingenzen
- Verstärker
- Methoden zur Verhaltensänderung
- diskriminierenden Reizen
In den folgenden drei Kapiteln werde ich diese vier relevanten Aspekte näher beschreiben.
3.3.1. DIE VERHALTENSKONTINGENZ
Gemäss Skinner spricht man von Verhaltenskontingenz, wenn eine konsistente Beziehung zwischen einer Reaktion (Verhalten) und der nachfolgenden Reiz (Verstärker) besteht. Unter Kontingenz versteht man auch eine Beziehung vom Typ „wenn X – dann Y “. Durch eine sol- che Beziehung kann die Auftretenshäufigkeit oder die Reaktionswahrscheinlichkeit gesenkt oder erhöht werden.
Beispiel: Wenn eine Taube jedes Mal ein Korn erhält, wenn sie auf eine Scheibe pickt, wird die Pick–Reaktion immer häufiger. Wichtig dabei ist, dass nur diejenigen Pick-Reaktionen, welche auf die Scheibe ausgeübt werden, belohnt werden (siehe Punkt 3.3.3.1., S.7), und dass die Belohnung unmittelbar nach der gewünschten Reaktion erteilt wird.
(vgl. Z.T. Zimbardo, 1992, S.243 u. S.244)
3.3.2. DIE SKINNER - B OX
Skinner konstruierte die nach ihm benannte Skinner-Box. Mit Hilfe der Skinner-Box können die Versuchsbedingungen exakt festgelegt und von äußeren Einflüssen abgeschirmt werden. In der Box kann sich das Versuchstier durch Betätigen eines Hebels Futter beschaffen.
Die wichtigste Methode zur Erforschung des Verhaltens gemäss Skinner ist die präzise und regelmässige Beobachtung einzelner Merkmale des Verhaltens. Skinner konnte aufzeigen, dass komplexe Verhaltensweisen als Produkte bestimmter Muster von Kontingenzen verstan- den werden können.
Skinner’s Lerntheorien werden heute noch in der Verhaltenstherapie, Tierdressuren, und der Werbung angewendet. (vgl. Zimbardo, 1992, S.243 u. S.244)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: www.pcz.uni-dortmund.de, 29. April.01
1. Kasten, durch den das Versuchstier von Aussenreizen abgeschirmt wird.
2. Taste, Hebel oder eine Scheibe, durch die sich das Tier Futter beschaffen kann, so- fern es die erwünschte Verhaltensweise annimt.
3. Vorrichtung zur Abgabe von Futterkugeln; zumeist auch diverse Lämpchen (Hinweis- reize).
4. Fernsehkamera, um die Reaktionen des Versuchstieres aufzuzeichnen.
(vgl. z.T. ww.pcz.uni-dortmund.de, 29. April.01)
3.3.3. VERSTÄRKUNGSARTEN
3.3.3.1. Belohnung
Das Verhalten eines Organismus kann mittels Konsequenzen (Verstärkungen) so gesteuert werden, dass eine gewünschte Reaktion vermehrt auftritt.
Wenn nur eine bestimmte Anzahl von Reaktionen verstärkt werden, spricht man von einem Quotenplan . Beim Intervallplan wird nach einer festgesetzten Zeitspanne die Reaktion verstärkt, ohne die gezeigten Reaktionen zu berücksichtigen.
(vgl. z.T. www.uni-freiburg.de, 29.4. 2001)
Positive Verstärkung
- eine angenehme Umweltreaktion (positive Konsequenzen = C+) wird dargebo- ten.
Beispiel: Ein Jugendlicher beteiligt sich an Renovationsarbeiten, woraufhin er Hilfe beim Aufsetzen seines Lebenslaufes, den er für das Bewerbungsschreiben benö- tigt, erhält.
Negative Verstärkung
- eine unangenehme Umweltreaktion (negative Konsequenzen = C-) wird entzo- gen.
Bespiel: Jugendliche organisieren aus eigener Initiative eine Party. Als Belohnung wird die Öffnungszeit des Treffs um eine Stunde verlängert.
3.3.3.2. Bestrafung
Um die Auftretenswahrscheinlichkeit eines unerwünschten Verhaltens zu verringern, wird das unerwünschte Verhalten bestraft. Bestrafung sollte möglichst intensiv und sofort nach der unerwünschten Reaktion erfolgen, grundsätzlich aber sollte sie reduziert angewendet wer- den.
Positive (=direkte ) Bestrafung Typ I
- eine unangenehme Umweltreaktion wird zugefügt (negative Konsequenzen = C-).
Beispiel: Ein Jugendlicher bedroht im Jugendtreff jemanden mit einem Messer, worauf er des Hauses verwiesen und gegebenenfalls bei der Polizei angezeigt wird.
Negative (=indirekte) Bestrafung Typ II (auch etwa: Löschung im engeren Sinn)
- Eine angenehme Umweltreaktion wird bewusst entfernt (positive Konsequenz = C+).
Beispiel: Jugendliche hören zu laut Musik, worauf der Strom ausgeschaltet wird.
3.3.3.3. Löschung (auch etwa: Löschungen im weiteren Sinn)
Die Löschung wird dann verwendet, wenn eine nicht erwünschte Verhaltensweise zu verringern bzw. zu eliminieren ist.
- Sämtliche Reaktionen der Umwelt entfallen (alle Konsequenzen entfallen = C-).
(vgl. z.T. Webpage: uni-freiburg.de, 29.4. 2001)
3.3.4. VERSTÄRKERARTEN
3.3.4.1. Primäre Verstärker:
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Einführung (mit Erklärung zur Themenwahl, Fragestellung, Hypothese), Prolog in die Theorie (klassische und operante Konditionierung), Gründer der operanten/instrumentellen Konditionierung (Thorndike, Watson, Skinner), Fallbeispiel, Theorie – Praxis – Transfer (Zieldefinition, Wahl der Verstärkermethoden, Fazit), Resümee (Kritik, persönliche Überlegungen) und Literaturverzeichnis.
Was ist das Thema der Einleitung?
Die Einleitung behandelt die Sensibilisierung von Jugendlichen für Tätigkeiten im Jugendtreff, die Schwierigkeit, Jugendliche für aktive Mitgestaltung zu gewinnen, und die Frage, ob Einsätze von Jugendlichen vergütet werden sollen. Es wird auch die Wahl der Lerntheorien und die Anwendung der operanten Konditionierung thematisiert.
Welche Fragestellung wird in der Arbeit untersucht?
Die Fragestellung lautet, ob es auf der Basis der positiven Verstärkung und Shaping möglich ist, einen trägen Jugendlichen so zu konditionieren, dass er aktives Verhalten entwickelt.
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die Hypothese besagt, dass durch die Anwendung der operanten Konditionierung nach B.F. Skinner die Möglichkeit besteht, passiv verhaltende Jugendliche zu aktivem Verhalten zu motivieren.
Was ist der Unterschied zwischen klassischer und operanter Konditionierung?
Klassische Konditionierung (Pawlow) bezieht sich auf die Steuerung unkonditionierter Reaktionen durch neutrale Reize. Operante Konditionierung (Skinner) beschreibt, wie die Motivation für ein Verhalten durch die Reaktion der Umwelt verstärkt oder abgeschwächt wird.
Wer sind die Gründer der operanten Konditionierung?
Edward L. Thorndike, John B. Watson und B.F. Skinner gelten als Pioniere in der Entwicklung der operanten Konditionierung.
Was ist das Gesetz der Wirkung (Thorndike)?
Gemäss Thorndike führt eine Belohnung zu einer Verstärkung der Reiz-Reaktions-Verbindung, während Nicht-Belohnung zur Schwächung oder Löschung führt.
Was ist der Behaviorismus nach Watson?
Der Behaviorismus beschränkt sich auf beobachtbares Verhalten und versucht, den Organismus nach dem Vorbild einer Maschine zu verstehen (Black-Box), deren Funktionsweise nur aus Input (Reiz) und Output (Reaktion) erschlossen wird.
Was sind die zentralen Aspekte der operanten Konditionierung nach Skinner?
Die zentralen Aspekte sind: Verhaltenskontingenzen, Verstärker, Methoden zur Verhaltensänderung und diskriminierende Reize.
Was bedeutet Verhaltenskontingenz?
Verhaltenskontingenz beschreibt eine konsistente Beziehung zwischen einer Reaktion (Verhalten) und dem nachfolgenden Reiz (Verstärker) vom Typ "wenn X – dann Y".
Was ist die Skinner-Box?
Die Skinner-Box ist ein experimenteller Apparat, der es ermöglicht, die Versuchsbedingungen exakt festzulegen und von äußeren Einflüssen abzuschirmen. Das Versuchstier kann sich durch Betätigen eines Hebels Futter beschaffen.
Welche Verstärkerarten gibt es?
Es gibt primäre Verstärker (befriedigen physiologische Bedürfnisse), sekundäre Verstärker (erlernte Verstärker) und generalisierende Verstärker.
Was ist der Unterschied zwischen Belohnung und Bestrafung?
Belohnung führt zu einer Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens, während Bestrafung die Auftretenswahrscheinlichkeit eines unerwünschten Verhaltens verringern soll.
Welche Arten von Bestrafung gibt es?
Es gibt positive (direkte) Bestrafung Typ I (Zufügung einer unangenehmen Konsequenz) und negative (indirekte) Bestrafung Typ II (Entfernung einer angenehmen Konsequenz).
Was bedeutet Löschung im Kontext der operanten Konditionierung?
Löschung bedeutet das Entfallen sämtlicher Reaktionen der Umwelt auf ein bestimmtes Verhalten, um dieses zu verringern oder zu eliminieren.
- Quote paper
- Roland Del Fabro (Author), 2001, Operantes Konditionieren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103391