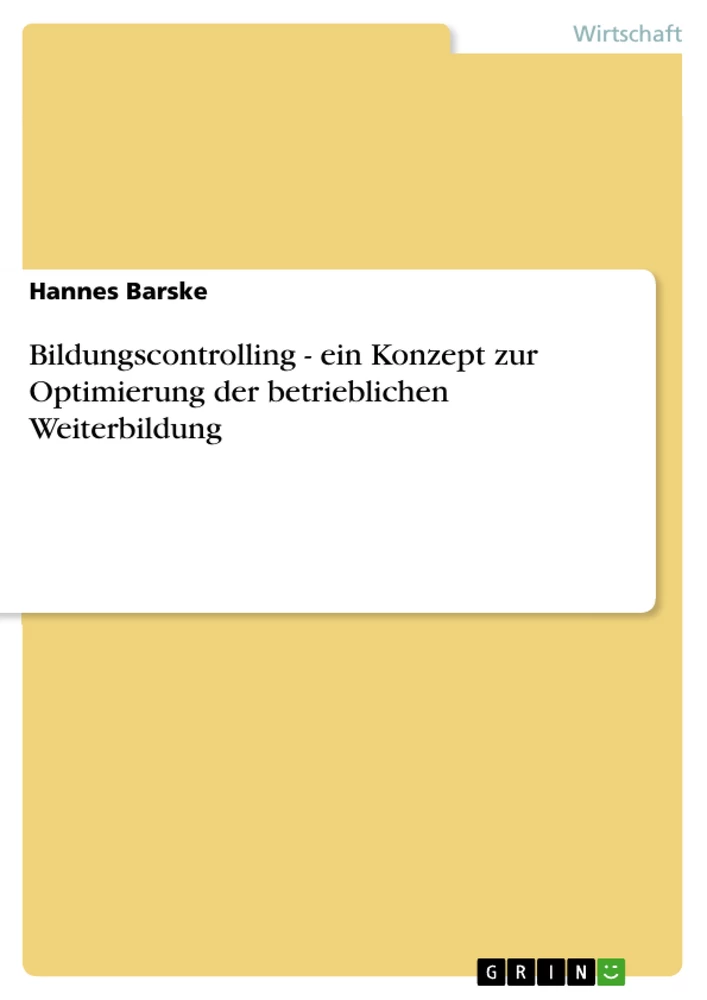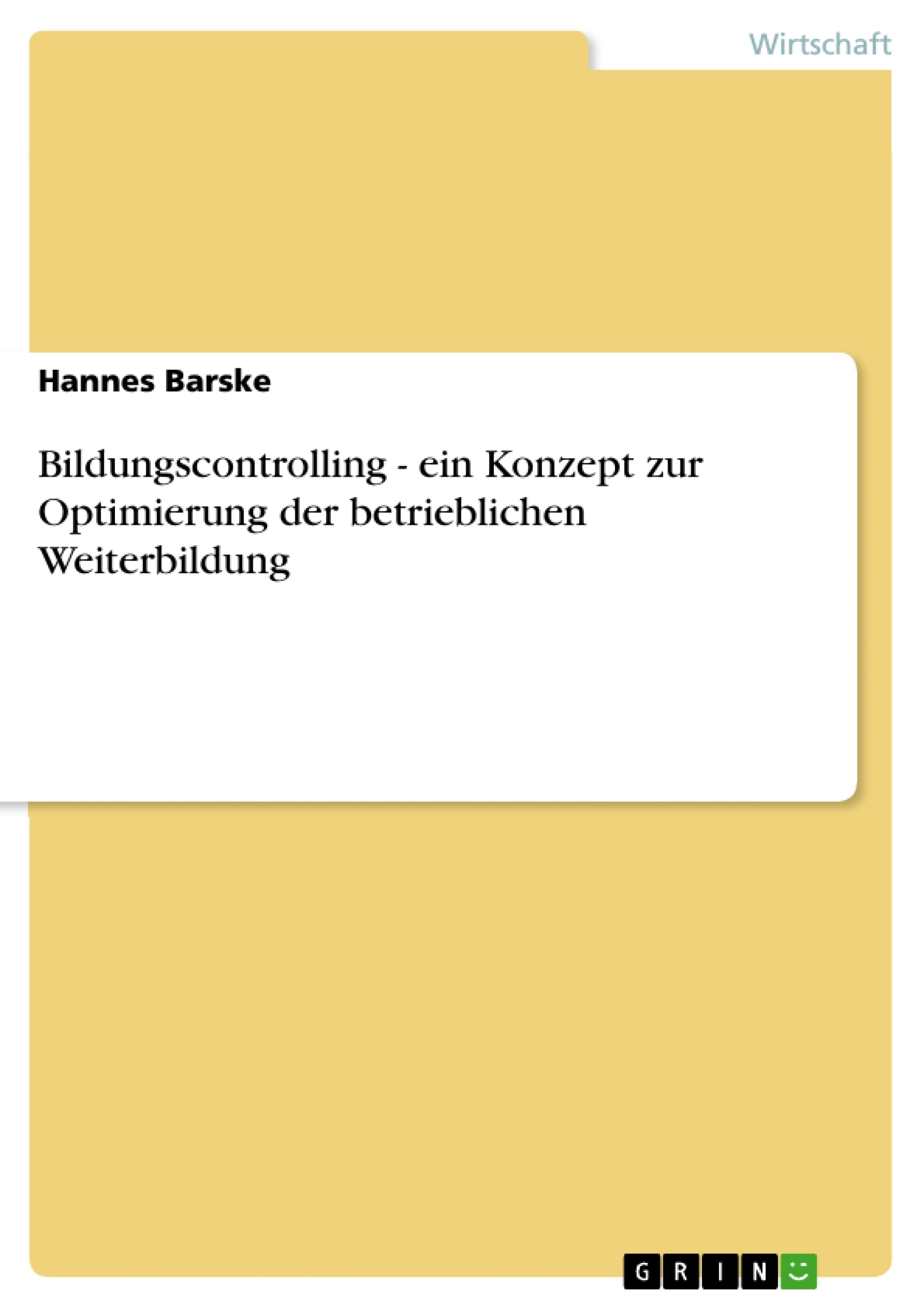1. Tradition des Controlling
Die Idee des Controlling geht auf die Zeit der industriellen Revolution in den USA zurück, als eine zunehmend finanzwirtschaftliche Überwachung angesichts zunehmender Kapitalkonzentration und Fixkostenbelastung notwendig wurde.
Dabei ist Controlling nicht nur retrospektiv gerichtet, sondern hier ist die Kontrolle mit der Planung verknüpft; Controlling wird als prozeßsteuernd bezeichnet.
Bildungscontrolling intendiert, pädagogische, weiterbildnerische Maßnahmen in monetären Größen zu beschreiben und nach Maßgabe der daraus gewonnenen Informationen in den Bildungsprozeß steuernd einzugreifen. Verglichen also mit Bildungsevaluation, liegt bei Bildungscontrolling der Schwerpunkt auf ökonomischen Aspekten.
Problematisch ist die Neuheit des Begriffes. Erst seit Anfang der 1990´er Jahre existiert die Idee einer eindeutigen Abgrenzung gegen Konzepte wie Evaluation, Erfolgskontrolle oder Qualitätssicherung. Dabei fehlt es offensichtlich immer noch an ausreichender Erfahrung mit dem Konzept des Bildungscontrolling in der Praxis; so fehlen auch empirische Forschungsergebnisse, nicht zuletzt deshalb, da das vollständige Konzept noch selten zur Anwendung kommt.
Jedoch ist die Tendenz zu beobachten, daß Bildungscontrolling – vornehmlich in den größeren Betrieben (über 500 Beschäftigte) - an Bedeutung gewinnt[1].
2. Bildungscontrolling neben Evaluation, Erfolgskontrolle und Qualitätssicherung
Auf Grund des beschriebenen Forschungsstandes läßt sich eine exakte Abgrenzung kaum vornehmen. Nicht klar ist, welcher der o.a. Begriffe als Oberbegriff gilt. In der Literatur findet man sowohl Evaluation, oder Qualitätssicherung,[2] als auch Bildungscontrolling als den jeweils allgemeineren Begriff, oder auch, daß sie als gleichrangig behandelt werden. Der Vergleich zeigt, daß die Vorgehensweise ähnlich ist, daß jedoch unterschiedliche Akzente gesetzt werden.
2.1 Zu Evaluation
Evaluation bezeichnet die Bewertung des pädagogischen Prozesses. Sie bezieht sich in der Weiterbildung auf die Beurteilung von Lehrplänen, Unterrichtsprogrammen und deren Durchführung. Kriterien, an denen eine Weiterbildungsmaßnahme gemessen werden kann, sind zum Beispiel Veränderungen im Denken und Handeln der Teilnehmer als direkte Wirkung der Maßnahme.
Evaluation als „pädagogisches Verfahren der Kontrolle der Lehr- und Lernleistung“ kann in vier Teilkonzepte unterteilt werden[3]:
- Inputevaluation, als eine Wirkungskontrolle bei Aufnahme des Lernprozesses, durch Vortest, durch festgelegte Zugangsvoraussetzungen und Vorbedingungen;
- Outputevaluation, auch als Selbstkontrolle des Dozenten durch Tests und Arbeitsproben;
- Prozessevaluation, durch teilnehmende Beobachter, Feed-Back-Bögen, um Störungen und Fehlentwicklung des Lehr- und Lernprozesses entgegenzuwirken;
- Kontextevaluation, betrachtet die Umwelt der Maßnahme, so die finanziellen, zeitlichen, räumlichen und institutionellen Rahmenbedingungen.
Evaluation ist also ein dynamischer, permanent – reflexiver Prozeß, der eine kontrollierte Rückmeldung über den Prozeßablauf geben soll.
2.2 Zu Erfolgskontrolle oder Effektivitätskontrolle
Erfolgskontrolle wird zumeist als Teilaspekt der Evaluation betrachtet. Der Begriff beschreibt einen Soll – Ist – Vergleich, z.B. des Verhaltens und Denkens der Teilnehmenden an einer Bildungsmaßnahme, also der pädagogische Erfolg der Bildungsmaßnahme, gemessen an ihren Zielen[4]. Hier ist die Kosten-Nutzen-Rechnung bisher unbeachtet.
2.3 Zu Qualitätssicherung
Qualitätssicherung betrifft nicht nur Standards innerhalb einer Firma, oder nur jeweils einen Anbieter, sondern ist vielmehr international festgelegt. Für die Prämierung von Qualität bestehen als Leitfaden die DIN-ISO 9000 bis 9004. Auf Grundlage dieser Normen zertifiziert die CERTQUA seit 1994 Bildungsmaßnahmen[5]. Motiviert ist diese Standardisierung durch den Wunsch, einen einheitlichen, transparenten Qualitätsstandard zu schaffen, der qualitätshohen Anbietern Vorteile verschafft und „schwarze Schafe“ aussondiert.
2.4 Zu Bildungscontrolling
Bildungscontrolling besagt, wie o.a., mehr als nur Kontrolle. Kontrolle ist zunächst nur eine ex-post – Betrachtung eines Prozesses. Der Kontrolle soll mit Controlling die ex-ante – Perspektive hinzugefügt werden[6]. So kann man Bildungscontrolling beschreiben als Prozeß, der jeweils parallel zum und verflochten in den Bildungsprozeß angelegt ist. „Ziel des Weiterbildungscontrolling ist es, die Effizienz und Effektivität der Weiterbildung unter Beachtung der ökonomischen und sozialen Zielsetzungen des Unternehmens zu erhöhen und die Anpassungsfähigkeit in der Um- und Innenwelt des Unternehmens zu erhöhen.“[7] Es wird mit Blick auf Bildungsmaßnahmen überprüft, ob der Output den Input rechtfertigt. Der Bildungsnutzen wird in Relation gesetzt zu den eingesetzten Ressourcen.
Jedoch soll die betriebliche Bildungsarbeit nicht „an die Kette der Ökonomie“ gelegt werden; durch Bildungscontrolling soll ein Verbindungsglied in der „Bimentalität“ von einerseits pädagogischen und andererseits ökonomischen Prozessen geschaffen werden: erst auf Grund der Transparenz durch das Bildungscontrolling soll die Bildungsarbeit im Betrieb aufgewertet werden[8].
Bildungscontrolling erstreckt sich auf den gesamten Funktionszyklus der betrieblichen Bildungsarbeit[9]: Zielsetzung, Bedarfsanalyse, Gestaltung von Bildungsmaßnahmen, deren Durchführung, Kostenkontrolle, Transfersicherung / Erfolgskontrolle.
Die Zielsetzung vermittelt sich aus den langfristigen Unternehmenszielen, so wie den Bedarfen, die das Unternehmenspersonal formuliert[10]. Die Bedarfsanalyse ist ein Soll-Ist – Vergleich zwischen aktuellen und künftigen Anforderungen, so wie auch Mitarbeiterzahlen,
z.B. durch Marktforschung, durch schriftliche Befragung oder Diskussion. Das direkte Mitarbeitergespräch wird jedoch als die „zentrale Form der Personalentwicklung“ angesehen[11].
Die Gestaltung und Durchführung der konkreten Bildungsmaßnahme hält mehrere Möglichkeiten offen, die Rahmenbedingungen werden vom Unternehmen gesetzt.
So lassen sich externe Seminare als kompakte „Ware“ einkaufen. Hier liegt die Verantwortung über Curriculum, Durchführung und Ausgestaltung beim externen Bildungsanbieter, wobei jedoch die Inhalte und Zielsetzungen von der Firmenleitung festgesetzt werden, die die Maßnahme finanziert.
Interne Schulungen mit internem Personal sind die am meisten verbreiteten; sie gelten als die arbeitsplatznaheste Form der Weiterbildung, und nicht zuletzt als die billigste. Das Grundkonzept wird dann von der Bildungsabteilung vorgelegt, kompetentes Fachpersonal wird geschult (Trainerpersonal), sowie durch Supervision unterstützt.
Bei internen Schulungen mit externen Lehrkräften werden oftmals Trainerleitfäden durch die Unternehmensleitung entwickelt, sowie die Zielvorstellung und die konkrete Ausgestaltung vorgegeben.
Bei dem Controlling der Durchführung von Bildungsmaßnahmen „werden die Möglichkeiten der Evaluation laufender Maßnahmen kaum genutzt“[12]. Sogenannte „happiness – sheets“ oder auch direkte Befragungen der Teilnehmenden durch die Bildungsverantwortlichen nach den Veranstaltungen sind häufig eingesetzte Evaluationsinstrumente, um eine Rückmeldung über das aktuelle Geschehen zu erhalten. Der Wert von solchen Befragungen wird allgemein als gering bezeichnet, da man hier den Transfer noch nicht beobachten kann. Vielmehr sei der langfristige Vergleich von schriftlichen Befragungen fruchtbar, denn hier lassen sich Tendenzen registrieren[13].
Bei der Kostenkontrolle kann man drei Arten von Kosten berechnen: Die direkten Kosten, wie Teilnehmergebühren und Trainerhonorrare, indirekte Kosten und Alternativkosten, wie
z.B. Arbeitsausfall und Berechnung des Gewinnes, wenn anstelle der Bildungsmaßnahme gearbeitet würde. Zumeist verzichtet man allerdings auf die Erfassung der beiden letzteren und beschränkt sich auf die direkten Kosten. Regelmäßige Kostenkontrollen dienen vorrangig der Planung folgender Weiterbildungsperioden[14].
Bei der Transfersicherung und Erfolgskontrolle kann der Nutzen für das Unternehmen gezielt durch Befragung der Teilnehmenden am Arbeitsplatz, der Fachvorgesetzten ermittelt werden, um festzustellen, ob die Probleme, die Anlaß für die Weiterbildungsmaßnahme waren, behoben oder gemildert worden sind, bzw., ob die Maßnahmen der Kompetenzentwicklung zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen.
Als Ex-post-Kontrolle werden Outputsteigerungen, Zeitersparnisse, Qualitätsverbesserungen und Kosteneinsparungen gemessen, um die Rentabilität von Bildungsmaßnahmen zu beurteilen.
[...]
[1] Bildungscontrolling – ein Konzept zur Optimierung der betrieblichen Weiterbildungsarbeit. Hrsg: Bundesinstitut für Berufsbildung; KREKEL, E. M.; SEUSING, Beate. Bielefeld (Hrsg.) : Bertelsmann 1999, S. 42, f.
[2] ebenda, S. 31
[3] MERK, Richard : Weiterbildungsmanagement. Bildung erfolgreich und innovativ managen. 2., überarbeitete Auflage. Neuwied; Kriftel; Berlin : Luchterhand 1998 (Grundlagen der Weiterbildung), S. 374, f.
[4] Bildungscontrolling – ein Konzept zur Optimierung der betrieblichen Weiterbildungsarbeit. Hrsg: Bundesinstitut für Berufsbildung; KREKEL, E. M.; SEUSING, Beate. Bielefeld : Bertelsmann 1999, S.17
[5] ebenda, S. 18: „Die CERTQUA ist eine ,Gesellschaft der Deutschen Wirtschaft zur Förderung und Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen in der Beruflichen Bildung“ (...)
[6] ebenda, S. 19
[7] ebenda, S. 5, aus: PIELER, Dirk: Weiterbildung - eine neue Perspektive. Von der Prozess- zur Systemsteuerung. In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis Heft 2/1998, S 150-161
[8] Bildungscontrolling – ein Konzept zur Optimierung der betrieblichen Weiterbildungsarbeit. Hrsg: Bundesinstitut für Berufsbildung; KREKEL, E. M.; SEUSING, Beate. Bielefeld : Bertelsmann 1999, S.22
[9] ebenda, S. 19
[10] ebenda, S. 59
[11] ebenda, S. 61
[12] ebenda, S. 63
[13] ebenda
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Tradition des Controlling im Kontext der betrieblichen Weiterbildung?
Die Idee des Controlling entstand in den USA während der industriellen Revolution, um die finanzwirtschaftliche Überwachung angesichts steigender Kapitalkonzentration und Fixkosten zu gewährleisten. Im Bildungscontrolling geht es darum, pädagogische Maßnahmen in monetären Größen zu beschreiben und den Bildungsprozess entsprechend zu steuern. Im Vergleich zur Evaluation liegt der Schwerpunkt auf ökonomischen Aspekten. Obwohl Bildungscontrolling noch relativ neu ist (Anfang der 1990er), gewinnt es besonders in größeren Betrieben an Bedeutung.
Wie unterscheidet sich Bildungscontrolling von Evaluation, Erfolgskontrolle und Qualitätssicherung?
Eine klare Abgrenzung ist schwierig, da die Begriffe oft synonym oder als Ober- bzw. Unterbegriffe verwendet werden. Gemeinsam ist ihnen die ähnliche Vorgehensweise, aber unterschiedliche Schwerpunkte. Während Evaluation den pädagogischen Prozess bewertet, konzentriert sich Erfolgskontrolle auf den Soll-Ist-Vergleich der Bildungsziele. Qualitätssicherung bezieht sich auf international festgelegte Standards (DIN-ISO 9000 bis 9004). Bildungscontrolling hingegen betrachtet den gesamten Funktionszyklus der betrieblichen Bildungsarbeit und zielt darauf ab, die Effizienz und Effektivität unter Berücksichtigung ökonomischer und sozialer Zielsetzungen zu erhöhen.
Was beinhaltet Evaluation im Bildungsbereich?
Evaluation ist die Bewertung des pädagogischen Prozesses, einschließlich Lehrpläne, Unterrichtsprogramme und deren Durchführung. Kriterien sind beispielsweise Veränderungen im Denken und Handeln der Teilnehmer. Die Evaluation kann in vier Teilkonzepte unterteilt werden: Inputevaluation, Outputevaluation, Prozessevaluation und Kontextevaluation. Es ist ein dynamischer und reflexiver Prozess, der eine kontrollierte Rückmeldung über den Prozessablauf geben soll.
Was versteht man unter Erfolgskontrolle oder Effektivitätskontrolle?
Erfolgskontrolle ist ein Teilaspekt der Evaluation und beschreibt einen Soll-Ist-Vergleich, z.B. des Verhaltens und Denkens der Teilnehmenden an einer Bildungsmaßnahme. Es geht um den pädagogischen Erfolg gemessen an den Zielen der Maßnahme, ohne Berücksichtigung der Kosten-Nutzen-Rechnung.
Was ist Qualitätssicherung im Kontext von Bildungsmaßnahmen?
Qualitätssicherung betrifft Standards, die international festgelegt sind (DIN-ISO 9000 bis 9004). Die CERTQUA zertifiziert auf dieser Grundlage seit 1994 Bildungsmaßnahmen. Ziel ist ein einheitlicher, transparenter Qualitätsstandard, der qualitätshohen Anbietern Vorteile verschafft.
Was umfasst Bildungscontrolling konkret?
Bildungscontrolling geht über die reine Kontrolle hinaus und betrachtet den Bildungsprozess sowohl ex-post als auch ex-ante. Es ist ein Prozess, der parallel zum und verflochten in den Bildungsprozess angelegt ist. Ziel ist es, die Effizienz und Effektivität der Weiterbildung unter Berücksichtigung ökonomischer und sozialer Zielsetzungen zu erhöhen. Es erstreckt sich auf den gesamten Funktionszyklus der betrieblichen Bildungsarbeit: Zielsetzung, Bedarfsanalyse, Gestaltung von Bildungsmaßnahmen, deren Durchführung, Kostenkontrolle, Transfersicherung / Erfolgskontrolle.
Wie werden die Kosten von Bildungsmaßnahmen kontrolliert?
Bei der Kostenkontrolle werden drei Arten von Kosten berechnet: Direkte Kosten (z.B. Teilnehmergebühren, Trainerhonorare), indirekte Kosten und Alternativkosten (z.B. Arbeitsausfall, entgangener Gewinn). Oft beschränkt man sich jedoch auf die Erfassung der direkten Kosten. Regelmäßige Kostenkontrollen dienen der Planung folgender Weiterbildungsperioden.
Wie wird die Transfersicherung und Erfolgskontrolle gewährleistet?
Der Nutzen für das Unternehmen wird durch Befragung der Teilnehmenden am Arbeitsplatz und der Fachvorgesetzten ermittelt, um festzustellen, ob die Probleme, die Anlaß für die Weiterbildungsmaßnahme waren, behoben oder gemildert wurden und ob die Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Als Ex-post-Kontrolle werden Outputsteigerungen, Zeitersparnisse, Qualitätsverbesserungen und Kosteneinsparungen gemessen, um die Rentabilität von Bildungsmaßnahmen zu beurteilen.
- Quote paper
- Hannes Barske (Author), 2000, Bildungscontrolling - ein Konzept zur Optimierung der betrieblichen Weiterbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103369