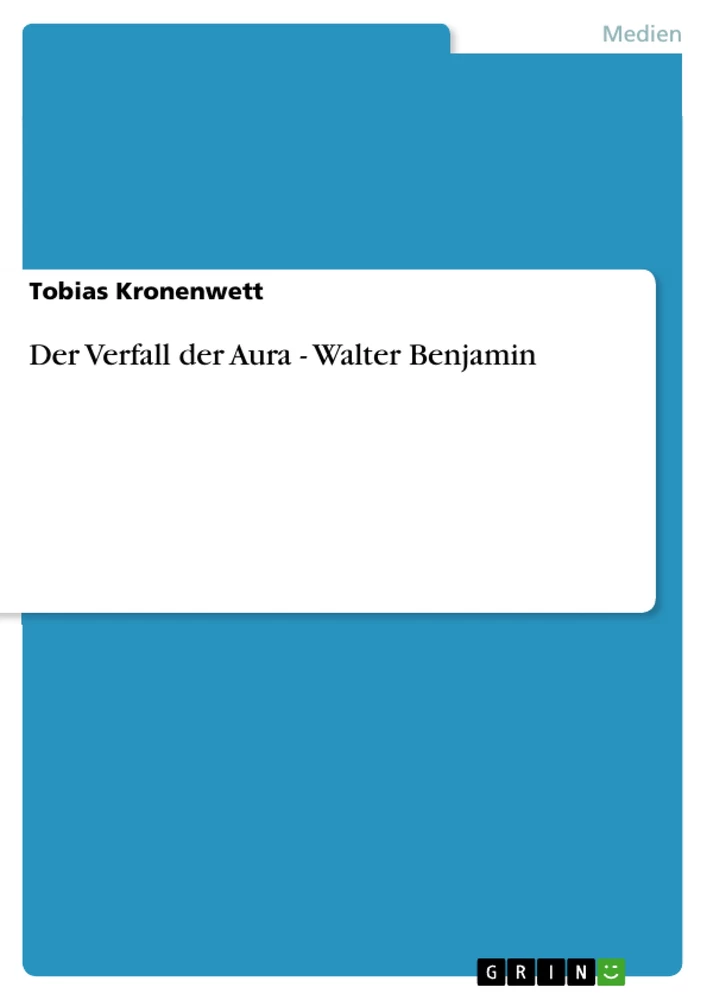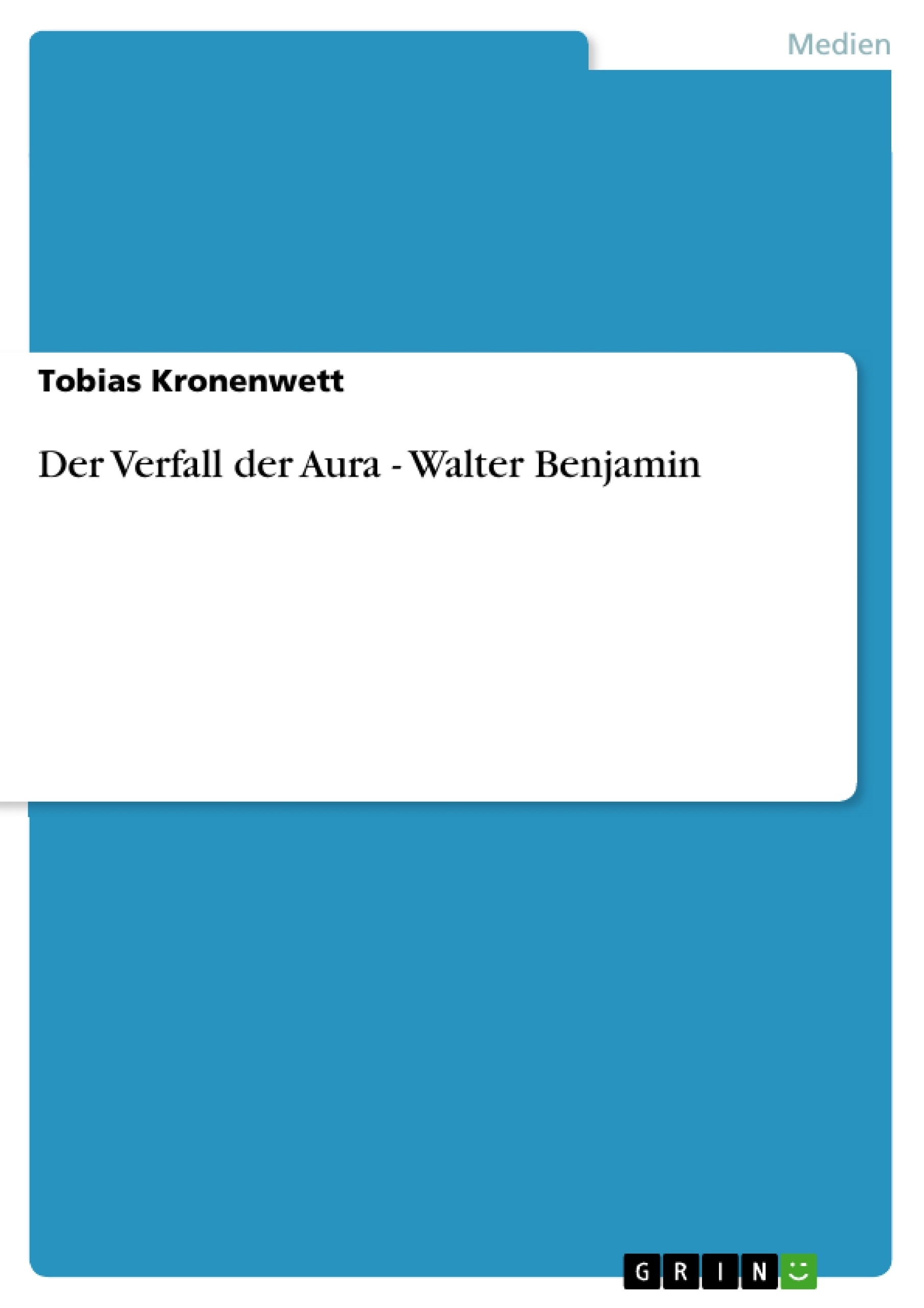Was bedeutet es, wenn Kunst plötzlich für alle zugänglich wird? Walter Benjamins bahnbrechender Essay "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" entführt uns in eine Epoche des Wandels, in der die traditionelle Vorstellung von Kunst auf den Kopf gestellt wird. Eine Zeit, in der die Aura des Einzigartigen, des Unwiederbringlichen, durch die maschinelle Vervielfältigung zu verblassen droht. Benjamin seziert messerscharf die Auswirkungen der Fotografie und des Films auf die Kunstwelt, analysiert die Verschiebung von Kultwert hin zum Ausstellungswert und enthüllt die tiefgreifenden Konsequenzen für Künstler und Publikum. Erleben Sie, wie die technische Reproduktion die Kunst aus ihrem rituellen Kontext löst und eine Massenwirksamkeit erzeugt, die zuvor undenkbar war. Doch ist dieser Verlust der Aura wirklich ein Verlust, oder eröffnet er nicht auch neue Möglichkeiten der Teilhabe und Demokratisierung von Kunst? Tauchen Sie ein in Benjamins brillante Analyse, die bis heute nichts von ihrer Brisanz verloren hat, und entdecken Sie, wie die Mechanismen der Reproduktion unsere Wahrnehmung von Kunst, Kultur und Gesellschaft prägen. Eine faszinierende Reise durch die Welt der Kunst, der Technik und der philosophischen Reflexion, die unser Verständnis von Originalität, Authentizität und dem Wesen der Kunst für immer verändern wird. Entdecken Sie die tiefgreifenden Veränderungen im Verhältnis von Kunst und Gesellschaft, die durch die technische Revolution ausgelöst wurden, und hinterfragen Sie die Rolle von Kunst in einer Welt der unendlichen Reproduzierbarkeit. Ein Muss für Kunstliebhaber, Medienkritiker und alle, die sich für die Auswirkungen der Technologie auf unsere Kultur interessieren. Lassen Sie sich von Benjamins visionären Gedanken inspirieren und diskutieren Sie mit über die Zukunft der Kunst im digitalen Zeitalter. Dieses Werk ist eine unentbehrliche Lektüre für jeden, der die komplexen Zusammenhänge zwischen Kunst, Technologie und Gesellschaft verstehen will. Es bietet eine einzigartige Perspektive auf die Herausforderungen und Chancen, die die moderne Welt für die Kunst bereithält.
Inhaltsverzeichnis
-Einleitung
-Hauptteil
1. Der Begriff der Reproduktion
2. Das Kunstwerk und seine Aura
3. Kulturwert/ Ausstellungswert Am Beispiel Photographie und Film
4. Schluss
Einleitung
Walter Benjamin wurde 1892 in Berlin geboren, musste während des Naziregimes nach Frankreich flüchten und lebt dort in ständiger finanzieller Notlage. 1940 begeht er auf der Flucht vor der Gestapo an der spanischen Grenze Selbstmord.
Benjamins literarisches Schaffen war stets von Unvollständigkeit geprägt. Oft handelt es sich nur um Stoffsammlungen oder Ansätze. Sein Essay „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ beleuchtet die Auswirkungen von Reproduktion auf die Kunst, sowie auf die Intension unter der Kunst entsteht.
1. Der Begriff der Reproduktion
Zunächst gilt es den Begriff der technischen Reproduktion zu definieren. Walter Benjamin definiert Reproduktion als etwas, was es schon immer gab .
“ Das Kunstwerk ist grunds ä tzlich immer reproduzierbar gewesen. Was Menschen gemacht hatten, das konnte immer von Menschen nachgemacht werden. “ 1
Eine neue Qualität erreichte die Reproduktion jedoch durch die technischen Errungenschaften zur Vervielfältigung, wie z.b. den Buchdruck oder die Lithographie. Nun ist es möglich Kunst massenweise herzustellen. Die technische Reproduktion stellt die Einzigartigkeit eines Kunstwerks in Frage, sie erreicht selbst den Status einer künstlerischen Verfahrensweise .
„ Um neunzehnhundert hatte die technische Reproduktion einen Standard erreicht, auf dem sie nicht nur die Gesamtheit der ü berkommenen Kunstwerke zu ihrem Objekt zu machen und deren Wirkung den tiefen Ver ä nderung zu unterwerfen begann, sondern sich einen eigenen Platz unter den k ü nstlerischen Verfahrensweisen eroberte “ 2
Somit wird Reproduktion zu Kunstform, als Beispiel lassen sich der Film oder die Photographie nennen. Doch was macht das Kunstwerk im Auge des Betrachters zu etwas einmaligem?
Walter Benjamin verwendet den Begriff der „Aura“ um zu dokumentieren, wie ein Kunstwerk auf den Betrachter als einmalig wirkt.
2. Das Kunstwerk und seine Aura
Die „Aura“ ist ein ständig wiederkehrender Begriff, wenn es Walter Benjamin um die Einzigartigkeit eines Kunstwerkes geht. Er vergleicht die Aura eines Kunstwerkes mit der Ganzheitlichkeit eines Naturerlebnisses, etwas das immer in der Ferne liegt, z.b. einem Sonnenuntergang.
„ An einem Sommernachmittag ruhend einem Gebirgszug am Horizont oder einem Zweig folgen, der seinen Schatten auf den Ruhenden wirft - das hei ß t die Aura dieser Berge, dieses Zweiges atmen. “ 3
Diese Aura eines Kunstwerkes rührt von seinem Ursprung, seiner Tradition her. Diese Tradition ist eng verknüpft mit der Ritualfunktion, die, die Kunst von den ersten Höhlenmalereien an trägt. Kunst kann man laut Benjamin nicht entkoppelt von ihrer Ritual- oder Kultfunktion betrachten.
„ Der einzige Wert des <echten> Kunstwerks hat seine Fundierung im Ritual, in dem es seinen origin ä ren und ersten Gebrauchswert hatte. “ 4
Daraus wird deutlich, dass Kunst, vor dem Zeitalter der technischen Reproduktion, aus einem Gebrauchswert heraus entstand um eine bestimmte Ritualfunktion zu übernehmen. Durch die Reproduzierbarkeit wird diese Funktion aufgehoben und das Kunstwerk emanzipiert sich gegenüber dem Ritual.
„ Die Reproduktionstechnik[...] l ö st das Reproduzierte aus dem Bereich der Tradition ab. Indem sie die Reproduktion vervielf ä ltig, setzt sie an die Stelle des einmaligen Vorkommens ein Massenwei ß es. “ 5
In dieser Theorie spiegelt sich die Kritik am gemeinen Glauben, des vollständig Berechenbaren, dem Sieg der Naturwissenschaft über den Geist, der in dieser Zeit des technischen Aufbruchs herrschte, nieder.
„ So bekundet sich im anschaulichen Bereich was sich im Bereich der Theorie als zunehmende Bedeutung der Statistik bemerkbar macht. “ 6
3. Kulturwert/ Ausstellungswert
Einen weiteren Effekt der durch technische Reproduzierbarkeit sieht Benjamin in der Verschiebung weg vom Kulturwert, hin zum Ausstellungswert eines Kunstwerks.
Durch die Reproduzierbarkeit vor allem in den neuen Medien wie z.b. dem Film geht die Intension der Künstler weg vom Schaffen eines Kunstwerkes zum Ausdruck eines religiösen oder spirituellen Aspektes, also weg vom Kultobjekt, hin zum Schaffen von Kunst zum Zwecke der Präsentation. Dies revolutioniert die Kunst. Im Angesicht dieser Krise entwickelt sich die „L `art pour L `art“ die, die Kunst als Selbstzweck propagiert. Am drastischsten wird die Verschiebung von Kunstwert und Ausstellungswert für Benjamin in der Photographie sichtbar.
„ In der Photographie beginnt der Ausstellungswert den Kultwert auf ganzer Linie zur ü ckzudr ä ngen. “ 7
Im Film verschwindet der Kultwert schließlich vollständig und der Ausstellungswert wird zur Motivation des Künstlers. Durch dieses Ungleichgewicht verliert der Film seine Aura. Zur Verdeutlichung zieht Benjamin den Vergleich zwischen einem Bühnenschauspieler und einem Darsteller in einem Film. Der Bühnenschauspieler kann jederzeit auf die Reaktionen seines Publikums reagieren, während der Darsteller in einem Film zur Passivität verbannt ist. Er ist auf die Kamera als Mittel angewiesen und kann nicht auf die Interaktion mit dem Publikum zurückgreifen und kann somit kein Kultwert schaffen.
„ Das Publikum f ü hlt sich in den Darsteller nur ein, indem es sich in den Apparat einf ü hlt. Es ü bernimmt also dessen Haltung, es testet. Das ist keine Haltung der Kultwerte ausgesetzt werden k ö nnen. “ 8
4. Schluss
Walter Benjamin nimmt in seinem Essay eine sehr kritische Haltung gegenüber der technischen Reproduktion, sowie den neuen Medien ein. Die Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben und die Politik vernachlässigt er, was aus seiner Situation als im Exil lebender heraus nachvollziehbar ist. Dennoch hat Massenkunst doch auch etwas positives. Kunst wird für jeden zugänglich und somit demokratischer. Sie wird, vom Privileg einiger weniger, zum Ereignis an dem jeder in irgendeiner Form teilhaben kann. Und das ist doch auch eine Art von Aura, die, die Kunst dann umgibt.
Literaturverzeichnis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit; Suhrkamp Ffm 1966 S.10
2 Benjamin: Das Kunstwerk... S. 11
3 Benjamin: Das Kunstwerk... S. 15
4 Benjamin: Das Kunstwerk... S. 16
5 Benjamin: Das Kunstwerk... S. 13
6 Benjamin: Das Kunstwerk... S. 16
7 Benjamin: Das Kunstwerk... S. 21
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus von Walter Benjamins Essay "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit"?
Der Essay untersucht die Auswirkungen der technischen Reproduktion auf die Kunst, insbesondere die Veränderung der Intention, unter der Kunst entsteht, sowie die Einzigartigkeit von Kunstwerken.
Wie definiert Benjamin den Begriff "Reproduktion"?
Benjamin definiert Reproduktion als etwas, das es schon immer gegeben hat, d.h. Menschen können immer nachmachen, was andere geschaffen haben. Die technische Reproduktion, wie Buchdruck und Lithographie, ermöglicht jedoch eine massenweise Herstellung, die die Einzigartigkeit eines Kunstwerks in Frage stellt.
Was versteht Benjamin unter der "Aura" eines Kunstwerks?
Die "Aura" ist ein Begriff, den Benjamin verwendet, um die Einzigartigkeit und Ganzheitlichkeit eines Kunstwerks zu beschreiben. Er vergleicht sie mit einem Naturerlebnis, das immer in der Ferne liegt. Die Aura rührt von Ursprung und Tradition des Werkes her und ist eng mit seiner Ritualfunktion verbunden.
Welche Auswirkungen hat die technische Reproduzierbarkeit auf den Kulturwert und Ausstellungswert eines Kunstwerks?
Benjamin sieht eine Verschiebung vom Kulturwert hin zum Ausstellungswert. Durch die Reproduzierbarkeit, besonders in den neuen Medien, verliert das Kunstwerk seine ursprüngliche Ritualfunktion und wird eher zum Zweck der Präsentation geschaffen. Dies führt zur Entwicklung von "L'art pour L'art" und wird besonders in der Photographie sichtbar.
Wie beeinflusst die technische Reproduzierbarkeit die Rolle des Künstlers, insbesondere im Film?
Im Film verschwindet der Kultwert fast vollständig, da der Ausstellungswert zur Hauptmotivation des Künstlers wird. Benjamin vergleicht Bühnenschauspieler und Filmdarsteller, um zu verdeutlichen, dass Filmdarsteller durch die Abhängigkeit von der Kamera passiver sind und keinen Kultwert schaffen können.
Welche Kritik übt Benjamin an der technischen Reproduktion?
Benjamin nimmt eine kritische Haltung gegenüber der technischen Reproduktion ein und sieht sie als Bedrohung für die Aura und Einzigartigkeit von Kunstwerken. Er vernachlässigt jedoch positive Aspekte wie die Demokratisierung der Kunst.
Welche Schlussfolgerung zieht Benjamin in seinem Essay?
Benjamin kritisiert die technischen Reproduktion und die neuen Medien für deren Einfluss auf Kunst, dennoch kann Massenkunst auch etwas Positives haben, da Kunst somit für jeden zugänglich wird und so eine gewisse Demokratisierung der Kunst stattfindet.
- Quote paper
- Tobias Kronenwett (Author), 2001, Der Verfall der Aura - Walter Benjamin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103360